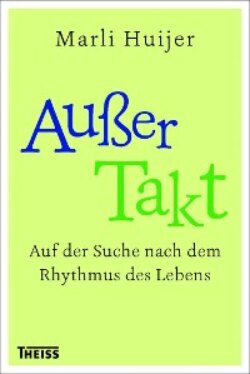Читать книгу Außer Takt - Marli Huijer - Страница 17
Diskontinuität
ОглавлениеIch schreibe das alles hier während eines Aufenthaltes in Ouddorp auf der südholländischen Insel Goeree-Overflakkee, wo ich als Kind mit meiner Mutter, meinen Tanten, Brüdern, Cousinen und Cousins viele Sommer verbracht habe. Sechs Wochen lang streiften wir durch die Dünen, schwammen im Meer, kletterten auf die Bunker, fingen Aale und spielten Verstecken auf dem Campingplatz mit dem Namen „De Vrijheid“ (Die Freiheit). Nach drei Wochen kamen die Väter, nahmen uns lachend auf den Arm und bewunderten unsere braune Haut.
Auf meinen Strandspaziergängen überfallen mich die Erinnerungen: Ich gehe zum Leuchtturm, neben mir mein Vater, der damals ungefähr Ende vierzig gewesen sein muss. Meine Cousine Marijke hilft mir, im Sand nach der Münze zu suchen, die ich verloren habe. Cousin Willy gräbt eine so tiefe Kuhle in den Sand, dass er ganz darin verschwindet. Mein Vater bringt mir bei, wie man Aale häutet. Meine Mutter kriecht unter dem Stacheldraht der Westdünen hindurch, um wilde Champignons zu pflücken. Bei Einbruch der Dämmerung holen mich meine Eltern vom Strand ab. Ich will nicht nach Hause, zuerst muss ich den Anker, der auf dem Strand liegt, ausgraben. Morgen ist auch noch ein Tag, sagen meine Eltern und versprechen, dass der Anker auch morgen noch da sein wird.
Die Zeiten von Ouddorp sind endgültig vorbei. Mein Vater ist Anfang der Achtzigerjahre gestorben, meine Mutter ein paar Jahre später. Die Onkel sind alle tot, die noch lebenden Tanten emigriert, meine älteren Brüder sind nach Kanada ausgewandert, auch die meisten Cousins und Cousinen wohnen nicht mehr in den Niederlanden. Auch den Anker gibt es nicht mehr.
Die Erinnerungen an die Sommer in Ouddorp reichen bis zu meinem achtzehnten Lebensjahr, die Erinnerungen an meinen Vater, bis ich Ende zwanzig bin. Um mich herum gibt es nur noch wenige Menschen, die ihn gekannt haben. Weder meine Kinder noch meine besten Freunde haben ihn je gesehen. Ab und zu hole ich ein Foto von ihm hervor, doch es will so gar nicht zu meinen Erinnerungen passen. Die Zeiten meines Vaters und der Sommer in Ouddorp sind endgültig vorbei.
Ich könnte natürlich so tun, als lebten meine Eltern in meiner Erinnerung fort, als wäre die Zeit mit ihnen nicht vergangen. Doch ich weiß, dass die Erinnerungen an meine Eltern fehlerhaft sind. Sie haben sich im Lauf der Zeit verändert, sind verblasst. Jedes Mal, wenn ich von meinen Eltern erzähle, passe ich meine Geschichten an. Das fällt mir aber erst auf, wenn ich höre, wie sich meine Brüder an sie erinnern. Erinnerungen werden mit der Zeit immer unzuverlässiger. Meine Erinnerungen an die Eltern enden mit deren Tod. Danach kamen keine neuen hinzu.
Für mich gibt es einen deutlichen Bruch zwischen der Zeit, in der mein Vater am Leben war, und der Zeit danach. Er lebt nicht in der Gegenwart fort. Sein Leben endete vor ungefähr dreißig Jahren, und je länger sein Tod vergangen ist, desto mehr nimmt die Erinnerung an ihn ab und wird auch immer verschwommener. Und da meine Mutter kurz nach ihm starb, ist keiner mehr da, der die Erinnerung an ihn lebendig hält.
In La dialectique de la durée, die 1927 als kritische Reaktion auf die Philosophie Bergsons erschien, widerspricht Bachelard der Idee eines unaufhörlichen Flusses der Zeit. Seiner Ansicht nach gibt es nicht nur eine einzige lange Dauer, sondern mehrere „Dauern“. Jeder Mensch, jedes Tier, jeder Gegenstand und jedes Phänomen hat seine spezifische Dauer, mit eigenem Beginn und eigenem Ende.
Die Vielzahl von Dauern lässt sich am Beispiel der Beziehung zwischen Mensch und Hund illustrieren: Ein Kollege erzählte mir, dass er in die Hunderasse des Stabyhoun vernarrt sei. Ein Stabyhoun ist ein freundlicher Hund mit einem langhaarigen, schwarz oder braun gefleckten Fell. Die Lebenserwartung eines Hundes ist deutlich niedriger als die des Menschen, weshalb mein Kollege, der nicht ohne seinen Stabyhoun leben will, während seines Lebens bereits mehrere Hunde zu Grabe getragen hat. Danach hat er sich jedes Mal einen neuen angeschafft. Er erklärt mir jedoch, dass die verschiedenen Hunde nicht einfach nahtlos ineinanderübergegangen seien. Jeder Hund habe seinen eigenen Namen, seinen eigenen Charakter und auch seine eigene Fellzeichnung gehabt. Manchmal habe er eine Weile gebraucht, bis er den Tod des alten Hundes überwunden habe und bereit für einen jungen Hund gewesen sei. Zwischen den einzelnen Hunden gab es also immer eine Lücke oder einen Bruch und die Hunde folgten nicht kontinuierlich aufeinander, sondern die Abfolge der einzelnen Hunde war diskontinuierlich.
Auch Menschenleben gehen nicht kontinuierlich ineinander über. Jeder Mensch hat einen Anfang und ein Ende, nicht nur im Leben, sondern auch in der Erinnerung. Nach zwei Generationen ist die Erinnerung an eine Person meist verschwunden: Über unsere Großeltern können wir noch das eine oder andere erzählen, aber über unsere Urgroßeltern oder Ururgroßeltern wissen wir so gut wie nichts. Nicht einmal in Geschichten leben frühere Generationen weiter.
Bachelard wirft Bergson vor, dass er in seinen Büchern das Verschwinden von Erinnerungen nicht berücksichtigt. In Schöpferische Evolution (1907) erzählt Bergson, dass die Vergangenheit sich selbst bewahrt und dass sie uns in jedem Moment in ihrer Gänze zur Verfügung steht:
Was wir von frühester Kindheit an gefühlt, gedacht, gewollt haben, ist da: über die Gegenwart geneigt, die ihm zuwächst, und andrängend an die Tür des Bewusstseins, das es aussperren möchte.38
Die gesamte Vergangenheit ist in der Gegenwart anwesend. Bergson geht nicht davon aus, dass etwas für immer vergessen ist, und vergleicht die Vergangenheit mit einem Schneeball, der einen Abhang hinabrollend immer größer wird. Jede neue Schneeschicht vermehrt sich um die früheren Schichten, wodurch sich schließlich die gesamte Vergangenheit im Schneeball befindet.39
Würde man Bergsons Schneeball auseinandernehmen, dann kämen sämtliche Erinnerungen zum Vorschein. Im Falle meines Kollegen träte jeder einzelne Stabyhoun in seiner vollen Pracht wieder in Erinnerung. Mein Vater würde, wie vom Tode auferstanden, frisch in mein Gedächtnis hineinspazieren. Das wäre eine äußerst merkwürdige Erfahrung, weil er dann nicht mit dem Aussehen eines Vaters, sondern mit dem eines Gleichaltrigen auf mich zukäme. Er altert nicht mehr, weil sein Leben definitiv zu Ende ist, während ich immer älter werde.
Bachelard findet Bergsons Gedanken von der einen Dauer unangemessen, weil sie nicht berücksichtigt, was er „la diversité temporelle“ nennt, die temporäre Mannigfaltigkeit der Phänomene:40 Jeder Mensch, jedes Ding besitzt eine andere Dauer, einen anderen Anfang, ein anderes Ende. Die Dauer meines Lebens unterscheidet sich von der meines Vaters, mein Leben begann später als seines, es spielt sich in einer anderen Zeit ab und dauert nun bereits länger als seines.
Diese Mannigfaltigkeit der Dauern löst sich auf, wenn man von einer tiefen Zeit ausgeht, die wie ein ununterbrochener, durchgehender Fluss jedes Phänomen in das folgende Phänomen übergehen lässt, jeden Hund in den folgenden. Auch die These, dass die Erinnerung an uns bis in alle Ewigkeit fortbesteht, ist nach Ansicht Bachelards inakzeptabel. Wie schmerzhaft es auch immer ist: Auf die Dauer verschwinden wir fast alle im großen Buch des Vergessens.
Wenn wir Bachelards Idee von der Pluralität von Dauern, denen nicht eine einzige Dauer zugrunde liegt, ernst nehmen, müssen wir auch die Brüche und Lücken zwischen den einzelnen Phänomenen mit ihrer unterschiedlichen Dauer akzeptieren. Während dieser Lücken sind die Phänomene abwesend: Sie dauern dann nicht. In der Wirklichkeit, aber auch in unserer Psyche, existiert der Tod des alten Hundes unabhängig vom Leben des neuen Hundes: Zwischen beiden Hunden klafft ein Loch.
Bergson dagegen glaubt nicht an die Existenz von Lücken. Er leugnet die Existenz der Leere. Jeder Zustand geht bei ihm ohne Unterbrechung in den nächsten über. Jede Note einer Melodie ist Teil der nächsten, jeder psychische Zustand setzt sich ohne Unterbrechung im nächsten fort.41 Den möglichen Einwand, zwischen der einen und der nächsten Note gebe es immer eine Lücke, wischt Bergson weg: Wir erinnern uns beim Hören einer Note an den Klang der vorigen, die mit herüberklingt. Auch die Ruhe ist bei ihm nicht leer, sondern immer voller Aktivität. Jeder Übergang von einer zur nächsten Situation ist unendlich gefüllt, er behauptet sogar, dass das Nichts voll von etwas sei.
Bachelard zerschlägt Bergsons endlose Volte. Er sieht die Zeit lieber als eine Fülle von Augenblicken (instants).42 Dadurch, dass wir uns ständig entscheiden müssen, sagt er, entsteht zwischen den einzelnen Momenten Kohäsion oder Kontinuität: Wir verbinden den einen Augenblick mit dem anderen. Wir würden niemals den Wunsch nach Kontinuität hegen, wären wir nicht selbst etwas wie Endlichkeit oder ein Ende.43 Jedes Mal, wenn wir uns einer Sache verweigern, schließen wir etwas ab, und auch wenn wir etwas bejahen, bedeutet das, dass wir etwas anderes hinter uns lassen. Deshalb scheuen wir uns davor, etwas endgültig zu bejahen oder zu verneinen. Oder mit Bachelards Worten:
Sobald eine Handlung beabsichtigt ist, sobald sie bewusst ist, sobald sie Reserven psychischer Energie investiert, kann sie nicht kontinuierlich ablaufen. Ihr geht ein Zögern voraus, sie wird erwartet, hinausgezögert, provoziert, zahlreiche Nuancen, die ihre Abgeschlossenheit belegen und ihr Auftreten in einer dialektischen Wellenbewegung.44
Der bergsonianischen Auffassung der fortlaufenden Dauer stellt Bachelard eine diskontinuierliche Zeit gegenüber, in der Ruhe und Arbeit, Etwas und Nichts, Erschaffen und Zerstören deutlich voneinander geschieden sind und einander abwechseln. Insofern überhaupt die Rede von „Dauer“ sein kann, ist diese nach Bachelard lückenhaft.45
Diese Lücken existieren nicht nur zwischen den zahlreichen Gegenständen oder Ereignissen um uns herum, sondern auch im psychischen Leben. In der Psyche laufen mentale Prozesse auf verschiedenen Ebenen ab. Das geschieht gleichzeitig, und jeder Prozess besitzt eine eigene Dauer. Die Motivation, ein Buch lesen zu wollen, kann von einem Kind sabotiert werden, das Aufmerksamkeit heischen will. Wenn wir danach das Buch wieder zur Hand nehmen, haben wir vergessen, was wir gerade gelesen haben, wodurch die Motivation, das Buch zu Ende zu lesen, verschwunden sein kann. Es entsteht eine Lücke, in der wir kein Buch lesen. Wir wenden uns dann einem anderen Buch zu, das wir ebenfalls eine Zeit lang lesen. Die intellektuelle Motivation, ein Buch lesen zu wollen, ist in diesem Fall nicht kontinuierlich, sondern weist Lücken auf, in denen die Motivation abwesend ist, um sich danach wieder einzustellen. Bachelard ist überzeugt davon, „dass psychische Kontinuität keine Gegebenheit, sondern Arbeit ist“.46
Ich neige dazu, mich Bachelards Meinung anzuschließen. Intuitiv gefällt mir die These von der Diskontinuität besser als die von der Kontinuität, obwohl man sich natürlich fragen muss, ob die Intuition tatsächlich die bessere Ratgeberin ist. Hermsen meint, ja: Gerade dadurch, dass wir den Intellekt überwinden, ist es uns möglich, mithilfe der Intuition zur innerlichen, kontinuierlichen Zeit Verbindung aufzunehmen.
Dass meine Intuition eine andere ist als die Hermsens und dass ich, wenn ich in mein Innerstes hinabsteige, dort eher Diskontinuität vorfinde als Kontinuität, bedeutet noch nicht, dass ich recht habe. Intuitionen sind nicht per definitionem wahr, sie müssen genau wie Gefühle, Gründe und Meinungen auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden. Doch das Problem mit der Intuition besteht darin, dass sie auf eine spezifische Person beschränkt bleibt. Eine Intuition kann man nicht mit anderen teilen, sie in der Diskussion auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre Brauchbarkeit prüfen und wenn nötig verwerfen. Deshalb vertraue ich mehr auf Wahrnehmungen, Gefühle, Worte und Gedanken als auf die Intuition.
Wahrnehmungen zeigen uns eine Vielfalt von Phänomenen, die einen Anfang und ein Ende haben: Konzerte, Romane, Liebesbeziehungen, Hundeleben, Geselligkeit.
Auf emotionaler Ebene erfasst uns Trauer, wenn der Urlaub vorbei, eine Beziehung gescheitert oder das Leben von jemandem, den wir liebten, zu Ende gegangen ist. Wir sind froh, wenn wir das Abitur hinter uns oder die Probezeit unseres neuen Jobs erfolgreich absolviert haben und der Umbau der Küche abgeschlossen ist.
Auch beim Sprechen oder Denken beenden wir Dinge und beginnen mit anderen neu. Jedem „Ja“ stellen wir ein „Nein“ gegenüber, und jedem „Nein“ ein „Ja“, um es mit Bachelard auszudrücken.47 Immer wieder stehen wir vor der Entscheidung, ob wir etwas einstellen oder beenden wollen, um uns danach einer anderen Sache mit einem „Ja“ zuzuwenden.
Wir erfahren ständig, dass unsere Handlungen einen Anfang und ein Ende haben und damit diskontinuierlich sind, dass sie nicht ineinander übergehen und dass wir sie beginnen oder beenden oder gar ganz auf sie verzichten. Das widerspricht Hermsens Intuition, wonach die Zeit ununterbrochen weiterfließt. Ihr von Bergson entlehnter Gedanke, dass nichts verloren geht, ist mit der Dramatik des definitiven Verlusts, des Widerspruchs und der unerwarteten Wendungen unvereinbar. Im Alltagsleben lässt sich die von Verlust, Widerspruch und unerwarteten Wendungen gebildete Diskontinuität einfach nicht leugnen, so gern wir dies täten.
Zwar ließe sich durchaus glaubhaft anführen, dass den wahrgenommenen Diskontinuitäten „in Wirklichkeit“ Kontinuität zugrunde liegt, doch der Verstand sagt einem, dass das, was uns als diskontinuierlich erscheint, tatsächlich der unmittelbare Ausdruck von Diskontinuität ist.48