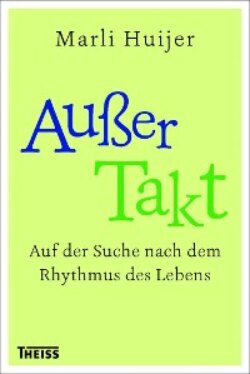Читать книгу Außer Takt - Marli Huijer - Страница 13
Der Begriff der Zeit
ОглавлениеWodurch aber erhält die Zeit ihre Bedeutung? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zuerst begreifen, was Zeit überhaupt ist. Ist sie eine Sache oder ein Begriff? Ist sie etwas, was gegeben ist, oder etwas, was sich die Menschen ausgedacht haben? Befindet sie sich in den Dingen, in unserem Kopf, in unserem Inneren oder ist sie ein Produkt unseres Denkens?
Norbert Elias (1897–1990) erklärt in seinem Essay Über die Zeit,17 dass unser modernes Zeitverständnis das Produkt eines langen Entwicklungsprozesses ist. Zeit ist keine Gegebenheit, sie ist nichts Unabänderliches, das in unseren Köpfen oder Inneren existiert. Sie ist in erster Linie ein Instrument, ein Orientierungsmittel, mit dessen Hilfe Menschen bestimmen, wann sie etwas zu tun beabsichtigen. Dieses Instrument ist nicht von heute auf morgen entstanden, sondern hat eine lange Geschichte durchlaufen. Doch Uhr- und Kalenderzeit sind für uns so selbstverständlich geworden, dass wir das gern vergessen.
Nicht einmal die Tatsache, dass die Zeit vom Früher zum Später verläuft, ist ein unbestreitbarer Fakt. Für uns mag es normal sein, dass die Zeit kontinuierlich von der Vergangenheit in die Gegenwart verläuft, doch für die Bewohner der Urzeiten war das nicht der Fall. Der Bewohner des 21. Jahrhunderts hegt keinerlei Zweifel daran, dass der Mond am Abend wieder am Himmel stehen wird und sich die Mondphasen kontinuierlich ablösen. Doch über dieses Wissen verfügte der primitive Mensch nicht. Er wusste nicht, dass die Himmelssichel mit jener runden Kugel identisch ist, die er zu einem früheren Zeitpunkt am Himmel gesehen hat. Die Gewissheit darüber entstand erst im Laufe einer langen Entwicklung, bei der die Menschen lernten, die Bewegungen des Mondes mit Ereignissen ihrer Umwelt in Verbindung zu bringen.
Auch die Überzeugung, dass der Mond am Abend wieder auftauchen würde, nachdem er am Morgen verschwunden war, entwickelte sich erst im Laufe der Zeit. Es gibt zahlreiche Geschichten, die von der Angst erzählen, dass die Sonne oder der Mond ohne das Zutun des Menschen nicht aufgehen würden. Im französischbrasilianischen Film Orfeo Negro (1959) steigt Orfeo jede Nacht auf den Berg, um mit seinem Gitarrenspiel die Sonne zum Aufgehen zu verführen. Als Orfeo und seine Geliebte während des Karnevals ermordet werden, fürchtet sein kleiner Bruder, dass Rio de Janeiro jetzt dem Untergang geweiht sein würde. Noch im Dunkeln schleicht er sich auf den Berg und spielt die Gitarre, um die Sonne zum Aufgehen zu verlocken.18
Erst in einem langen, sozialevolutionären Prozess verknüpften die Menschen die Veränderungen, die sie beobachteten, miteinander und erkannten in den Sonnen- bzw. Mondauf- und Monduntergängen ein festgelegtes Muster und schließlich die Gesetzmäßigkeit von Jahreszeiten, Monaten, Wochen, Jahren und Stunden. Sie stellten fest, dass der Wechsel von Licht und Dunkel synchron zum Sonnenauf- und Sonnenuntergang verläuft und dass der weibliche Menstruationszyklus so lange dauert wie die Zeit zwischen zwei Vollmonden. Sie erkannten auch, dass die Zeitspanne von einem kürzesten Tag des Jahres zum nächsten ungefähr 365 Tage beträgt und dass die Dauer eines menschlichen Lebens daran bemessen werden kann, wie oft die Tage wieder länger werden.
Die Zeit, so behauptet Elias, ist weder ein Substantiv noch ein Ding oder Sachverhalt, so wenig, wie der „Wind“ an sich existiert. Es gibt nur das Verbum „die Zeit bestimmen“.19 Was den Wind betrifft, so kann man Veränderungen im Luftdruck feststellen und eine Verschiebung der Luftschichten. Aber den „Wind“ als Person oder Sache an sich gibt es nicht.20 Die menschliche Neigung, Verben in Substantive zu verwandeln, egal, ob es sich dabei um Wehen (Wind), Liebhaben (Liebe) oder Zeitbestimmen (Zeit) handelt, lässt uns glauben, dass der Wind, die Liebe oder die Zeit selbstständig existierende Gegenstände oder Sachverhalte sind. Elias nennt diesen Prozess Reifikation. Dabei wird etwas zu einer res, zu einer Sache, gemacht, die es im Grunde gar nicht ist. Hat sich ein Substantiv erst einmal gebildet, sind wir nach kurzer Zeit bereits davon überzeugt, dass die Sache tatsächlich existiert. Wir sagen dann, dass die Zeit verfliegt, dass die Zeit uns durch die Finger rinnt, dass wir Zeit haben, dass die Zeit alle Wunden heilt. Oder wir personifizieren sie sogar, zum Beispiel als „Väterchen Zeit“.
Wenn aber „die Zeit“ überhaupt kein Gegenstand ist, kein „Etwas“, wie können wir dann das Vergehen der Zeit erfahren und dieses Vergehen einmal als schneller und einmal als langsamer empfinden? Langsamer dann, wenn man nach einem geliebten Menschen verlangt, und schneller, wenn ein Abschied näher rückt?
Eigentlich müsste die Frage lauten: Warum erwarten wir, dass die menschliche Empfindung von Zeit so präzise ist wie die Uhr? Wenn Menschen von sich aus genau wissen könnten, wie lange jeder Prozess dauert, dann wäre die Erfindung der Uhr überflüssig gewesen. Dann könnten wir uns auf Basis unseres Zeitempfindens verabreden. Generationen lang genügte es den Menschen, zu sagen: „Ich komme, wenn ich damit fertig bin“, oder: „Bis nach dem Abendessen“, „Bis morgen früh“. Doch das menschliche Zeitempfinden ist kein brauchbarer Maßstab, womit die Dauer einzelner Prozesse festgelegt wird oder die Dauern von verschiedenen Prozessen miteinander verglichen werden können. Deshalb greifen wir lieber auf die Uhrzeit zurück, wie wir ja heute einen Raum auch nicht mehr mit dem ungenauen menschlichen Fuß, dem Daumen oder der Elle ausmessen, sondern mit dem Metermaß. Uhrzeit und Zeitempfinden sind beides Instrumente oder Methoden, mit denen wir Veränderungen, die wir bei uns selbst oder in unserer Umgebung wahrnehmen, miteinander verknüpfen. Die eine Methode mag präziser sein als die andere, aber beide werden eingesetzt, um die Dauer eines Ereignisses oder einer Tätigkeit mit der Dauer eines anderen in Beziehung zu setzen.