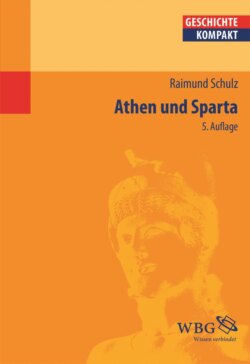Читать книгу Athen und Sparta - Raimund Schulz - Страница 28
6. Athens vergeblicher Griff nach Mittelgriechenland und Ägypten (1. Peloponnesischer Krieg)
ОглавлениеVerträge mit Argos, Thessalien und Megara
Ephialtes hatte vor seinem Tod mit breiter Zustimmung des Demos das Hellenenbündnis kündigen und Verträge mit dem spartanischen Erzfeind Argos und den Thessalern schließen lassen. Kurze Zeit später gelang es den Athenern, das nahe Megara, eines der wichtigsten Mitglieder des Peloponnesischen Bundes, auf ihre Seite zu ziehen. Vorausgegangen war ein Grenzkrieg Megaras mit Korinth, der zweiten Macht auf der Landbrücke zwischen der Peloponnes und Attika. Sparta wollte sich nicht einschalten, und so baten die Megarer Athen um Unterstützung. Athen nutzte die Chance, schloss ein Bündnis, sandte Garnisonstruppen und half den Megarern, ihre Häfen Pegai (am Korinthischen Golf) und Nisaia (am Saronischen Golf) durch lange Mauern mit der Stadt zu verbinden.
Einkreisung Korinths
Thukydides kommentiert diese Maßnahmen mit den viel zitierten Worten: „Dies war auch der Hauptanlass für den bitteren Hass, den die Korinther seitdem gegen Athen hegten“ (1,103). Tatsächlich schien Korinth – nimmt man das athenische Bündnis mit Argos hinzu – von allen Seiten eingeschlossen, während sich Athen ein Sicherheitsglacis gegen Angriffe geschaffen hatte. 459 gingen die Athener daran, auch ihre Häfen Piräus und Phaleron durch (jeweils 7200 und 6300 m) „Lange Mauern“ mit der Stadt zu verbinden und das gesamte Areal zu einer – nach dem damaligen Stand der Kriegstechnik – uneinnehmbaren Festung auszubauen (Thukydides 1,107; 108,3). Danach wandte man sich gegen Aigina, der letzten unabhängigen Polis am Saronischen Golf, die traditionell über starke maritime Kräfte verfügte. Nach einem gescheiterten Versuch, über die Hafenstadt Halieis eine Verbindung nach Argos zu gewinnen, konnten die Athener die Seestreitkräfte Korinths, Aiginas und des Peloponnesischen Bundes besiegen. |17|457/6 wurde Aigina nach langer Belagerung unter harten Bedingungen in den Seebund eingegliedert.
Eine zweite Stoßrichtung richtete sich auf den Korinthischen Golf. 460/59 hatten die aufständischen Heloten in Messene unter der Gewährung freien Abzuges kapituliert. Athen bot ihnen Siedlungsplätze in Naupaktos am Ausgang des Golfes an. Von Naupaktos kontrollierten fortan athenische Kriegsschiffe die Einfahrt in den Korinthischen Golf und die Kornzufuhr nach Korinth. Zusätzlich waren Athener Schiffe in Megaras Hafen Pegai im Ostende des Golfes stationiert. Damit hatte man den gesamten maritimen Raum nördlich der Peloponnes in der Hand.
Flottenfahrt des Tolmides
Gekrönt wurden diese Erfolge im Jahre 456/5 durch die spektakuläre Flottenfahrt des Strategen Tolmides um die Peloponnes nach Nordwestgriechenland. Während dieser Umsegelung zerstörte er das spartanische Flottenarsenal in Gytheion, konnte die korinthische Kolonie Chalkis am Nordufer des Korinthischen Golfes gewinnen und sich mit einem Sieg über das Aufgebot der Sikyoner Respekt verschaffen. Vielleicht integrierte er sogar die vorgelagerten Inseln Kephallenia und Zakynthos in den Seebund (Diodor 11,84,6–8). Es ging auch hier um die Ausschaltung jeder Konkurrenz auf dem Meer – deshalb die Zerstörung des Arsenals in Gytheion – und um die Sicherung des maritimen Einflussgebietes auf Kosten Korinths, der einstigen Beherrscherin des Golfes und der Straße von Otranto.
Tanagra und Oinophyta
Die Spartaner vermieden jede direkte Konfrontation in diesem Bereich und versuchten stattdessen im Norden Attikas ein Gegengewicht gegen die athenische Machtentfaltung aufzubauen (Diodor 10,81,3). 457 marschierte ein Heer des Peloponnesischen Bundes nach Böotien und konnte bei Tanagra einen schwer erkämpften Sieg über die vereinten Truppen der Athener und des Seebundes, der Thessaler und Argiver erringen. Bereits zwei Monate später schlugen die Athener jedoch das böotische Heer bei Oinophyta und stellten ihre Hegemonie in Böotien (mit Ausnahme Thebens) wieder her. Das Jahr 454 bedeutete den Höhepunkt der athenischen Machtentfaltung: Athen kontrollierte den gesamten maritimen Raum von der Ägäis, dem Saronischen Golf, dem Isthmos von Korinth bis zum Malischen Golf im Westen; Thessalien und Böotien waren von Athen abhängig und die Hafen- und Handelsstädte Aigina, Megara und Troizen als Bündner gewonnen oder in den Seebund eingegliedert.
Niederlage im Nildelta
In dieser Situation kam Sparta und seinen Bündnern ein unerwartetes Ereignis zu Hilfe. Ägypten hatte sich Anfang der 460er Jahre von Persien befreien können und Athen um Hilfe gegen eine mögliche persische Revanche gebeten. Athen entsandte daraufhin eine große Flotte, wohl auch um sich den Zugriff auf die ägyptischen Getreideexporte zu sichern. Der persische Gegenschlag führte jedoch im Jahre 454 zum Verlust von über 100 Trieren und 10.000 Mann Besatzung im Nildelta.
Einigung mit Persien (Kalliasfriede)
Diese Niederlage beendete die Erfolgsserie Athens. Aus Sicherheitsgründen wurde 454/3 die Seebundskasse von Delos nach Athen verlegt. Erst 450 konnte der aus dem Exil zurückgekehrte Kimon bei Salamis (auf Zypern) eine persische Flotte von 100 Einheiten versenken, musste diesen Erfolg jedoch mit dem Tod (durch eine Seuche) bezahlen. Mit seinem Dahinscheiden endet die Offensive gegen Persien. Seit 448 beherrschte ein stillschweigender Status quo die außenpolitische Szenerie. Man einigte sich |18|ohne formellen Friedensschluss darauf, dass Athen auf Expeditionen an die persischen Küstengebiete (Ägypten und Zypern) verzichtete und die Perser sich von der Ägäis fern hielten und den Beitritt der kleinasiatischen Städte in den Seebund akzeptierten (so genannter Kalliasfriede). Der Großkönig hatte damit Athen als ostmediterrane Großmacht anerkannt.
Schlacht bei Koroneia
Sparta hatte in der Zwischenzeit durch einen Frieden mit Argos seine Position auf der Peloponnes stärken und drei Jahre später das mittelgriechische Phokis der athenischen Suprematie entreißen können. Wenige Jahre später geriet die athenfreundliche Regierung in Böotien durch einen oligarchischen Staatstreich ins Hintertreffen. Das neue Regiment erklärte Athen den Krieg und konnte ein attisches Heer 447/6 bei Koroneia vernichtend schlagen. Die Herrschaft Athens in Mittelgriechenland brach zusammen und zeigte auch innerhalb des Seebundes Erosionserscheinungen: 446/5 fielen Megara und Euböa vom Seebund ab; lediglich die megarischen Hafenstädte Pegai und Nisaia wurden von athenischen Garnisonen gehalten. Im gleichen Jahr holte Sparta zum entscheidenden Schlag aus und sandte ein Heer unter König Pleistoanax nach Attika. Die Peloponnesier standen nur noch wenige Stunden vor Athen, als es Perikles nach langen Verhandlungen – und Bestechungen – gelang, den spartanischen König zur Rückkehr zu bewegen und mit Sparta einen Frieden auf dreißig Jahre zu schließen. Er wird deshalb auch der „Dreißigjährige Friede“ genannt.
Dreißigjähriger Friede
Der Vertrag enthielt die übliche Nichtangriffsklausel und sah darüber hinaus die Einsetzung eines Schiedsgerichtes zur Schlichtung von Streitfragen vor (Thukydides 7,18,2). Ferner legte er den Status quo, also den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehenden Besitzstand fest (Thukydides 1,140,2). Die Athener mussten lediglich Nisaia, Pagai, Troizen und Achaia auf der Peloponnes herausgeben (Thukydides 1,115), konnten aber die Kontrolle über Naupaktos und Aigina behalten und sich mit Argos verständigen. Eine Auflistung der mit den vertragsschließenden Parteien verbündeten Poleis und Staaten fixierte die Machtbereiche. Es war beiden Parteien verboten, abtrünnige Bündner der Gegenseite aufzunehmen oder zu unterstützen (Thukydides 1,35,2; 40,2; 66). Die bündnisfreien Poleis konnten sich anschließen, „welcher der beiden Mächte sie wollten“ (Thukydides 1, 35).
Dieser Friede bildete die völkerrechtliche Grundlage Griechenlands bis zum Ausbruch des Peloponnesischen Krieges. Beide Seiten konnten ihn als Erfolg verbuchen. Sparta hatte die Machtausdehnung Athens auf Mittelgriechenland gestoppt, Athen hatte die Anerkennung seines Seebundes nicht nur durch Persien (s.S. 17), sondern auch durch Sparta durchgesetzt, denn offizielle Vertragspartner waren „Athen und seine Bundesgenossen“ sowie die „Lakedaimonier (= Spartaner) und ihre Bundesgenossen“.
Neuordnung Griechenlands
Beide Hegemonialmächte hatten aber auch aus den verlustreichen und wechselvollen Kämpfen gelernt: Deutlich ist ihr Bemühen zu erkennen, das Konfliktpotential auf ein Minimum zu reduzieren und die Situation im gesamten griechischen Raum zu regeln. Der Vertrag teilte sämtliche griechischen Poleis in drei Kategorien ein: 1. Athen und seine Verbündeten; 2. Sparta und seine Verbündeten; 3. die neutralen Poleis, die nur freiwillig, d.h. ohne militärischen Zwang, in eines der beiden Bündnissysteme eintreten durften. Diese Friedensordnung erschwerte zwar die Machtausdehnung der Hegemonialmächte außerhalb ihrer Bünde, schützte die Bundesmitglieder |19|vor Übergriffen der Gegenseite und verschaffte den Neutralen Rechtsicherheit; im Gegenzug erhielten jedoch Sparta und Athen größeren Spielraum, um ihren Willen innerhalb ihrer Bündnissysteme zur Geltung zu bringen: Denn abfallbereite Bündner hatten fortan – anders als Thasos im Jahre 464 – keine Hilfe mehr von außen zu erwarten, sondern mussten mit völkerrechtlich sanktionierten Gegenmaßnahmen ihrer jeweiligen Hegemonialmächte rechnen, die sich ganz auf den Ausbau ihrer Stellung innerhalb der Bünde konzentrieren konnten.
Fehler des Friedensvertrages
Dies war der entscheidende Konstruktionsfehler des Friedens: Er war allein aus der machtpolitischen Perspektive Spartas und Athens geschlossen und berücksichtigte in keiner Weise die Interessen der Bundesmitglieder, hielt diese nicht einmal für wert, als Partner mit aufgenommen zu werden; sie waren eine Verfügungsmasse ohne eigene Stimme. Diese Arroganz der Macht sollte sich rächen. Viele Bündner besannen sich auf ihre Stärke und entwickelten als Reaktion auf ihre Nichtberücksichtigung den Gedanken der Autonomie, um ihn später zum politischen Schlagwort zu erheben.