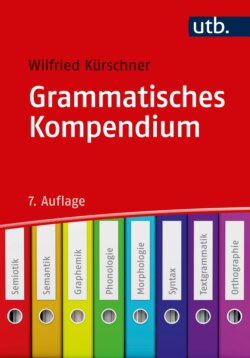Читать книгу Grammatisches Kompendium - Wilfried Kürschner - Страница 12
4 PhonologiePhonologie: Lehre von der LautungLautung 4.1 EinzellauteLautEinzel-Einzellaut
ОглавлениеDie Beschreibung der LautungLautung = der PhoniePhonie erfolgt analog zu der der SchreibungSchreibung = der GraphieGraphie im vorangegangenen Kapitel. War dort BuchstabeBuchstabe der Ausgangsbegriff, so ist es hier der Begriff LautLaut. Und so wie mit BuchstabeBuchstabe in der Alltagssprache unterschiedliche Aspekte der SchreibungSchreibung gemeint sein können und es deshalb günstig ist, diese unterschiedlichen Aspekte auch in der Terminologie auseinanderzuhalten, so gilt dies auch für den alltagssprachlichen Terminus LautLaut.
Es wird daher (parallel zu GraphGraph, GraphemGraphem, AllographAllograph) unterschieden zwischen PhonPhon, PhonemPhonem, AllophonAllophon:
4.1/1 PhonPhone
LautLaute als kleinste Einheiten, in die sich gesprochene Äußerungen zerlegen = Segmentierungsegmentieren lassen; LautvorkommenLautvorkommen, noch ohne Berücksichtigung der Zugehörigkeit des konkreten LautLautes zu einer Klasse gleichwertiger Laute = zu einem PhonemPhonem.
4.1/2 PhonemPhonem
Klasse/Menge von LautLauten = PhonPhonen, die denselben WertWert haben; LauttypTypLaut-Lauttyp.
4.1/3 AllophonAllophone
PhonPhone, die demselben PhonemPhonem angehören; Phone, die untereinander im Verhältnis der SubstitutionSubstitution (▶ Nr. 3.2/5) stehen.
das Phon, des Phons, die Phone
das Phonem, des Phonems, die Phoneme (Betonung auf -ne(m)-)
das AllophonAllophon, des Allophons, die AllophonAllophone (Betonung auf -pho(n)-)
PhonPhone und AllophonAllophone werden in eckigen KlammernKlammereckigeeckige Klammer notiert, PhonemPhoneme zwischen SchrägstrichenSchrägstrich. Zu den dafür verwendeten Symbolen ▶ Tabellen 5 und 6.
Ein PhonemPhonem besteht aus einer Klasse von PhonPhonen, die zueinander nicht in OppositionOpposition stehen (▶ Nr. 3.2/6). Das heißt: Sie können untereinander ausgetauscht werden, ohne dass sich dabei die BedeutungBedeutung des ZeichenZeichens, in dessen AusdrucksseiteAusdrucksseite sie vorkommen, verändert, ohne dass sich also ein anderes Zeichen bzw. ein Nicht-ZeichenZeichenNicht--Nicht-Zeichen ergibt: Die PhonPhone eines PhonemPhonems stehen untereinander im Verhältnis der SubstitutionSubstitution (▶ Nr. 3.2/5). Wenn der AustauschAustausch von PhonPhonen dagegen zu Bedeutungsveränderungen = zu anderen Zeichen oder Nicht-Zeichen führt, gehören diese Phone unterschiedlichen PhonemPhonemen an. Zum Beispiel: Ersetzung/AustauschAustausch eines Zäpfchen-[ü] durch ein Hintergaumen-[Ò] oder ein Zungenspitzen-[r] in einem Wort wie rot, also die Ersetzung von [üo<t] durch [Òo<t] bzw. [ro<t], führt nicht zu einem Wort [Òo<t] bzw. [ro<t], das eine andere BedeutungBedeutung hätte als das Wort [üo<t]; also gehören [ü], [Ò] und [r] ein und demselben PhonemPhonem an, nämlich dem Phonem /r/ (wir könnten statt /r/ auch /ü/ oder /Ò/ oder /17/ oder /¥/ oder sonst etwas schreiben, halten uns aber an die übliche Symbolisierung, ▶ Tabellen 5 und 6). Ersetzt man dagegen das [ü], das [Ò] oder das [r] von [üo<t], [Òo<t] bzw. [ro<t] durch ein [l] oder ein [n], ergeben sich ZeichenZeichen mit anderer BedeutungBedeutung (Lot, Not) bzw. bei der Ersetzung durch ein [m] oder ein [f] Nicht-ZeichenZeichenNicht--Nicht-Zeichen: [mo<t], [fo<t]: [l], [n], [m] und [f] gehören daher anderen PhonemPhonemen an als [ü, Ò, r]. [ü], [Ò] und [r] sind also AllophonAllophone des PhonemPhonems /r/; [1l], [n], [m], [f] sind AllophonAllophone jeweils anderer PhonemPhoneme.
Zum Verhältnis PhonPhon – AllophonAllophon ▶ Nr. 3.2/7.freies Allophon
4.1/4 Freie AllophoneAllophonfreies
AllophonAllophone eines PhonemPhonems, die in denselben LautumgebungenUmgebungLaut-Lautumgebung vorkommen.kombinatorisches Allophon
4.1/5 Kombinatorische AllophoneAllophonkombinatorisches = komplementär distribuierte AllophonAllophonkomplementär distribuierte -ekomplementär distribuierte Allophonee
AllophonAllophone eines PhonemPhonems, die nicht in denselben LautumgebungenUmgebungLaut-Lautumgebung vorkommen.
Beispiele:
Freie Allophonfreies Allophone sind das Zungenspitzen-Zungenspitze[r], das Hintergaumen-[ÒHintergaumen-r] und das Zäpfchen-[ü], die sich in allen Lautumgebungen untereinander austauschen lassen (wenngleich die Sprecher je nach ihrem Sprachgebrauch meist eine dieser Varianten bevorzugen). Dagegen sind [C] (der ich-LautLautich--ich-Laut) und [x] (der ach-LautLautach--ach-Laut) kombinatorische Allophonkombinatorisches Allophone = komplementär distribuierte Allophonekomplementär distribuierte Allophone. Ihr VorkommenVorkommen = ihre VerteilungVerteilung = ihre DistributionDistribution richtet sich nach der Lautumgebung: [C] kommt nach Vokalhellhellen VokalVokalen (ich, echt, spräche usw.) und nach KonsonantKonsonanten (Milch, Kirche usw.) vor, [x] steht dagegen nach dunkel (Vokal)dunklen VokalenVokaldunkel (ach, doch, Tuch usw.). Die AllophonAllophone [C] und [x] sind also komplementär distribuiertDistributionkomplementäre (= sich gegenseitig ergänzend verteilt): In der UmgebungUmgebung, in der [C] erscheint, steht [x] nicht, und umgekehrt steht [C] nicht in der UmgebungUmgebung, in der [x] erscheint.phonologisch distinktives Merkmal
4.1/6 Phonologisch distinktive MerkmaleMerkmalphonologisch distinktives
Phonetische Komponenten, in die sich die AllophonAllophone von PhonemPhonemen zerlegen lassen.
So wie oben (▶ Nr. 3.2/10) AllographAllographe als Bündel von isolierbaren graphischen Komponenten betrachtet wurden, lassen sich AllophonAllophone als Bündel oder Zusammensetzungen von phonetischen Komponenten verstehen. Diese Komponenten lassen sich isolieren, wenn man die Hervorbringung = die Produktion = die ArtikulationArtikulation von LautLauten als Prozess betrachtet, an dem unterschiedliche Faktoren beteiligt sind. Diese Faktoren sind in den beschreibenden Termini und zum Teil in der Symbolik des TranskriptionTranskriptionssystems unten in den ▶ Tabellen 5 und 6 enthalten und werden dort näher erläutert.
Beispiel:
Das AllophonAllophon [b] lässt sich als Bündel der MerkmalMerkmale [explosivexplosiv/Explosiv, bilabialbilabial/Bilabial, stimmhaftstimmhaft] beschreiben. Das MerkmalMerkmal [konsonantischKonsonant] braucht nicht notiert zu werden, da das MerkmalMerkmal [explosivexplosiv/Explosiv] das MerkmalMerkmal [konsonantisch] impliziert (Explosivexplosiv/Explosive = VerschlusslautVerschlusslaute gibt es nur im Bereich der KonsonantKonsonanten, nicht im Bereich der VokalVokale). Merkmale, die durch das Vorhandensein anderer Merkmale impliziert werden, heißen redundantes Merkmalredundante MerkmaleMerkmalredundantes. Merkmale, die zur Beschreibung eines AllophonAllophons notwendig sind, da sie sich nicht aus dem Vorhandensein anderer ergeben, sind relevantes Merkmalrelevante MerkmaleMerkmalrelevantes. So kommt zum Beispiel allen VokalVokalen das MerkmalMerkmal [stimmhaftstimmhaft] zu, doch ist es redundant, da es sich aus dem MerkmalMerkmal [vokalischVokal] ergibt.
»Distinktivdistinktiv« heißen diese MerkmalMerkmaldistinktivesMerkmale, weil auf ihnen die zeichenunterscheidende (= zeichen-distinktivdistinktive) Funktion von AllophonAllophonen bzw. PhonemPhonemen beruht. Zum Beispiel stehen [p] und [b] nicht als Ganze in OppositionOpposition zueinander, sondern lediglich dadurch, dass [p] das MerkmalMerkmal [stimmlosstimmlos] = [−stimmhaftstimmhaft], [b] das MerkmalMerkmal [+stimmhaftstimmhaft] hat, während die übrigen Merkmale, nämlich [explosivexplosiv/Explosiv, bilabialbilabial/Bilabial], beiden gemeinsam sind.
Bezeichnungen für phonologisch distinktives Merkmalphonologisch distinktive Merkmale werden häufig in eckigen KlammernKlammereckigeeckige Klammer notiert; PlusPluszeichen- bzw. MinuszeichenMinuszeichen vor den Merkmalsbezeichnungen geben an, dass das betreffende MerkmalMerkmal vorhanden bzw. nicht vorhanden ist.phonetische Transkription/Umschrift
4.1/7 Phonetische/phonemische TranskriptionTranskriptionphonemischeTranskriptionphonetische = UmschriftUmschriftTranskription
TranskriptionssymboleTranskription finden sich in den ▶ Tabellen 5 und 6. Es wird die Umschrift der International Phonetic Association (= IPAIPA-Transkription) in der Fassung von 1993 verwendet (vgl. Pullum/Ladusaw 1996, S. 293–296, 303–306 und Handbook 1999; die jüngste revidierte Fassung von 2015 findet sich im Internet: <https://www.internationalphoneticassociation.org/ > [Aufruf: 2016-Jun-09]). Die Symbole erscheinen in einer Anordnung, die sich auf die phonetischen Komponenten der Laute = ihre phonologisch distinktiven Merkmaldistinktives MerkmalphonologischMerkmalphonologisch distinktivesphonologisch distinktives Merkmale (▶ Nr. 4.1/6) stützt. Die danach folgende Übersicht enthält für die MinimalpaarbildungMinimalpaar geeignete Beispielwörter. Im Anschluss finden sich zusätzliche IPATranskriptionIPA---SymboleIPA-Transkription für Laute im EnglischenEnglisch und FranzösischenFranzösisch sowie weiteren Sprachen und deutschen »FremdwörternFremdwortVokal«.
Tabelle 5: Transkriptionssymbole – Vokale Konsonant
MonophthongZungenstellungVokalvornvorn (Vokal)VokalneutralneutralVokalVokalzentralzentral (Vokal)Vokalhintenhinten (Vokal)MuskelspannungVokalgespanntgespannt (Vokal)Vokalungespanntungespannt (Vokal)Vokalhochhoch (Vokal)ZungenhöheVokalmittelmittel (Vokal)Vokalgehobengehoben (Vokal)Vokaltieftief (Vokal)Vokalungerundetungerundet (Vokal)Vokalgerundetgerundet (Vokal)LippenformDiphthongKonsonantArtikulationsstelleArtikulationsortArtikulationsartPhonationKonsonantbilabial/Bilabialbilabial/BilabialKonsonantlabiodentallabiodental/LabiodentalKonsonantdental/Dentaldental/DentalKonsonantalveolar/Alveolaralveolar/AlveolarKonsonantpalatal/Palatalpalatal/PalatalKonsonantvelar/Velarvelar/VelarKonsonantuvular/Uvularuvular/UvularKonsonantglottal/Glottalglottal/GlottalKonsonantstimmhaftstimmhaftKonsonantexplosiv/Explosivexplosiv/ExplosivKonsonantstimmlosstimmlosKonsonantfrikativ/Frikativfrikativ/FrikativKonsonantnasal/Nasalnasal/NasalKonsonantlateral/Laterallateral/LateralKonsonantintermittierend/Intermittierenderintermittierend/IntermittierenderKonsonantvibrierend/Vibrantvibrierend/VibrantAkzentHaupt-HauptakzentAkzentNeben-Nebenakzent
È : HauptakzentAkzentHaupt-Hauptakzent (z. B. [È+altŒ], /Èalt«r/)
Ç : NebenakzentAkzentNeben-Nebenakzent (z. B. [ÈmIt«lÇ+altŒ], /ÈmIt«lÇalt«r/)
Tabelle 6: Transkriptionssymbole – Konsonanten und Wortakzent
| IPA- TranskriptionIPA-Transkription | Beispielwörter | ||
| MonophthongeMonophthong: | |||
| /i</ | Biene, liegen | ||
| /I/ | miste | ||
| /y</ | Bühne, lügen | ||
| /Y/ | müsste | ||
| /u</ | Buhne, lugen | ||
| /U/ | musste | ||
| /e</ | beten | ||
| /O</ | böten | ||
| /¿/ | Hölle, röste | ||
| /o</ | boten | ||
| // | Holle, Roste | ||
| /E</ | bäten | ||
| /E/ | helle, Reste | ||
| /«/ | bitte, Kühe | ||
| [Œ] | bitter, Kür | ||
| /a</ | baten | ||
| /a/ | Halle, raste | ||
| DiphthongDiphthonge: | |||
| /aííííe/ | leiten | ||
| /ííO/ | läuten/Leuten | ||
| /aío/ | lauten |
Tabelle 7: VokaleVokal: IPAIPA-Transkription-Symbole,TranskriptionIPA-- Beispielwörter zur MinimalpaarMinimalpaarbildung
| IPA- Transkription | Beispielwörter | ||
| /b/ | Bein | ||
| /p/ | Pein | ||
| /d/ | dir | ||
| /t/ | Tier | ||
| /g/ | Garten | ||
| /k/ | Karten | ||
| [+] | _Arten | ||
| /v/ | Wein | ||
| /f/ | fein | ||
| /z/ | sein, reisen | ||
| /s/ | Masse, reißen, Reis | ||
| /Z/ | Garage | ||
| /S/ | Masche | ||
| /j/ | jein | ||
| /x/ | [C]: | ich | |
| [x]: | ach | ||
| /h/ | hasche | ||
| /m/ | rammen | ||
| /n/ | rannen | ||
| /N/ | rangen | ||
| /l/ | Land | ||
| /r/ | Rand | ||
| [r]: ZungenspitzenZungenspitzen-<i>r</i>rZungenspitzen---r, | |||
| [Ò]: HintergaumenHintergaumen-rrHintergaumen---r, | |||
| [ü]: ZäpfchenZäpfchen-rrZäpfchen---r, | |||
| [Œ]: »verdumpftes« verdumpftes <i>r</i>rverdumpftesr wie in Tier, Hammer |
Tabelle 8: KonsonantenKonsonant : IPA-SymboleTranskriptionIPA-- IPA-Transkription , Beispielwörter zur MinimalpaarbildungMinimalpaar
Die in Tabelle 9 aufgeführten Symbole dienen vor allem zur Wiedergabe von LautLauten des EnglischenEnglisch und FranzösischenFranzösisch. Sie kommen aber auch in weiteren Sprachen und z. T. in deutschen »FremdwörternFremdwort« vor.
VokalVokal e:
| MonophthongMonophthonge: | ||
| [Î<] | engl. Englisch bird | |
| [<] | engl. saw | |
| [e] | engl. bed | |
| [Ã] | engl. but | |
| [Q] | engl. bad | |
| [A<] | engl. far | |
| [ɛ̃] | frz. bienFranzösisch | |
| [œ̃] | frz. un | |
| [A=] | frz. vent | |
| [=] | frz. bon | |
| DiphthongDiphthonge: | ||
| [eI] | engl. game | |
| [I] | engl. boy | |
| [«U] | engl. no | |
| [aI] | engl. time | |
| [aU] | engl. out |
Konsonant Konsonanten:
| [T] | engl. thin (stimmlosstimmloses th) | |
| [D] | engl. the (stimmhaftstimmhaftes th) | |
| [ɹ] | engl. right, write (»englisches r«) | |
| [w] | engl. white | |
| [ç] | frz. nuit [nçi] | |
| [ø] | frz. champagne |
Tabelle 9: Zusätzliche IPA-Symbole
4.1/8 Erläuterungen zu den in Nr. 4.1/7 verwendeten phonetischen Symbolen ▶
Zur schriftlichen Fixierung von PhonPhonen/PhonemPhonemen/AllophonAllophonen sind mehrere Transkriptionssysteme (»UmschriftUmschriften = LautschriftLautschriften«) in Gebrauch. Das bekannteste ist die IPA-TranskriptionIPA-Transkription, auf die wir uns in den Tabellen stützen. Mithilfe der dort verzeichneten Symbole sind nur relativweite Transkription »weite« TranskriptionenTranskriptionweite möglich; das heißt, die Symbole sind nicht geeignet, phonetische Feinheiten wiederzugeben, sondern erlauben nur eine grobe Umschrift. Zum Beispiel wird bei der Umschrift von Tau und Stau, [taío] – [Staío], nicht vermerkt, dass das [t] in Tau BehauchungbehauchtKonsonantbehaucht = aspiriertKonsonantaspiriert ist (diese AspirationAspiration wäre in einer enge Transkription»engeren« TranskriptionTranskriptionengeTranskription so zu markieren: [H]), das [t] in Stau jedoch nicht. Unsere Umschrift vermerkt also phonetisch recht deutlich voneinander unterschiedene AllophonAllophone (wie [t] ohne AspirationAspiration und [tH] mit AspirationAspiration) bis auf wenige Ausnahmen nicht eigens. Die Ausnahmen sind: [C] und [x] als AllophonAllophone des Phonems /x/; [r], [Ò], [ü] und [Œ] als Allophone des PhonemPhonems /r/, [Œ] auch als AllophonAllophon der Phonemkombination /«r/.
Das hier verwendete System eignet sich, wie gesagt, zur groben phonetische Transkription/Umschriftphonetischen (in eckigen KlammernKlammereckige) und zur phonemische Transkription/Umschriftphonemischen UmschriftUmschrift (zwischen SchrägstrichenSchrägstrich). In den ▶ Tabellen 7 und 8 sind die PhonemPhoneme des Deutschen (= das PhoneminventarInventarPhonem-Phoneminventar) zwischen Schrägstrichen jeweils zusammen mit einem Beispielwort in orthographischerOrthographie Form aufgelistet. Zusätzlich sind die gerade genannten AllophonAllophone notiert (und ebenfalls mit Beispielwörtern veranschaulicht). Die Beispielwörter sind so gewählt, dass mit ihrer Hilfe leicht MinimalpaarMinimalpaare zum Nachweis von OppositionOppositionen (▶ Nr. 3.2/8 und 3.2/6) gebildet werden können, um den Phonemstatus der betreffenden Phone nachzuweisen.
Anfangs macht es erfahrungsgemäß gelegentlich Schwierigkeiten, die unterschiedlichen Bereiche, für die gleichförmige Symbole verwendet werden, zu trennen. Das Symbol »x« zum Beispiel steht für: 1. das GraphGraph/AllographAllograph <x> (im Unterschied etwa zu <x> …), 2. das Graphem «x»Graphem (vereinfacht: <x>) (im Unterschied etwa zu «s» (vereinfacht: <s>) …), 3. das PhonPhon/AllophonAllophon [x] (im Unterschied zu [ç]), 4. das PhonemPhonem /x/ (als Zusammenfassung von [C] und [x] und im Unterschied etwa zu /h/ …).
4.1/9 Erläuterungen zu den in ▶Nr. 4.1/7 verwendeten phonetischen Termini
Die Menge der LautLaute wird traditionellerweise in VokalVokale und KonsonantKonsonanten zerlegt. VokalVokale sind dadurch gekennzeichnet, dass der in der LungeLunge erzeugte LuftstromLuftstrom den RachenRachenraum- und MundraumMundraum unbehindert passiert, während er bei der ArtikulationArtikulation von KonsonantKonsonanten ein Hindernis zu überwinden hat.
Vokale
Die verschiedenen VokalVokale = SelbstlautSelbstlautVokalLautSelbst-Selbstlaute ergeben sich
durch unterschiedliche Position der Wölbung des ZungenrückensZungenrücken im Mund in der horizontalen Dimension: ZungenstellungVokalZungenstellungZungenstellungvorn (Vokal): vornVokalvornneutralVokal – neutralVokalneutralzentral (Vokal)Vokalzentral = zentral – hinten (Vokal)hinten;
durch unterschiedliche Position der Wölbung des ZungenrückensZungenrücken in der vertikalen Dimension: ZungenhöheVokalZungenhöheZungenhöhehoch (Vokal): hochVokalhochmittel (Vokal) – mittelVokalmittelgehoben (Vokal) – gehoben – tief (Vokal)tiefVokaltief;
dadurch, dass die LippenLippe bei der ArtikulationArtikulation des VokalVokals unterschiedlich geformt sind: LippenformVokalLippenformgerundet (Vokal): gerundetVokalgerundetungerundet (Vokal) – ungerundetVokalungerundet;
und dadurch, dass die betreffenden VokaleVokal von unterschiedlicher QuantitätVokalQuantitätQuantität sind: lang (Vokal)langVokallangkurz (Vokal) – kurzVokalkurz (im Transkriptionssystem werden LangvokalVokallanglang (Vokal)e durch eine Art DoppelpunktVokalDoppelpunktDoppelpunktVokal nach dem Symbol gekennzeichnet).
Den MerkmalMerkmalen der ZungenhöheZungenhöhehoch (Vokal) [hoch – mittel (Vokal)mittel – gehoben (Vokal)gehoben – tief (Vokal)tief] entsprechen die MerkmalMerkmale [geschlossenVokalgeschlossenVokalgeschlossen – halbgeschlossenVokalhalbgeschlossenhalboffen (Vokal) – halboffenVokalhalboffenoffenVokal – offenVokaloffen] des Winkels, den Ober- und Unterkiefer bilden (KieferwinkelVokalKieferwinkelKieferwinkel).
Bei den hohen,hoch (Vokal) den mittlerenmittel (Vokal) und den gehobenen Vokalen entspricht den beiden unterschiedlichen QuantitätenQuantität (langlang (Vokal) – kurzkurz (Vokal)) ein Unterschied in der MuskelspannungVokalMuskelspannungMuskelspannung, nämlich gespanntVokalgespanntgespannt (Vokal) – ungespanntVokalungespanntungespannt (Vokal).
DiphthongDiphthonge = ZwielautZwielaute = DoppellautDoppellaute werden in einer einheitlichen Bewegung als Kombination zweier VokalVokale artikuliert, während Einzelvokale konstant artikuliert werden, also MonophthongVokalMonophthongMonophthonge = einfache VokaleVokaleinfacheinfacher Vokal = einfache Selbstlaute sind.
Konsonanten
Die MerkmalMerkmale der KonsonantKonsonanten = MitlautLautMit-Mitlaute, wie sie im Transkriptionssystem notiert sind, beziehen sich auf
die ArtikulationsartArtikulationsart,
die ArtikulationsstelleArtikulationsstelle = den ArtikulationsortArtikulationsort,
die PhonationPhonation.
Es werden fünf ArtikulationsartKonsonantArtikulationsartArtikulationsartArtArtikulations-en unterschieden:
Bei ExplosivKonsonantexplosiv/Explosivexplosiv/Explosiven = VerschlusslautKonsonantVerschlusslautVerschlusslautLautVerschluss-en wird die MundMundhöhle- oder RachenhöhleRachenhöhle an einer Stelle verschlossen und ruckartig wieder geöffnet.
FrikativKonsonantfrikativ/Frikativfrikativ/Frikative = SpirantKonsonantSpirantSpiranten = ReibelautKonsonantReibelautReibelautLautReibe-e ergeben sich, wenn an einer Stelle der Mund- oder Rachenhöhle der Luftweg fast ganz verschlossen wird.
Bei der Bildung von NasalKonsonantnasal/Nasalnasal/Nasalen = NasenlautKonsonantNasenlautNasenlautLautNasen-en wird die NasenhöhleNasenhöhle als Resonanzraum benutzt, die Mundhöhle an einer bestimmten Stelle verschlossen.
Bei LateralKonsonantlateral/Laterallateral/Lateralen = SeitenlautKonsonantSeitenlautSeitenlautLautSeiten-en wird die Mundhöhle durch die ZungeZunge teilweise verschlossen, die Luft entweicht seitlich (= laterallateral/Lateral).
Bei IntermittierendeKonsonantintermittierend/Intermittierenderintermittierend/Intermittierendern = Vibrantvibrierend/Vibranten = SchwinglautKonsonantSchwinglautSchwinglautLautSchwing-en = ZitterlautZitterlautKonsonantZitterlautLautZitter-en wird die Mundhöhle durch die ZungenspitzeZungenspitze oder durch das ZäpfchenZäpfchen schnell hintereinander geschlossen und wieder geöffnet (intermittieren = unterbrechen).
Die genannten Hindernisse sind in der Mund- oder Rachenhöhle an unterschiedlichen Stellen lokalisiert, die ArtikulationsstelleArtikulationsstellen = ArtikulationsortArtikulationsorte genannt werden. In ▶ Tabelle 6 werden Laute mit den folgenden Artikulationsstellen aufgeführt:
zwei Gruppen von LabialKonsonantLabial/Labiallabial/Labialen = LippenlautKonsonantLippenlautLautLippen-Lippenlauten: BilabialKonsonantbilabial/Bilabialbilabial/Bilabiale = DoppellippenlautKonsonantDoppellippenlautDoppellippenlautLautDoppellippen-e: Lautbildung von Unter- und Oberlippe (LabiaLabium = LippeLippen, bi = zwei), LabiodentalKonsonantlabiodental/Labiodentallabiodental/Labiodentale = LippenzahnlautKonsonantLippenzahnlautLippenzahnlautLautLippenzahn-e: Lautbildung von Unterlippe und oberen Schneidezähnen (DentesDens, Dentes = ZähneZahn),
DentalKonsonantdental/Dentaldental/Dentale = ZahnlautKonsonantZahnlautZahnlautLautZahn-e: Lautbildung von ZungeZungenspitze und oberen SchneidezähnenZahn,
AlveolarKonsonantalveolar/Alveolaralveolar/Alveolare = ZahndammlautKonsonantZahndammlautZahndammlautLautZahndamm-e: Lautbildung von ZungeZunge und GaumenGaumenrand (AlveoleAlveole = ZahnmuldeZahnmulde im Kiefer),
PalatalKonsonantpalatal/Palatalpalatal/Palatale = VordergaumenlautKonsonantVordergaumenlautVordergaumenlautLautVordergaumen-e: Lautbildung von ZungeZunge und hartem GaumenGaumen (= PalatumPalatum),
VelarKonsonantvelar/Velarvelar/Velare = HintergaumenlautHintergaumenlautLautHintergaumene: Lautbildung von ZungeZunge und weichem GaumenGaumen (= VelumVelum),
UvularKonsonantuvular/Uvularuvular/Uvular = ZäpfchenlautKonsonantZäpfchenlautZäpfchenlautLautZäpfchen-: Lautbildung durch intermittierende Verschlussbildung des ZäpfchenZäpfchens (= UvulaUvula),
GlottalKonsonantglottal/Glottalglottal/Glottale = StimmritzenlautStimmritzenlautLautStimmritzen-e: Lautbildung an der StimmritzeStimmritze (= GlottisGlottis).
Unter PhonationPhonation versteht man den Vorgang der SchallwelleSchallwellenerzeugung durch Unterbrechung des LuftstromLuftstroms durch die im KehlkopfKehlkopf schwingenden StimmbänderStimmband; es ergeben sich
stimmhaftKonsonantstimmhaftstimmhafte (in der Tabelle: »sth.«) LautLaute;
stimmlosKonsonantstimmlosstimmlose (»stl.«) LautLaute ergeben sich dagegen, wenn die Stimmbänder weit geöffnet sind.
(Termini in alphabetischer Reihenfolge: Wortformen – zugehöriges Adjektiv – gebräuchliche dt. Entsprechung):
der Alveolar, des -s, die -e (Betonung auf -la(r)-) – alveolar – Zahndammlaut
der Bilabial, des -s, die -e (Betonung auf -a(l)-) – bilabial – Doppellippenlaut
der Dental, des -s, die -e (Betonung auf -ta(l)-) – dental – Zahnlaut
der Diphthong, des -s, die -e (Betonung auf -thong-, Trennung: Di-phthong oder Diph-thong) – diphthongisch – Doppellaut, Zwielaut
der Explosiv, des -s, die -e od. die ExplosivaExplosiva, der Explosiva, die Explosivä (Betonung auf -si(v)-) – explosivexplosiv/Explosiv – Verschlusslaut
der Frikativfrikativ/Frikativ, des -s, die -e od. das FrikativumFrikativum, des -s, die Frikativa (Betonung auf -ti(v)-) – frikativfrikativ/Frikativ – Reibelaut
der Glottalglottal/Glottal, des -s, die -e (Betonung auf -ta(l)-) – glottalglottal/Glottal – Stimmritzenlaut
der intermittierend/IntermittierenderIntermittierende/ein Intermittierender, des/eines Intermittierenden, die Intermittierenden/Intermittierende (Betonung auf -tie-) – intermittierend – Vibrant, Schwinglaut, Zitterlaut
der KonsonantKonsonant, des -en, die -en (Betonung auf -nan(t)-) – konsonantisch – Mitlaut
der Labiallabial/Labial, des -s, die -e (Betonung auf -bia(l)-) – labiallabial/Labial – Lippenlaut
der Labiodentallabiodental/Labiodental, des -s, die -e od. die LabiodentalisLabiodentalis, der Labiodentalis, die Labiodentales (Betonung auf -ta(l)-) – labiodental – Lippenzahnlaut
der Laterallateral/Lateral, des -s, die -e (Betonung auf -ra(l)-) – lateral – Seitenlaut
der MonophthongMonophthong, des -s, die -e (Betonung auf -thong-, Trennung: Mo-nophthong oder Mo-no-phthong) – monophthongisch – einfacher Vokaleinfacher Vokal/einfacher Selbstlauteinfacher SelbstlautLauteinfacher Selbst-
der Nasalnasal/Nasal, des -s, die -e (Betonung auf -sa(l)-) – nasalnasal/Nasal – Nasenlaut
der Palatalpalatal/Palatal, des -s, die -e od. die PalatalisPalatalis, der Palatalis, die Palatales (Betonung auf -ta(l)-) – palatalpalatal/Palatal – (Vorder-)Gaumenlaut
der SpirantSpirant, des -en, die -en od. die SpiransSpirans, der Spirans, die Spiranten (Betonung auf -ran(t)-) – spirantisch – Reibelaut
der Uvular, des -s, die -e (Betonung auf -la(r)-) – uvular – Halszäpfchenlaut
der Velarvelar/Velar, des -s, die -e (Betonung auf -la(r)-) – velar – (Hinter-)Gaumenlaut
der VibrantVibrant, des -en, die -en (Betonung auf -bran(t)-) – vibrierend – Intermittierender, Schwinglaut, Zitterlaut
der VokalVokal, des -s, die -e (Betonung auf -ka(l)-) – vokalisch – SelbstlautSelbstlautLautSelbst-
AkzentAkzent
▶ Tabelle 6 enthält über die Konsonantensymbole hinaus zwei Symbole, die den WortakzentWortakzent = die WortbetonungWortbetonung bezeichnen. Der hochgestellte Strich, » È «, bezeichnet den HauptakzentHauptakzentAkzentHaupt- und wird vor der Silbe, die den Hauptakzent trägt, notiert. Der tiefgestellte Strich, »Ç«, bezeichnet den NebenakzentNebenakzentAkzentNeben- und steht vor der Silbe, die den Nebenakzent trägt. Unbetonteunbetont Silben bleiben unbezeichnet.
4.1/10 Weitere phonetische bzw. phonologische Termini
Über die gerade genannten Termini hinaus treten in wissenschaftlichen Darstellungen, in Schulgrammatiken, in sprachgeschichtlichen Werken, in fremdsprachlichen Grammatiken und in grammatikgeschichtlichen Darstellungen weitere auf. Sie dienen unter anderem dazu, das Lautinventar unter verschiedenen Gesichtspunkten anders zu gliedern als in ▶ Tabelle 5 und 6.
In der Tradition der antiken griechisch-lateinischen Grammatik werden die KonsonantKonsonanten untergliedert in
MutaMutäKonsonantMuta = StummlautKonsonantStummlautStummlautLautStumm-e und
HalbvokalKonsonantHalbvokalHalbvokal (Konsonant)VokalHalb- (Konsonant)e.
Die Mutä entsprechen den Explosivexplosiv/Explosiven = VerschlusslautVerschlusslautLautVerschluss-en, die Halbvokale den restlichen Konsonanten, d. h. den Frikativfrikativ/Frikativen = SpirantSpiranten = ReibelautReibelautLautReibe-en und den unter der Bezeichnung Liquidliquid/Liquide = FließlautFließlautLautFließ-e zusammengefassten Nasalnasal/Nasalen = NasenlautNasenlautLautNasen-en ([m], [n], [N]), Laterallateral/Lateralen = SeitenlautSeitenlautLautSeiten-en ([l]) und intermittierend/IntermittierenderIntermittierenden = VibrantVibranten = SchwinglautSchwinglautLautSchwing-en ([r], [Ò], [ü]); häufig werden nur die Laterale und die Intermittierenden als Liquide bezeichnet.
Der Terminus HalbvokalHalbvokal (Konsonant)VokalHalb- (Konsonant) bezieht sich in neuerer Zeit abweichend von der älteren Auffassung häufig allein auf die Frikativfrikativ/Frikative [j] und [w] (»englisches w«, wie in white).
Die MutaMutä werden unterteilt in
TenuisTenuesKonsonantTenuis (= stimmlosKonsonantstimmlosstimmloshart (Explosiv)e/»harteKonsonanthart« Explosivexplosiv/Explosive) und
MediaMediäKonsonantMedia (= stimmhaftKonsonantstimmhaftstimmhaftweich (Explosiv)e/»weicheKonsonantweich« Explosivexplosiv/Explosive).
Dieser auf die PhonationPhonation (= Stimmhaftstimmhaftigkeit bzw. Stimmlosstimmlosigkeit) bezogenen Unterteilung entspricht in etwa die Unterscheidung zwischen
FortesFortisKonsonantFortisstarkKonsonant = starkenKonsonantstark Konsonanten und
LenesKonsonantLenisschwachKonsonant = schwachenKonsonantschwach Konsonanten
im Bereich sowohl der Explosivexplosiv/Explosive = VerschlusslautVerschlusslautLautVerschluss-e als auch der Frikativfrikativ/Frikative = SpirantSpiranten = ReibelautReibelautLautReibe-e. Fortes sind mit stärkerem AtemdruckAtemdruck und größerer MuskelspannungMuskelspannung gesprochene Konsonanten, z. B. die stimmlosstimmlosen Explosivexplosiv/Explosive [p, t, k] und stimmlosstimmlose Frikativfrikativ/Frikative wie Lenis[f, s, C], Lenes sind mit schwächerem AtemdruckAtemdruck und geringerer MuskelspannungMuskelspannung gesprochene Konsonanten, z. B. die stimmhaftstimmhaften Explosivexplosiv/Explosive [b, d, g] und stimmhaftstimmhafte Frikativfrikativ/Frikative wie [v, z, j]. Allerdings können FortisFortislaute auch stimmhaftstimmhaft, LenisLenislaute auch stimmlosstimmlos artikuliert werden.
Die MerkmalMerkmale der MuskelspannungMuskelspannunggespannt (Vokal)
gespanntVokalgespanntgespannt (Vokal) und
ungespannt (Vokal)ungespanntVokalungespannt
spielen auch im Bereich der VokalVokale eine Rolle und korrelieren dort mit den MerkmalMerkmalspaaren [etwas VokalgeschlossengeschlossenVokalgeschlossener – etwas VokaloffenoffenVokaloffener] und [Vokallanglang (Vokal)lang – Vokalkurzkurz (Vokal)kurz]. Dies betrifft die hohenVokalhochhoch (Vokal) und die mittleren VokaleVokalmittelmittel (Vokal). So ist z. B. der VokalVokal im Wort Hüte ([y<]) im Vergleich zu dem VokalVokal im Wort Hütte ([Y]) sowohl gespannt (MuskelspannungMuskelspannungVokalgespanntgespannt (Vokal)), hoch (Zungenhöhe)Vokalhochhoch (Vokal) bzw. geschlossener (Kieferwinkel)VokalgeschlossenVokalgeschlossengeschlossenVokal und lang (Vokal)lang (QuantitätQuantität), während ungespannt (Vokal)[Y] ungespannt, ebenfalls hoch, aber etwas tief (Vokal)tiefer/offenVokaloffener und kurz (Vokal)kurz ist. Um diesen mehrfachen Unterschied auch in der Symbolisierung deutlich zu machen, wird in der IPA-UmschriftIPA-Transkription unterschieden zwischen dem Symbol [y] für [gespannt] und VokalgeschlossengeschlossenVokal[geschlossener] und dem Symbol [Y] für Vokalungespannt [ungespannt] und [offenVokaloffener]. Das MerkmalMerkmallang (Vokal)Vokallang [lang] wird durch eine Art DoppelpunktDoppelpunkt ([y<]), das MerkmalMerkmalVokalkurzkurz (Vokal) [kurz] durch Fehlen des Doppelpunktes ([y]) symbolisiert. Dadurch ist es möglich, ein gespannt (Vokal)gespanntes und geschlossenVokalgeschlossenes, aber dennoch kurz (Vokal)kurzes [y] wie in [byÈüo<] (das Akzentzeichen »È« steht vor der betonten SilbeSilbe) oder in [hypoÈte<z«] zu notieren. Entsprechendes gilt für die übrigen hohenhoch (Vokal) und mittleren Vokalemittel (Vokal), während die gehobenengehoben (Vokal) und tiefen Vokaletief (Vokal) ([E<] – [E] bzw. [a<] – [a]) in beiden Quantitäten ungespannt sind.
Weitere Beschreibungstermini für VokalVokale:
Vokale, die mit der ZungenstellungZungenstellung [vornvorn (Vokal)Vokalvorn] artikuliert werden (VorderzungenvokalVokalVorderzungen-Vorderzungenvokale), heißen auch hell (Vokal)Vokalhellhelle Vokale, neutralVokalVokalneutralneutrale = zentrale zentral (Vokal)Vokalzentralund HinterzungenvokalHinterzungenvokaleVokalHinterzungen- heißen auch dunkel (Vokal)dunkle VokaleVokaldunkel.
Die neutralen = zentralen Vokale [«] und[Œ] werden als ReduktionsvokalReduktionsvokalVokalReduktions-Reduktionsvokale bezeichnet. Der mittlere ReduktionsvokalVokal [«] heißt auch MurmelvokalVokalMurmel-Murmelvokal oder Schwa-Laut, kurz SchwaLautSchwa--Schwa-Laut. Der tiefe bis gehobene ReduktionsvokalVokal [Œ] (»verdumpftes rverdumpftes <i>r</i>«) heißt auch TiefTiefschwaschwaLautTiefschwa.
Wenn bei der ArtikulationArtikulation von VokalVokalen der Nasenraum zusätzlich als Resonanzraum verwendet wird, ergeben sich nasalierte = nasaler/nasalierter VokalVokalnasaler/nasalierternasale Vokale (= NasalvokalNasalvokale = nasal/NasalNasale).
Weitere Beschreibungstermini für Konsonanten:
Der vor anlautende VokalVokale tretende glottal/Glottalglottale explosiv/ExplosivExplosivlaut [+] heißt auch Knacklaut = KehlkopflautKehlkopflautKnacklaut = GlottisverschlusslautGlottisverschlusslaut = StimmritzenlautStimmritzenlaut (z. B. [+am +a<b«nt +Es«n +al« +a<l]); zusammen mit dem Knacklaut auftretende Vokale bilden AllophonAllophone des betreffenden Vokals: Die Phone [+a, a] beispielsweise sind AllophonAllophone des PhonemPhonems /a/.
AffrikateAffrikaten: KonsonantenverbindungenKonsonantenverbindung aus einem stimmlosstimmlosen Explosivexplosiv/Explosiv = VerschlusslautVerschlusslaut und einem stimmlosstimmlosen, an derselben oder einer benachbarten ArtikulationsstelleArtikulationsstelle = ArtikulationsortArtikulationsort gebildeten (= homorganhomorganen) Frikativfrikativ/Frikativ = ReibelautReibelaut: [píf], [tís], [tíS].
(Termini in alphabetischer Reihenfolge: Wortformen – ggf. zugehöriges Adjektiv – ggf. gebräuchliche dt. Entsprechung):
die Affrikate/die Affrikata, der Affrikate/der Affrikata, die Affrikaten (Betonung auf -ka(t)-) – affriziertaffriziert
die Fortis, der Fortis, die Fortes (Betonung auf For-) – stark
der Halbvokal, des -s, die -e – halbvokalisch
die Lenis, der Lenis, die Lenes (Betonung auf Le-) – schwachschwachKonsonant
der Liquid, des -s, die -e (Betonung auf -qui(d)-) od. die Liquida, der Liquida, die Liquidä (Betonung jeweils auf Li-) od. Liquiden (Betonung auf -qui-) – liquid – Fließlaut
die Media, der Media, die Mediä/Medien (Betonung auf Me-)
die Muta, der Muta, die Mutä (Betonung auf Mu-) – Stummlaut
das Schwa, des Schwa od. -s, die Schwa od. -s – Murmelvokal
die Tenuis, der Tenuis, die Tenues (Betonung auf Te-)