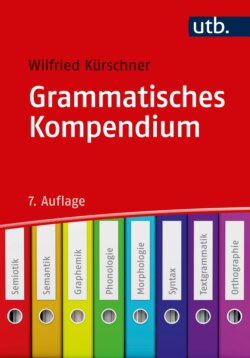Читать книгу Grammatisches Kompendium - Wilfried Kürschner - Страница 4
1 SemiotikSemiotik: Lehre vom Zeichen 1.1 Das sprachliche Zeichen
ОглавлениеEine Sprache kann als ein System angesehen werden, in dem mithilfe von Lauten Bedeutungen zum Ausdruck gebracht werden. Das heißt, es werden ZeichenZeichen gebraucht:
1.1/1 Sprachliche ZeichenZeichensprachlichessprachliches Zeichen
Einheiten, in denen Laute/Lautfolgen bzw. ihre schriftlichen Entsprechungen mit BedeutungBedeutungen = InhaltInhalten verknüpft sind.
Als Zeichen können ganze TextTexte, SätzeSatz, Teile von Sätzen bis hinunter zu WörternWort und MorphemenMorphem betrachtet werden. Die kleinsten, minimalen ZeichenZeichen sind die MorphemMorpheme (▶ Nr. 5.1/1 und Nr. 5.1/3).
Eigenschaften des sprachlichen ZeichenZeichens:
1.1/2 BilateralitätBilateralität = ZweiseitigkeitZweiseitigkeit
Das Vorhandensein zweier Seiten, einer Ausdrucksseite und einer Inhaltsseite, die die konstitutiven Elemente eines Zeichens sind.
1.1/3 AusdrucksseiteAusdrucksseite
LautLaute/LautfolgenLautfolge bzw. deren graphische Entsprechungen (in vielen Sprachen: BuchstabeBuchstabeBuchstaben/BuchstabenfolgenBuchstabenfolge), die zum AusdruckAusdruck (Zeichen) der entsprechenden InhaltsseiteInhaltsseite dienen.
1.1/4 InhaltsseiteInhaltsseite
InhaltInhalte = BedeutungBedeutungen, die mit der AusdrucksseiteAusdrucksseite eines sprachlichen ZeichenZeichensprachlichessprachliches Zeichens verknüpft sind.
Für die Termini »AusdrucksseiteAusdrucksseite« und »InhaltsseiteInhaltsseite« sind auch die in ▶ Tabelle 1 dargestellten Alternativen gebräuchlich:
| AusdrucksseiteAusdrucksseite | InhaltsseiteInhaltsseite |
| SignifiantSignifiant | SignifiéSignifié |
| BezeichnendesBezeichnendes | BezeichnetesBezeichnetes |
| AusdruckAusdruck (Zeichen) | InhaltInhalt |
| FormForm | BedeutungBedeutung |
| SignalSignal | InformationInformation |
Tabelle 1: Alternative Termini für »Ausdrucksseite« – »Inhaltsseite«
Die Termini »Bedeutung«Bedeutung und »Inhalt«Inhalt werden im Folgenden gleichbedeutend verwendet, mit »Zeichen« ist stets ‘sprachliches Zeichen’Zeichensprachliches gemeint.
1.1/5 ArbitraritätArbitrarität = BeliebigkeitBeliebigkeit
WillkürlichkeitWillkürlichkeit der Zuordnung von Inhalts- und AusdrucksseiteAusdrucksseite im ZeichenZeichen.
Beispiel:
Der stets gleiche InhaltInhalt ‘4’ ist im Deutschen mit dem AusdruckAusdruck (Zeichen) [fi<Œ] bzw. <vier>, im Englischen mit dem AusdruckAusdruck (Zeichen) [f<] bzw. <four>, im Französischen mit [katü] bzw. <quatre> und in anderen Sprachen mit nochmals anderen AusdrucksseiteAusdrucksseiten verknüpft (zwischen einfachen = halben AnführungszeichenAnführungszeichenhalbes-Anführungszeicheneinfaches-Anführungszeichen wird die Bedeutung, zwischen eckigen Klammerneckige KlammerKlammereckige die AusdrucksseiteAusdrucksseite in der LautungLautung, zwischen spitzen Klammernspitze KlammerKlammerspitzespitze Klammer die AusdrucksseiteAusdrucksseite in der SchreibungSchreibung wiedergegeben – ▶ Nr. 2.2/2, Nr. 3.2/7 und Nr. 4.1/3). Dies zeigt, dass die Zuordnung der beiden Zeichenseiten zueinander zwar konventionellkonventionell-einzelsprachlich festliegt, nicht aber »naturnotwendig«, sondern vielmehr arbiträrarbiträr = beliebigbeliebig = willkürlichwillkürlich ist: Keine Eigenschaft der InhaltsseiteInhaltsseite verlangt [fi<Œ] oder [f<] als AusdrucksseiteAusdrucksseite, umgekehrt weist kein MerkmalMerkmal dieser Ausdrücke darauf hin, dass mit ihnen die InhaltsseiteInhaltsseite ‘4’ verknüpft ist. – Ausdrücke aus Kombinationen von AusdrucksseiteAusdrucksseiten wie [fIütse<n] <vierzehn> bzw. [f<ti<n] <fourteen> sind dagegen nicht völlig arbiträr, sondern teilmotiviertmotiviertteil-teilmotiviert, insofern sie zur InhaltsseiteInhaltsseite ‘14 (= 4 + 10 bzw. 10 + 4)’ hin »durchsichtigdurchsichtig« sind. Die einzelnen Bestandteile dieser Komplexe sind jedoch für sich genommen arbiträr.
1.1/6 LinearitätLinearität
Zeitliche bzw. räumliche Aufeinanderfolge sprachlicher ZeichenZeichen und ihrer Ausdruckselemente im SyntagmaSyntagma (▶ Nr. 1.1/8).
Im KommunikationsprozessKommunikationsprozess, in der ParoleParole (▶ Nr. 1.2/3), werden die sprachlichen ZeichenZeichen in gesprochener SpracheSprachegesprochenegesprochene Sprache zeitlich, in geschriebener SpracheSprachegeschriebenegeschriebene Sprache räumlich nacheinander angeordnet, sie folgen einander gewissermaßen (wie die BuchstabeBuchstaben in einer Zeile) auf einer Linie. Dies betrifft sowohl die an der Bildung einer RedeketteRedekette beteiligten jeweiligen ZeichenZeichen als Ganze wie auch die Elemente ihrer AusdrucksseiteAusdrucksseiten, die LautLaute bzw. BuchstabeBuchstaben, die nicht zugleich, sondern nacheinander produziert werden.
Beziehungen zwischen sprachlichen ZeichenZeichen:
1.1/7 Syntagmatische BeziehungBeziehungsyntagmatischesyntagmatische Beziehung
Beziehung, die zwischen mindestens zwei ZeichenZeichen herrscht, die miteinander in der RedeketteRedekette verknüpft werden.
Beispiel:
In der Kette die Leiter an der Wand stehen die ZeichenZeichen die und Leiter und an und der und Wand in syntagmatischer Beziehung zueinander. Solche Zeichenverbindungen bilden SyntagmaSyntagmen:
1.1/8 SyntagmaSyntagma
Geregelte Verbindung von mindestens zwei ZeichenZeichen.
Nicht jede Aneinanderreihung sprachlicher ZeichenZeichen stellt ein SyntagmaSyntagma dar, z. B.: *an der die Leiter Wand. Der Aufbau von SyntagmenSyntagma gehorcht vielmehr Regeln, die in der SyntaxSyntax (▶ Kapitel 7) beschrieben werden.
Ein SternchenSternchen = Asterisk(us)Asterisk(us): »*«, das/der vor sprachliche Formen gesetzt wird, zeigt an, dass diese nicht regelgerecht gebaut, sondern ungrammatisch, unzulässig (in der historischen Sprachwissenschaft: nicht in Texten belegt) sind.
das SyntagmaSyntagma, des SyntagmaSyntagmas, die Syntagmen od. SyntagmaSyntagmata (Betonung auf -tag-)
1.1/9 Paradigmatische BeziehungBeziehungparadigmatischeparadigmatische Beziehung
Beziehung, die zwischen mindestens zwei ZeichenZeichen herrscht, die gegeneinander ausgetauscht werden können.
Beispiel:
In dem SyntagmaSyntagma die Leiter an der Wand könnte statt des Zeichens die das ZeichenZeichen eine, statt Leiter das ZeichenZeichen Uhr oder Zeichnung usw., statt an das ZeichenZeichen auf oder hinter oder über usw., statt der das ZeichenZeichen einer oder mancher oder dieser oder jener usw. gewählt werden. Es ergäben sich dann jeweils neue SyntagmaSyntagmen.
ZeichenZeichen, die sich gegenseitig ersetzen lassen, bilden ein Paradigma:
1.1/10 ParadigmaParadigma
Menge/Klasse von ZeichenZeichen, die gegeneinander ausgetauscht werden können.
Über diesen engeren, nur die Austauschbarkeit von ZeichenZeichen als Ganzen betreffenden Paradigmenbegriff hinaus gibt es eine weiter greifende Auffassung von »Paradigma«Paradigma sowie die klassische Auffassung (Paradigma = FlexionsformFormFlexions-Flexionsformen eines Wortes bzw. FlexionsmusterMusterFlexions-Flexionsmuster, ▶ Nr. 6.1/7). Nach der weiteren Auffassung stehen nicht nur ZeichenZeichen, wie bei der vorangehenden Nr. 1.1/9 beschrieben, in paradigmatische Beziehungparadigmatischer Beziehung zueinander, sondern auch die Glieder von WortfamilieWortfamilien wie binden, Band, Binde, Gebinde, Bund, bündeln, bündig, Binder, bei denen keine durchgängige gegenseitige Ersetzbarkeit an einer bestimmten Position eines SyntagmaSyntagmas vorliegt (z. B. können die Verben binden und bündeln nicht das Adjektiv bündig, dieses nicht die Substantive Band, Binde, Gebinde, Bund, Binder ersetzen).
Darüber hinaus können auch Elemente von Zeichenausdrucksseiten, nämlich LautLaute (bzw. BuchstabeBuchstaben), in paradigmatischer Beziehungparadigmatische Beziehung zueinander stehen. So bildet etwa die Menge aller LautLaute, die im AnlautAnlaut, im InlautInlaut oder im AuslautAuslaut von Wörtern vorkommen bzw. dort nicht vorkommen können, jeweils ein ParadigmaParadigma (z. B. können im AnlautAnlaut deutscher Wörter alle LautLaute stehen, nur nicht die LautLaute [N] (wie in eng), [x] (wie in ach) und [s] (wie in heiß), im InlautInlaut können alle LautLaute stehen, nur nicht der LautLaut [h] (wie in halt) usw.).
das Paradigma, des Paradigmas, die Paradigmen od. Paradigmata (Betonung auf -dig-)