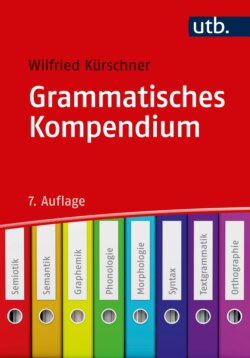Читать книгу Grammatisches Kompendium - Wilfried Kürschner - Страница 14
4.3 LautentwicklungLautentwicklungen in der deutschen Sprachgeschichte
ОглавлениеDie folgenden Termini bezeichnen LautwandelWandelLaut-Lautwandelvorgänge, die sich in der Geschichte der deutschen Sprache seit dem Althochdeutschen abgespielt haben und die nicht nur einzelne Wörter betrafen, sondern regelhaft gewirkt haben. In Anlehnung an Scherer (1890, S. 10–14) teilen wir die deutsche Sprachgeschichte samt ihren germanischen Vorstufen folgendermaßen ein:
| RömerzeitRömerzeit: | 150 v. Chr. – 150 n. Chr. |
| Gotische Zeitgotische Zeit: | 150–450 |
| MerowingerzeitMerowingerzeit: | 450–750 |
| AlthochdeutschAlthochdeutsch (Ahd.): | 750–1050 |
| MittelhochdeutschMittelhochdeutsch (Mhd.): | 1050–1350 |
| FrühneuhochdeutschFrühneuhochdeutsch (Frühnhd.): | 1350–1650 |
| NeuhochdeutschNeuhochdeutsch (Nhd.): | seit 1650 |
Im AlthochdeutschAlthochdeutschen und beim Übergang zum MittelhochdeutschMittelhochdeutschen:
4.3/1 PrimärumlautUmlautPrimär-Primärumlaut
Ersetzung von [a] durch [E] vor [I], [i<] oder [j] in der unmittelbar folgenden SilbeSilbe.
Beispiele:
WortformWortformen wie ahdAlthochdeutsch. kraft (‘Kraft’, SingularSingular) – krefti (‘Kräfte’, PluralPlural), gast (‘Gast’) – gesti (‘Gäste’) und viele weitere zeigen, dass in AllomorphAllomorphen ein und desselben MorphemMorphems (▶ Nr. 5.1/4) die Kurzvokalkurz (Vokal)Vokalkurzkurz (Vokal)e [a] und [E] miteinander wechseln. Dabei erscheint [E] als UmlautUmlaut von [a] in einer WortformWortform immer dann, wenn in der unmittelbar folgenden SilbeSilbe der betreffenden WortformWortform einer der LautLaute [I], [i<] oder [j] steht. Wenn das [a] vor den LautverbindungenVerbindungLaut-Lautverbindung [xs], [xt], [rv] (geschrieben: <hs>, <ht>, <rw>) steht, findet trotz [I, i<, j] in der Folgesilbe kein UmlautUmlaut statt = [a] wird nicht umgelautet, z. B. [maxt] <maht> – [maxtI] <mahti> (‘Macht’, ‘Mächte’).
4.3/2 SekundärumlautUmlautSekundär-Sekundärumlaut
UmlautUmlaut von [a] zu [E], und zwar 1. auch vor den den PrimärumlautUmlautPrimär-Primärumlaut verhindernden KonsonantenverbindungenVerbindungKonsonanten-Konsonantenverbindung [xs], [xt], [rv] und 2. in dem Fall, dass [I, i<, j] erst in der zweitfolgenden SilbeSilbe stehen. Im weiteren Sinn: Ersetzung des langen VokalVokals [a<] durch [E<] und der dunkel (Vokal)dunklen Vokale = HinterzungenvokalVokalHinterzungen-Hinterzungenvokale durch die entsprechenden gerundet (Vokal)gerundeten hell (Vokal)hellen = vorderen VokalVokalvordererVokale = VorderzungenvokalVokalVorderzungen-Vorderzungenvokale vor [I, i<, j].
Beispiele:
SekundärumlautSekundärumlaut im engeren Sinn: 1. ahdAlthochdeutsch. mahtîg [maxt-] – mhdMittelhochdeutsch. mähtec [mECt-], 2. ahdAlthochdeutsch. faterlîh [fatEr-] – mhdMittelhochdeutsch. veterlich [fEt«r-]; SekundärumlautSekundärumlaut im weiteren Sinn: Ersetzung von [a<] durch [E<]: ahdAlthochdeutsch. mâri – mhdMittelhochdeutsch. mære ‘Erzählung’; von [U] durch [Y]: ahdAlthochdeutsch. turi – mhdMittelhochdeutsch. türe; von [u<] durch [y<]: ahdAlthochdeutsch. sûri – mhdMittelhochdeutsch. siure [sy<r«] ‘Säure’; von [o<] durch [O<]: ahdAlthochdeutsch. skôni – mhdMittelhochdeutsch. schœne; von [uío] durch [YíE]: ahdAlthochdeutsch. guoti – mhdMittelhochdeutsch. güete; von [oíu] durch [Oíu]: ahdAlthochdeutsch. (h)loufit – mhdMittelhochdeutsch. löufet ‘läuft’.
4.3/3 AbschwächungAbschwächung von unbetonten EndsilbenvokalEndsilbenSilbeEnd-- und MittelsilbenvokalSilbeMittel-Mittelsilbenvokalen
Ersetzung von »vollen« VokalenVokalvoll durch [«] (den Schwa-LautLautSchwa--Schwa-Laut = MurmelvokalVokalMurmel-Murmelvokal).
Beispiele:
geben: ahdAlthochdeutsch. geban [a] – mhdMittelhochdeutsch. geben [«], loben: ahdAlthochdeutsch. lobôn [o<] – mhdMittelhochdeutsch. loben, waren: ahdAlthochdeutsch. wârûn [u<] – mhdMittelhochdeutsch. wâren, Ende: ahdAlthochdeutsch. enti [i] – mhdMittelhochdeutsch. ende, lobte: ahdAlthochdeutsch. lobôta – mhdMittelhochdeutsch. lobete.
Im MittelhochdeutschMittelhochdeutschen:
4.3/4 AuslautverhärtungAuslautverhärtung
Ersetzung der stimmhaftKonsonantstimmhaften Explosivexplosiv/Explosive = Verschlusslaute (= MedienMedia) [b], [d], [g] durch die ihnen entsprechenden stimmlosstimmlosKonsonantstimmlosen Explosivexplosiv/Explosive = Verschlusslaute (= TenuisKonsonantTenuisTenues) [p], [t], [k] und der FrikativKonsonantfrikativ/Frikative = SpirantSpiranten = ReibelautKonsonantReibelaute [h], [v] (LenesLenisKonsonantLenis) durch die FortesFortisKonsonantFortis-Frikativfrikativ/FrikativKonsonantfrikativ/Frikative [x] und [f] im WortauslautAuslaut und vor stimmlosstimmlosen KonsonantKonsonantstimmlosen.
Beispiele:
Leib: lîb- [li<b] (z. B. in lîb-es) – lîp [li<p], Neid: nîd- [ni<d] – nît [ni<t], Tag: tag- [tag] – tac [tak]; sah: sah [sah] – sach [sax].
Beim Übergang vom MittelhochdeutschMittelhochdeutschen zum FrühneuhochdeutschFrühneuhochdeutschen/NeuhochdeutschNeuhochdeutschen:
4.3/5 NeuhochdeutschNeuhochdeutsche DiphthongierungDiphthongierung
Ersetzung der mhdMittelhochdeutschhoch (Vokal)Vokalhoch. hohen LangvokalVokallanglang (Vokal)e [i<], [y<], [u<] durch die DiphthongDiphthonge [aíe], [íO], [aío].
In den Wörtern der Beispiel-MerkhilfeMerkhilfeDiphthongierungDiphthongierungMerkhilfe mîn niuwez hûs [mi<n ny<v«s hu<s] und der nhd. Entsprechung mein neues Haus [maíen níO«s haíos] sind die betroffenen VokalVokale enthalten.
4.3/6 NeuhochdeutscheNeuhochdeutsch MonophthongierungMonophthongierung
Ersetzung der mhdMittelhochdeutsch. DiphthongDiphthonge [ií«], [uí], [yí«] durch die MonophthongMonophthonge [i<], [u<], [y<].
Beispiel-MerkhilfeMerkhilfeMonophthongierungMonophthongierungMerkhilfe:
mhdMittelhochdeutsch. liebe guote brüeder [lií«b« guít« bryí«d«r] – nhd. liebe gute Brüder [li<b« gu<t« büy<dŒ].
4.3/7 NeuhochdeutschNeuhochdeutsche DiphthongsenkungDiphthongsenkung
Ersetzung der mhdMittelhochdeutsch. DiphthongDiphthonge [eíi], [oííu], [Oíu] durch die DiphthongDiphthonge [aíe], [aío], [íO].
Beispiele:
mhdMittelhochdeutsch. bein [beíin] mit [eíi] etwa wie in englisch game – nhd. Bein [baíen]; mhdMittelhochdeutsch. boum [boíum] mit [oííu] etwa wie in engl. home – nhdNeuhochdeutsch. Baum [baíom]; mhdMittelhochdeutsch. böume [bOíum«] – nhd. Bäume [bíOm«].
4.3/8 NeuhochdeutschNeuhochdeutsche DehnungDehnungVokalDehnung in offenTonsilbeoffener TonsilbeSilbeTon-TonsilbeoffenSilbe
Ersetzung mhdMittelhochdeutsch. Kurzvokalkurz (Vokal)Vokalkurzkurz (Vokal)e durch die ihnen jeweils entsprechenden LangvokalVokallanglang (Vokal)e, wenn sie am Ende einer betontenbetontSilbeSilbebetonteSilbeoffene offenen Silbe (▶ Nr. 4.2/1) stehen.
Beispiele:
mhdMittelhochdeutsch. leben [lE|b«n] (der StrichStrichSilbengrenze kennzeichnet die SilbengrenzeSilbengrenzeSilbeSilbengrenze) – nhd. leben [le<|b«n]; mhdMittelhochdeutsch. tages [ta|g«s] – nhdNeuhochdeutsch. Tages [ta<|g«s]. Die DehnungDehnung unterbleibt in einigen UmgebungenUmgebung.
Hinweis: Der Terminus »Dehnung« ist mit anderer Bedeutung auch in der Orthographie gebräuchlich (»Kennzeichnung eines gedehnten = langen Vokals«, ▶ Nr. 9.3/11).