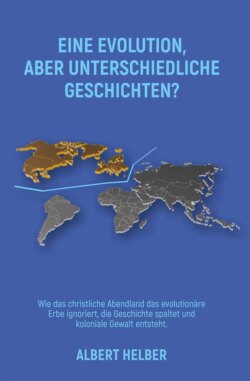Читать книгу EINE EVOLUTION, ABER UNTERSCHIEDLICHE GESCHICHTEN? - Albert Helber - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Menschliche Linie ist nur rückwärts deutbar.
ОглавлениеEvolution ist ein Geschehen ohne Ziel und gleiches gilt auch für die mentale Evolution. Evolution ist, wie alle Entwicklungen, nur im Rückblick erklärbar. Je näher aber die evolutionären Epochen an unsere Gegenwart heranreichen, um so mehr entdeckt die historische Wissenschaft Befunde, die helfen eine Entwicklung zu deuten. Seit Aufkommen des heutigen Menschen existiert der Wunsch, die menschliche Herkunft zu erfahren. Mit dem Aufkommen der Evolutionstheorie durch Charles Darwin ist die Anthropologie zu einer modernen Wissenschaft geworden und hat die Suche nach Herkunft und Wesen des Menschen übernommen. Unterschiedliche Blickrichtungen und Spezifizierungen der Anthropologie liefern Befunde, mit denen man erklärt, wie sich die Entwicklung zum Menschen gestaltet haben könnte.
Die anthropologische Archäologie findet Fundstücke, deren zeitliche Zuordnung zu Stammbäumen der menschlichen Entwicklung führt und Übergänge zur menschlichen Linie erkennbar werden. Aus Schädelumfang und Schädelinnenraum wird auf die Größe des Gehirns geschlossen und mit Vorfahren verglichen. Ein größer werdendes Gehirn wird gleichgesetzt mit einem Zugewinn an Intelligenz. Die Entwicklung des Gebisses offenbart veränderte Essgewohnheiten. Eine S-förmige Wirbelsäule ist Indiz für einen aufrechten Gang. Mit archäologischen Befunden gelingen erste Rückschlüsse auf das Verhalten von Tier und Mensch, zumal mentale Fähigkeiten der Archäologie verborgen bleiben. Vor ca. 2 bis 4 Millionen Jahren erreicht die Differenzierung zwischen der Reihe nichtmenschlicher Primaten und der menschlichen Linie einen Grad, in welchem erste mentale- oder psychologische Einflüsse die Entwicklung zum Menschen mitbestimmen: Der Hominide ist kein Baumbewohner mehr. Er bevorzugt die Savanne und versammelt sich im Schatten von Akazien. Das Leben wird zu einem Gruppenleben, in welchem ein mental gelenktes Miteinander wichtiger ist als individuelles Reagieren. Ein Ardipithecus ramidus oder „Bodenaffe“ richtet den Blick seiner Gruppe auf den Boden, wo sie Pflanzen, Beeren, Früchte, Knollen oder im Boden lebende Kleintiere sammeln. Mit dem Griff zwischen Daumen und Zeigefinger wird das Sammeln am Boden möglich. Das Gebiss der Savannenbewohner wird vom Greif- zum Kauwerkzeug. Backenzähne entstehen im kleiner werdenden Gebiss. Auch wird der bisherige „Fressapparat“ von Maul und Gebiss in eine zusätzliche Apparatur der Lautbildung und der Sprache verändert. Diese frühen Australopithecinen oder frühen Hominiden haben in Relation zum Körpergewicht ein bereits größer werdendes Gehirn. Der Umbau zum aufrecht gehenden Läufer und dessen neue Funktionen lassen das Gehirn wachsen.
—
Wohin der Weg des Menschen führen wird versuchen Verhaltensforscher mit dem Verhalten nichtmenschlicher Primaten zu antizipieren und deren Intelligenz mit dem Verhalten indigener Menschengruppen zu vergleichen. Man vergleicht die Intelligenz nicht menschlicher Primaten mit der des Menschen und prüft, was von Menschenaffen in die menschliche Linie übernommen wurde. Die Beobachtungen von Dian Fossey8, von J. Goodall oder Frans de Waal7,24, von Robin Dunbar9, von R. Seyfarth und D. Cheney12 und vielen anderen Verhaltensforschern, die jetzt nicht alle genannt sind, lassen in den Reihen nichtmenschlicher Primaten vom Orang Utan, über Gorillas, Schimpansen und Bonobos Verhaltenstendenzen erkennen, die sich in der menschlichen Linie fortsetzen:
° Primaten entwickeln sich von einem im Wald und auf den Bäumen lebenden Einzelgänger wie dem Orang Utang zu in der Savanne lebenden sozialen Wesen, welche zuerst als Familie zusammen leben wie die Gorillas und schließlich Gruppen aus mehreren Familien bilden wie Schimpansen und Bonobos.
° Die Gruppengröße und die verwandtschaftliche Heterogenität nimmt von den Orang Utangs über Gorillas, Schimpansen und Bonobos zu. Aus familiärer Identität und verwandtschaftlicher Heterogenität wird schließlich eine Gruppenidentität, bei Bonobos sogar die eigene Gruppe übergreifende Identität.
° Die geschlechtliche Differenzierung zwischen Männern und Frauen nimmt von den Orang Utangs, über Gorillas, Schimpansen und Bonobos bis hin zum Menschen ab.
° Innerhalb der größer werdenden Gruppen reduzieren sich hierarchische Strukturen. Die Gruppen werden egalitärer und durchlässiger.
Diese Verhaltensformen nichtmenschlicher Primaten offenbaren Entwicklungstendenzen, die Auswirkungen auf die Hominiden haben werden. Neben gruppenspezifischen Verhaltensweisen beschreiben Verhaltensforscher an ihren Primaten mentale Äußerungen, die später das menschliche Verhalten mitbestimmen können: Menschenaffen zeigen Eigennutz, Machtgehabe, Aggressivität und Unterwürfigkeit. Sie suchen Verbündete und schaffen Verlierer. Sie ahmen nach, zeigen Emotionen und handeln altruistisch. „Nichts von dem, was wir tun ist wahrhaftig einzigartig“, schreibt Frans de Waal7,24. Diese oft anekdotisch berichteten Eigenschaften offenbaren eine mentale Vielfalt, die sich in allen Primaten- oder menschlichen Gruppen oder Gemeinschaften findet. Einige Eigenschaften werden sich durchsetzen, werden von der Gemeinschaft übernommen und bestimmen schließlich das Gruppenverhalten und andere werden verloren gehen. Die Arbeitsgruppe um Robin Dunbar beschreibt bei Klein- und Menschenaffen eine enge Beziehung zwischen der mittleren Gruppengröße unterschiedlicher Primaten und der relativen Größenzunahme ihres Neocortexes zum Gesamthirn. „Der Stachel des sozialen Lebens“ stimuliert das Wachstum des Großhirns. „Der Evolutionsdruck, der bei den Primaten für die Selektion großer Gehirne und hoher Intelligenz sorgt, hat offenbar mit der Notwendigkeit zu tun, große Gruppen zusammen zu halten“, schreibt Robin Dunbar9. Die mit seinem Namen verbundene „Dunbar number“ offenbart eine Beziehung zwischen Gruppengröße und Neocortex-Entfaltung der nichtmenschlichen Primaten. Auf das menschliche Gehirn extrapoliert, würde eine auf persönlichen Zusammenhalt ausgerichtete menschliche Gruppe etwa 150 Personen umfassen.
Die Zahl der Individuen, die eine Gruppe bilden, ist kein Grund für Hirnwachstum. Das Gehirn wächst, wenn neue Funktionen geschaffen werden, die einem biologischen Akteur in einem gegebenen Umfeld die Chance des Überlebens bieten. Das Leben in der Gruppe macht neue Funktionen notwendig. Schon in der Linie der nichtmenschlichen Primaten werden, ausgehend vom Einzelgänger Orang Utan und deren Nachfolgern Gorillas, Schimpansen und Bonobos, die Gruppen immer größer. Bei Gorillas ist die Gruppe meist noch ein großer- und genetisch verwandter Familienverband. Bei Schimpansen und Bonobos bilden bereits mehrere Familien eine Gruppe und dieser Trend wird sich in der menschlichen Linie fortsetzen. Alle von den nichtmenschlichen Primaten ausgehenden Tendenzen lassen eine größer werdende-, über Familienbande hinaus führende Gruppenbildung erkennen.
Geschlechtliche Differenzierung und Hierarchie werden in einer größer werdenden Gruppe geringer. Männer und Frauen arbeiten in der Gruppe zusammen und eine genetisch gelenkte familiäre Bindung wird von einer emotionalen Bindekraft ergänzt. Diese Tendenzen der nichtmenschlichen Primatenreihe werden sich bei den aufrecht gehenden Hominiden fortsetzen und deren Verhalten bestimmen. Die „soziale Komplexität“ einer Gruppe erfordert neue Formen des Zusammenhalts und emotionale Intelligenz wird diesen Zusammenhalt lenken. Soziale Komplexität steigt, wenn genetische- oder verwandtschaftliche Bande nicht mehr die Gruppe stabilisieren. Genetische- oder familiäre Verwandtschaft innerhalb einer größer werdenden Gruppe aus mehreren Familien führt zu unterschiedlichen Interessen, erschwert den Umgang miteinander und lässt Streit und Zwietracht entstehen. Neue Möglichkeiten des Zusammenhalts einer Gruppe müssen entstehen:
Ein neuer- und emotionaler Umgang miteinander muss in einer größer werdenden Gruppe das Zusammenleben optimieren. In der Gruppe wird deren Weiterexistenz zu einer Sorge um den Nachwuchs und „kooperative Aufzucht“ hilft. Bei keiner biologischen Art ist der Nachwuchs so sehr auf die Hilfe der Eltern oder anderer Personen angewiesen wie beim Menschen. Denn: Der Mensch wird als „physiologische Frühgeburt“ geboren, schreibt der Basler Zoologe Adolf Portman. Die Kinder der Säugetiere stellen sich, erst noch unsicher, nach wenigen Stunden auf ihre Beine, laufen weg und suchen das Euter der Mutter. Sie kommen mit einer Reife in die Welt, die sie zu frühen Selbstversorgern macht. Bei nichtmenschlichen Primaten beginnt eine erste Veränderung: Ihr Nachwuchs braucht in den ersten Wochen und Monaten eine intensive Versorgung durch die Mutter und führt zu einer über Jahre anhaltenden Bindung an die Mutter und in eine Abhängigkeit von der Mutter. Bei nichtmenschlichen Primaten wird diese Abhängigkeit hormonell gelenkt. Kinder können oft nicht überleben, wenn die Mutter umkommt oder getötet wird. Im Gegensatz zu höheren Säugetieren ist der Mensch zum Zeitpunkt seiner Geburt hilflos und auf Totalversorgung angewiesen. Er muss über 1 bis 2 Jahre Entwicklungsprozesse nach vollziehen, welche die meisten Tiere schon intrauterin erwerben.
Wie nicht selten in der biologischen Evolution wird der gegenüber Säugetieren vermeintliche Nachteil einer „physiologischen Frühgeburt“ schließlich zu einem Entwicklungsprivileg: Der noch unausgereifte Entwicklungsprozess des Menschen zum Zeitpunkt seiner Geburt wird im sozio-kulturellen Umfeld der Familie durch emotionale- und physische Kontakte formbar. Das Kind lernt sich anzupassen und wird früh zum Mitspieler im gegebenen Umfeld seiner Familie. Nie lernen die Menschen durch Imitation und Prägung so konzentriert, wie in den ersten beiden Lebensjahren. Das Kind braucht die Versorgung durch die Mutter und die Gruppe braucht für ihre Weiterexistenz den Nachwuchs. Die Gruppe muss den Nachwuchs versorgen, wenn der Mutter etwas zustößt.
Wozu wir heute den Kindergarten oder die Kita benutzen, dafür erfinden die Hominiden eine „kooperative Aufzucht“. Die Voraussetzungen dafür finden sich bereits bei den nichtmenschlichen Primaten: Von der Verhaltensforschung werden an nichtmenschlichen Primaten regelmäßig den Zusammenhalt fördernde Attribute oder Eigenschaften beobachtet: Beschrieben werden „social grooming“, Versöhnungsrituale, gegenseitiges Verstehen und Empathie bis hin zu Hilfeleistungen, wenn jemand in Gefahr gerät. Aufbauend auf diesen Erfahrungen der Verhaltensforscher an nichtmenschlichen Primaten entwickelt die Ethnologin Sarah Bluffer Hrdy eine Theorie der anthropologischen Evolution. In ihrem Buch „Mütter und Andere“ beschreibt sie „Wie die Evolution uns zu sozialen Wesen gemacht hat“25. Für Hrdy sind „vertieftes intentionales Verstehen“, sind Empathie und das Bestreben Andere zu verstehen Eigenschaften nichtmenschlicher Primaten, die vor etwa 2 Millionen Jahren von den Hominiden übernommen- und intensiviert werden. Sie werden zum Beginn einer „kooperativen Aufzucht“ der gefährdeten und physiologisch früh geborenen Kinder. „Kooperative Aufzucht“ oder „alloelterliche Versorgung“ der Kinder, so die Autorin, führen zur Abgrenzung der Hominiden aus der Reihe der Primaten und erklären die erfolgreiche Linie zum Homo erectus und später zum Homo sapiens. „Im Falle der frühen Hominiden schufen alloelterliche Fürsorge und Ernährung die Voraussetzungen dafür, dass sich Kleinkinder in neuer Weise entwickeln konnten“. Eine die Mutter ergänzende alloelterliche Fürsorge durch Großeltern, durch Geschwister oder durch weitere Mitglieder der Gruppe sichern das Überleben eines Kindes, auch wenn die Mutter nicht mehr da ist. Die Alloeltern versorgen die Kinder mit eiweißreicher Nahrung. Kinder müssen sich mit mehreren Erziehern auseinandersetzen und intensivieren ihre Emotionen oder Gefühle. Kooperative Aufzucht setzt das Lernen durch Nachahmung von Vorbildern fort, initiiert ein soziales Lernen und erklärt das Hirnwachstum und eine stürmische Entwicklung der Hominidenreihe. Hrdy`s Theorie stützt sich auf drei Beobachtungen: „Kooperative Aufzucht“ wird möglich durch eine emotionale Bindung zu unterschiedlichen Versorgern und überwindet den engen körperlichen Kontakt der Schimpansenkinder an ihre Mutter. Emotionale Bindung an mehrere Versorger erweitert den emotionalen Umgang und fördert den Zusammenhalt der Gruppe. Schließlich offenbaren auch ethnologische Befunde an indigenen Jäger- und Sammlergruppen eine intensive Mitbeteiligung von Vätern, Geschwistern, Großeltern und Clanmitgliedern in der Aufzucht von Kindern. Kinder werden oft schon nach der Geburt in der gesamten Gruppe herumgereicht, gelegentlich von einer nicht mütterlichen Brust ernährt oder von Großmutter und Tante mit vorgekauter Nahrung versorgt. Wie wichtig Kinder in indigenen Gruppen sind beschreibt E.H. Erikson in „Kindheit und Gesellschaft“26 mit seinen Beobachtungen bei den Sioux: Die Sioux vertreten, „dass ein Kind solange es klein ist ein Individualist sein darf“. „Man kennt bei ihnen keine Verurteilung infantiler Gewohnheiten“. Die Sioux-Erziehung „bringt das Gefühl hervor, in der Welt zu Hause zu sein“. Und ein afrikanisches Sprichwort lautet: „An der Erziehung eines Kindes ist ein ganzes Dorf beteiligt“.
—
Wie die Arbeit mit nichtmenschlichen Primaten Verhaltensformen offenbart, die sich bei den Hominiden fortsetzen und erweitern, hat die Neurophysiologie im letzten Jahrhundert Befunde erhoben, in welchen man Entwicklungstendenzen vom nichtmenschlichen Primaten zur Entwicklungslinie der Hominiden erkennen kann. 1950 beschreibt der kanadische Neurologe Wilde Penfield im Gyrus postcentralis des Gehirns durch elektrische Reizung Regionen, in welchen er Bewegungen in bestimmten Körperorganen oder Körperstellen auslösen kann. Penfield ist Epilepsieforscher und sucht nach einer Therapiefähigkeit für Epilepsie. Er verfolgt genau, welche Bewegungen er im menschlichen Körper auslösen kann, wenn er an unterschiedlichen Stellen des Gyrus postcentralis stimuliert. Er beschreibt mit diesen elektrischen Reizungen eine funktionale Architektur im motorischen Gyrus postcentralis, in welcher die Körperproportionen einen motorischen „Homunculus“ ergeben, mit großem Kopf, mit großem Gesicht und noch größerer Mund- und Kieferregion. Der Homunculus offenbart als zweite Besonderheit eine große Hand mit kräftigen Fingern und noch größerem Daumen.
Großer Kopf und große Hand sitzen auf einem schmächtigen Körper und kleinen Beinen und Füßen.
Bald nach Penfields Ergebnissen wird auch der sensorische Gyrus präcentralis untersucht und ergibt wiederum einen sensorischen Homunculus, in welchem jene Regionen unseres Körpers hervortreten, die sensorisch von besonderer Wichtigkeit sind. Zuerst offenbart sich das kosmologische Gesetz von Reiz und Reaktion in unserem Gehirn als anatomisches Gegenüber: Sinnliche Wahrnehmungen werden in dem der Sehrinde des Occipitalhirns zugewandten sensorischen Gyrus präcentralis bearbeitet. Sie werden im motorischen- und dem Frontalhirn zugewandten Gyrus postcentralis beantwortet. Reiz und Reaktion, Sinnliche Wahrnehmungen und motorische Antworten sind in unserem Gehirn anatomisch hintereinander geschaltet. Noch deutlicher offenbart der sensorische- und motorische Homunculus welche Funktionen in der Entwicklung zum Menschen auftauchten und wichtig wurden: Aus den Vorderbeinen der nichtmenschlichen Primaten wird in der sensorischen- und motorischen Repräsentation im Gehirn des Menschen eine große Hand mit langen Fingern und noch größerem Daumen. Die Feinmotorik des Greifens, des späteren Malens und Schreibens braucht eine umfangreiche Organisation des Gehirns. Allein beim Schreiben werden ca. 58 Muskeln benutzt. V.a. aber ist der Homunculus ein „Kopfmensch“, er ist ein den Kopf betonender Homunculus, weil Sehen, Mimik und Laut- oder Sprachfunktion beim Menschen zu wichtigen Funktionen werden und sowohl in der sensorischen- und der motorischen Rinde umfangreich vertreten sind. Die zum Lautapparat des Menschen gehörende Zunge besteht allein aus 9 unterschiedlichen Muskeln. Die menschliche Mimik beteiligt Stirn, Augen, Nase und Mund und wird von ca. 25 Muskeln und deren Zusammenspiel organisiert. Beim Lachen, so lese ich, werden im Gesicht 20 Muskeln und im restlichen Körper nochmals 80 Muskeln aktiviert. Ob wir glücklich oder traurig sind, ob wir lachen oder weinen, immer sind es eine riesige Zahl von Muskeln, deren Zusammenspiel in unserem Gehirn organisiert werden muss.
In der Zwischenzeit sind ähnliche Homunculi auch von unterschiedlichen Tieren erstellt worden. Sie zeigen, dass bei nichtmenschlichen Primaten bereits das Gesicht und die Mimik eine wichtige Rolle spielen. Beim Menschen kommt der Lautapparat und die Sprache dazu, demonstriert durch die Zunge auch in der menschlichen Linie. und nochmals die Greiffunktion und die Feinbeweglichkeit der Finger, demonstriert durch den übergroßen Greifarm mit den Fingern. Was wichtig werden sollte für den Menschen demonstrieren die Homunculi, indem herausgestellt wird, welche körperlichen Regionen des Menschen die umfangreichste neuronale Versorgung genießen.
—
Das Gehirn reflektiert nicht nur das biologische Gesetz von „Irritation und Reaktion“ als sensorisches Zentrum im Gyrus postzentralis und als motorisches Zentrum im Gyrus präzentralis. Es offenbart auch im cerebralen „Homunculus“ jene Organe, die für die menschliche Entwicklung wichtig werden sollten. Vor allem aber ist das Gehirn eine Lernmaschine, für die der Hirnforscher Calvin den Namen „Darwin-Maschine“27 schuf. Die von Charles Darwin beschriebene Evolution folgt einem Prinzip der Selektion: Darwins Evolution ist ein dialektischer Prozess zwischen Veränderung durch Mutation und Anpassung oder Ablehnung in einem gegebenen Umfeld. Selektiert werden jene Veränderungen, die sich in ein gegebenes Umfeld einfügen können. Tatsächlich arbeitet unser Gehirn nach einem ähnlichen Prinzip, indem es in Millisekunden jene Aufforderung selektiert, die unter vielen Möglichkeiten, am besten auf sinnliche Wahrnehmungen reagiert und einem biologischen Akteur Nutzen bringt. Schon wenige Jahre nach Darwins „On the origin of species“ stellt sich der amerikanische Psychologe William James diese Fragezit.n.27. Heute vertreten zahlreiche Neurobiologen diese Theorie der Selektion auch für das menschliche Gehirn und William H. Calvin prägt den Begriff „Darwin-Maschine Gehirn“. Voraussetzung eines selektiv arbeitenden Systems ist eine Vielzahl an Angeboten, aus welchen eines unter Berücksichtigung vieler ganz unterschiedlicher Angebote selektiert wird. Das menschliche Gehirn beschäftigt sich mit vielen Einflüssen. Sie machen eine Selektion nicht nur möglich, sondern notwendig.