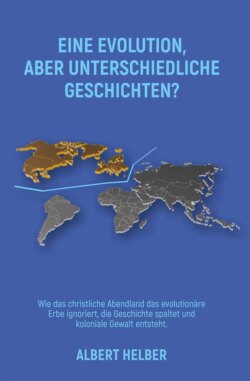Читать книгу EINE EVOLUTION, ABER UNTERSCHIEDLICHE GESCHICHTEN? - Albert Helber - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Wie Lernen funktioniert.
ОглавлениеSchon eine Selektion auslösende Sinneseindrücke sind unterschiedlich. Wir sehen nicht nur, wir hören auch, wir riechen, schmecken und fühlen. Wir haben Erinnerungen und Erfahrungen, haben Können und Wissen, Emotionen und Verstand oder Wünsche und Hoffnungen. Diese ganz unterschiedlichen Einflüsse werden in unserem Gehirn schließlich in eine Reaktion, in eine Aktion verarbeitet, mit der wir auf sinnliche Wahrnehmungen reagieren. Reaktionen oder Aktionen sind wiederum unter permanenter Kontrolle durch unseren Körper oder unser Befinden und auch unter der Kontrolle durch Umfeld und Mitmensch. Ja, das Gehirn arbeitet selektiv, ist ein unvorstellbar schnell arbeitendes Lerninstrument, das nach dem Prinzip von „trial and error“ jene Möglichkeit auswählt, mit welcher im Augenblick auf sensorische Irritationen, beeinflusst durch Erfahrungen und Erinnerungen, durch Wissen, durch Wünsche und Hoffnungen, im Sinne eines biologischen Akteurs reagiert wird.
Bevor sinnliche Wahrnehmungen zu Emotionen, zu Gefühlen oder Intentionen verarbeitet werden, muss die Existenz eines Geschöpfes und dessen Wandlung gesichert werden: Ein fortwährender interner Austausch von „Irritation und Reaktion“ sorgt für funktionale und körperliche Stabilität eines biologischen Geschöpfes und auch für Veränderungen, die sein Überleben nicht beeinträchtigen dürfen. Durch dieses „körperliche Lernen“ oder „Körper zentriertes Lernen“ entsteht in ca. 6 bis 12 Millionen Jahren aus einem nichtmenschlichen Primaten ein aufrecht gehender Hominide. Der Mensch entsteht durch ein „Körper zentriertes Lernen“. Unsere durch körperliches Lernen entwickelte Lernmaschine Gehirn wird dieses interne Lernen schließlich in eine neuronale Verarbeitung sensorischer Wahrnehmungen ausweiten und daraus eine Mentalentwicklung des Menschen einleiten.
—
Wer sich zum Lernen entscheidet muss aus Neugier eine Aufmerksamkeit werden lassen. Neugier ist in der biologischen Welt eine früh auftauchende Funktion. Wahrnehmungen von Tieren bedeuten Gefahr oder geben Hinweise für den Nahrungserwerb. Diese Funktion der Neugier bleibt wichtig, doch ist sie sprunghaft und auch ablenkbar. Wer aber Lernen will und für sich bleibende Erfahrungen schaffen möchte, muss selektieren, muss sich mit Aufmerksamkeit an jenen Eindrücken orientieren, die von bleibendem Wert- und für sein Überleben wichtig sind. Mit der Verwandlung eines vierbeinigen- in einen zweifüßigen- und aufrecht gehenden Greifer ist offenbar das Umfeld zu einer neuen Herausforderung geworden. Sinnesorgane liefern unterschiedliche Eindrücke, die gespeichert und erinnert werden und mit neuen Eindrücken verglichen und neuronal verarbeitet werden. Gedächtnis ist in neuronalen Strukturen angelegt und ist eine Voraussetzung des Lernens 28. „Aufmerksamkeit ist das Tor zum Gedächtnis“ schreibt der Hirnphysiologe Calvin. Im wachsenden Gehirn sind der Thalamus, Teile des Parietalhirns und der Hippocampus für jene Aufmerksamkeit verantwortlich, die in der Nachbarschaft von Zentren für sensorische Wahrnehmungen Eindrücke als Gedächtnis speichern. Wir dürfen annehmen, dass mit dem Aufkommen der Hominiden in einem wachsenden Gehirn dieser Übergang von einer nicht selektierenden Neugier in eine vom Bewusstsein gelenkte selektierende Aufmerksamkeit stattfindet und das neue Lernen ermöglicht. Warum Aufmerksamkeit und Lernen die Hominiden schließlich zu jenem den Menschen charakterisierenden emotionalen Lernen führen, wissen wir nicht, zumal wir von allen evolutionären Anfängen kein Wissen haben. In jedem Falle aber muss der eingeschlagene Weg des Lernens das Überleben der Hominiden möglich gemacht haben. Aufmerksamkeit und die dafür verantwortlichen Strukturen im menschlichen Gehirn müssen im Übergangsbereich zu den Hominiden entstanden sein und schenkten den Hominiden eine neue Fähigkeit desLernens.
—
Die Wichtigkeit des Gehirns als selektierendes- und lernendes Instrument offenbart sich bereits bei Säugetieren und Primaten. Es wird auf dem Weg zum Menschen an Größe und Bedeutung gewinnen. Selektieren und Lernen ist offenbar ein Stimulans des Hirnwachstums, denn das Gehirn wird mit den Funktionen wachsen, die aus einem Menschenaffen einen Australopithecus und aus frühen Hominiden einen Homo sapiens machen. Wir werden zu erklären haben, wie aus einer evolutionär entwickelten Lernfähigkeit eine mentale Intelligenz durch Lernen werden konnte. Dass „Lernfähigkeit“ schon bei nicht-menschlichen Primaten gegeben ist, hat der Primatologe Rumbaugh bewiesen29: Er untersucht an 121 Tieren aus zwölf Affengattungen deren Reaktion auf Aufgabenwechsel und deren Konzentrations-fähigkeit. Als Maß der Lernfähigkeit beschreibt er einen „Transfer-Index“ und korreliert diesen mit dem Hirngewicht der Tiere in Relation zum Körpergewicht. Je größer die Lernfähigkeit der Tiere, umso größer war ihr Gehirn. Auch die intrauterine- und extrauterine Entwicklunszeit der Säugetiere korreliert mit der Hirngröße. Je länger die Entwicklungs-zeit, umso größer das Gehirn. Eine lange Entwicklungszeit ist eine Lernzeit. Der Hominide wird das assoziative Lernen nichtmenschlicher Primaten übernehmen und weiter entwickeln. Wohin die lernende Entwicklung den frühen Hominiden führen wird, werden wir an weltweit verstreuten-, von modernen Einflüssen noch wenig belasteten indigenen Gruppen beobachten können30.
Was erlernt wird ist in der biologischen Welt und auch beim Menschen immer ein Zusammenspiel von „Irritation und Reaktion“. Dieses kosmische Gesetz lenkt jegliches Handeln, Fühlen und Denken des Menschen. Nach diesem Gesetz führen sensorische Wahrnehmungen zu Reaktionen. Sensorische Wahrnehmungen und sensorische Intelligenz entscheiden, ob „phobisch“ oder „topisch“ reagiert wird. Beides muss erlernt werden. Sensorische Wahrnehmungen sind zunächst eine Funktion der Sinnesorgane, deren physiko-chemische Eindrücke beim Tier und auch beim Menschen zu mehr oder weniger direkten Aktionen führen. Diese direkten Aktionen sind Triebe oder Instinkte, welche der Mensch von seinen tierischen Vorfahren übernimmt und welche auch zu den mentalen Funktionen gehören, die menschliches Verhalten mitbestimmen. Sensorische Intelligenz entsteht aber v.a. dann, wenn Sinnesorgane ihre Wahrnehmungen an ein neuronales Netzwerk oder an das Gehirn weiterleiten, Sinneseindrücke dort neuronal bearbeitet und dann erst als Reaktion oder Aktion beantwortet werden. Eine doppelte Bearbeitung von Sinneswahrnehmungen durch Sinnesorgane und durch ein neuronales Netzwerk führt bei Primaten und v.a. beim Menschen zu einem Gehirn, das bis zum Homo neanderthalensis an Größe zunimmt und beim Homo sapiens wieder an Größe abnimmt. Schon in den 6 - 12 Millionen Jahren der Verwandlung nichtmenschlicher Primaten in einen aufrecht gehenden Australopithecus nimmt die Hirngröße in Relation zum Körpergewicht zu. Offenbar wird schon in dieser Zeit das Gehirn der zum Menschen führenden Vormenschen mit neuen Aufgaben konfrontiert. Mit dem Aufkommen von Hominiden vor 2 - 3 Millionen Jahre braucht der jetzt aufrecht gehende-, greifende- und in größeren Gruppen lebende Hominide wiederum neue und v.a. variable Antworten, um bestehen zu können. Aus der neuronalen Beantwortung von Sinneseindrücken wird schließlich eine mentale Intelligenz des Menschen durch variables antworten.
—
Lernfähigkeit entsteht im Gehirn durch ein Zusammenspiel von physiko-chemischen Abläufen in den Neuronen, durch eine Verbindung von Neuronen zu neuronalen Netzwerken oder neuronalen Bahnen und schließlich durch ein Zusammenspiel von Hirnstamm und cerebralem Cortex und deren Vermittlung durch ein Zwischenhirn über neuronale Reize, über Hormone und Modulatoren. Im menschlichen Gehirn sind drei strukturelle Ebenen zu unterscheiden. Sie sind in der biologischen Entwicklung nacheinander entstanden, arbeiten zusammen und bewirken gemeinsam eine Lernfähigkeit. Die evolutionär jüngste Struktur ist das thalamo-corticale System und bildet ein dreidimensionales Geflecht aus neuronalen Netzen oder Schaltkreisen, in welchen sensorische Wahrnehmungen bearbeitet und in eine Reaktion oder Aktion verwandelt werden. Die evolutionär älteste Struktur des Gehirns ist der Hirnstamm aus Basalganglien, aus Kleinhirn und Hippocampus, welcher das Großhirn über zentrifugale- oder zentripetale Bahnen mit der Peripherie verbindet und mit der „Zeitmaschine“ Kleinhirn für ein zeitlich adäquates Zusammenspiel von Stimulation und Hemmung sorgt. Zwischen Hirnrinde und Hirnstamm befinden sich in subcortikalen Kernen, im Hypothalamus, im basalen Vorderhirn und in den Amygdala Strukturen des Zwischenhirns, die sowohl neuronale Botschaften an den Körper, aber auch an den cerebralen Cortex geben. Sie produzieren Substanzen, die über die Hypophyse zu Hormonproduzenten werden, aber auch neuromodulatorisch wirksame chemische Reize an den Thalamus und an die Hirnrinde senden, wo schließlich das menschliche Bewusstsein entsteht.
Innerhalb der Hirnrinde reflektieren die Neuronen oder Nervenzellen das bereits angesprochene kosmologische Gesetz von „Reiz und Reaktion“. Der menschliche cerebrale Cortex hat mit etwa 110 Milliarden die höchste Neuronenzahl aller bei Tier und Mensch untersuchten Gehirne und jedes Neuron betreibt zahlreiche Synapsen. Unterschieden werden sensorische-, intermediäre- und motorische Neuronen. Sensorische Neurone nehmen die von Sinnesorganen eingehenden Reize auf und motorische Neuronen geben die Antwort. In allen Gehirnen ist die Zahl der intermediären Neurone höher als die Zahl der sensorischen- oder motorischen Neurone, doch sind sie im menschlichen Gehirn besonders stark vertreten: In Rattengehirnen ist das Verhältnis sensorischer- zu intermediären Neuronen etwa 1:20, im menschlichen Gehirn ist ihr Verhältnis 1: 20 00031. In den intermediären Neuronen werden sinnliche Wahrnehmungen mit Erinnerungen, mit Gefühlen oder Gedanken verglichen und so eine neue Antwort erarbeitet. Neue Gefühle und Gedanken entstehen, die sich wiederum an sinnlichen Wahrnehmungen, am Umfeld oder am Mitmenschen orientieren. Andererseits entwickelt der Mensch auch Phantasien und Illusionen, die keinen Bezug zu sinnlichen Erfahrungen haben, weltabgewandte Abstraktionen sind und zu Ideologien oder Religionen werden. Diese Abstraktionen, Ideologien oder Religionen sind wohl das Produkt intermediärer Neurone, welche einen Bezug zu sensorischen Neuronen eingebüßt haben.
—
Tierische- und menschliche Lernfähigkeit entsteht im Gehirn durch ein „implizites Kurzzeitgedächtnis“ als Voraussetzung des Lernens. Einzelne Neurone oder neuronale Verbindungen können gebahnt werden und unterschiedlich schnell ihren Informationsauftrag erfüllen. Wie Lernen funktioniert entnehme ich Eric Kandels Buch „Suche nach dem Gedächtnis“28. Für die bahnbrechenden Untersuchungen seiner Arbeitsgruppe erhielt Eric Kandel im Jahre 2000 den Nobelpreis für Physiologie. Kandel unterscheidet ein in der biologischen Evolution früh entstandenes-, primäres- oder „implizites Gedächtnis“ oder Kurzzeitgedächtnis, von einem evolutionär jüngeren-, sekundären- oder „explizitem Langzeitgedächtnis“. Erinnern, eine Funktion des „impliziten Kurzzeitgedächtnisses“ ist für Kandel eine Voraussetzung des Lernens. V.a. aber ist dieses implizite Kurzzeitgedächtnis eine strukturelle Eigenschaft aller neuronalen Verbindungen oder Netzwerke. Wo immer Synapsen Neurone verbinden kann deren Funktion gestärkt oder geschwächt-, stimuliert oder inhibiert werden. Eine in allen Neuronen gleiche Übertragung würde kein Gedächtnis schaffen und auch kein Lernen ermöglichen. Erst die Bereitstellung von aktivierenden Substanzen an der Synapse, von modulierenden Transmittern oder elektrischen Reizen und unterschiedliches Verhalten von Rezeptoren schafft neuronale Netze, die selektiv begehbar werden und eventuelle Reize entweder schnell oder langsam verarbeiten. Schnelle Netze führen zur Bahnung von Aktivitäten, zu Assoziationen und Automatismen, zu funktionalen Algorithmen. Sie entstehen bei Wiederholungen und beim Üben. Wer lernt und übt, wird jene neuronalen Bahnen aktivieren, deren schnelles Zusammenwirken Assoziationen und Automatismen schafft, die schließlich den Lernerfolg bestimmen. Mit biophysikalisch wirksamen Strukturen werden in unserem Zentralnervensystem Zusammenhänge erarbeitet, die etwas Neues an Stelle des bisher Gegebenen erschaffen. Das Neue ist etwas Erlerntes und ist durch ein „implizites Gedächtnis“, durch unterschiedliche Aktivitäten in unseren neuronalen Netzen durch assoziierendes Bahnen entstanden.
Die Bahnung neuronaler Netze lenkt das motorische Lernen des Menschen. Wer Bewegungen übt, induziert in den für diese Bewegung zuständigen neuronalen Netzen anatomische Veränderungen. Synapsen werden prominenter und neue Netze entstehen. Es sind mikroskopisch nachweisbare, erworbene Eigenschaften, die aber genetisch nicht übertragbar sind. Die von Kandel beschriebenen neuronalen und das Lernen ermöglichenden Strukturen wurden auf dem langen Weg der Evolution erschaffen. Im Genom wurde festgelegt, welche Funktionen der Anpassung an das Umfeld genügen. Im Genom wird entschieden, wie wir zu aufrechten Menschen werden. Wozu die Evolution 6-12 Millionen Jahre benötigte, schaffen wir durch Übung und Lernen in etwa einem Jahr, weil wir die von der Evolution entwickelte Lernfähigkeit benutzen können. Zum Zeitpunkt unserer Geburt sind die Voraussetzungen für eine Anpassung ans Umfeld noch nicht gegeben. Wir müssen erst noch lernen auf zwei Beinen zu gehen. Die von der Evolution geschaffene „motorische Intelligenz“ des Lernens hilft uns, durch regelmäßiges Versuchen und Üben jenen Automatismus zu erwerben, der uns schließlich aufrechte Stabilität verleiht: Jede Muskelaktion arbeitet nach dem Prinzip der „reziproken Hemmung“. Jede Muskelaktion der Strecker erfordert eine zeitlich präzise Inaktivierung der entspannenden Partner. Verantwortlich für dieses muskuläre Zusammenspiel ist eine durch die o.g. Bahnung entstandene motorische Intelligenz, die in Basalganglien des Stammhirns und mit der „Zeitmaschine“ Kleinhirn jene Strukturen schuf, die das Erlernen eines aufrechten Ganges in unserem ersten Lebensjahr möglich machte.
Was ich am Beispiel des aufrechten Ganges im ersten Lebensjahr zu beschreiben versuche, ist ein Entwicklungsphänomen, an welchem sich die Plastizität des menschlichen Gehirns demonstrieren lässt. Korrekte Bewegungen entstehen nur durch Übung und Lernen und unser Gehirn macht Lernen möglich. Physiologie und Medizin kennen in der Zwischenzeit zahlreiche Beispiele für eine funktionelle Plastizität des Gehirns, indem sich dessen Neurone nach „funktionalen- und aktivitätsabhängigen“ Kriterien vernetzen: Bei Klaviervirtuosen wird die Repräsentation der Finger durch regelmäßigen Gebrauch im motorischen Cortex unseres Gehirns umfangreicher. Der Zuwachs ist Resultat des Lernens durch Wiederholung und macht das Erlernte durch Bahnung der dafür zuständigen Neurone zur Routine. Die Evolution hat uns die Möglichkeit des Lernens geschenkt. Was aber erlernt werden soll muss angestrebt und geübt werden. Nach Schlaganfällen mit Zerstörung unterschiedlicher Hirnareale können Behinderungen der Beweglichkeit oder Sprachausfälle auftreten. Das „selbstreferentielle System Gehirn“32 arbeitet „autopoietisch“, selbstorganisierend und offenbart Plastizität. Solange unbeschädigte Neurone noch in Kontakt zu sensorischen Einflüssen stehen, durch die üblicherweise Bewegungen oder Sprache ausgelöst werden, können diese die ausgefallenen Funktionen der Bewegung oder der Sprache zum Teil übernehmen. Die Übungsintensität entscheidet über den Erfolg einer Rehabilitation.
—
Lernen ist in der Evolution und auch in der Individualentwicklung eine Entwicklung formende Funktion. Das Lernen ist nach der Fähigkeit der Unterscheidung durch sensorische Intelligenz eine zweite genetisch festgelegte Fähigkeit des Menschen und ist eine lebenslang die menschliche Entwicklung formende Funktion. Ohne Lernen könnten wir uns nicht entwickeln oder überleben. Lernen beginnt als unbewusstes Lernen des Körpers, wird über lange Perioden der menschlichen Entwicklung im unbewussten Umgang mit Objekten als spielerisches- oder imitierendes Lernen wirksam bleiben und spät erst beim Menschen zu einem bewussten-, von Aufmerksamkeit gelenkten- und von Gefühlen und Gedanken intendiertem Lernen werden. Lernen ist eine Fähigkeit, die wir Menschen von unseren tierischen Vorfahren übernommen- und weiterentwickelt haben. Eine evolutionäre Intelligenz hat Lernen möglich gemacht und Bedingungen geschaffen, die Lernfähigkeit schufen: Nicht ein menschliches Bewusstsein hat das Lernen erfunden. Eine evolutionäre Intelligenz hat Lernen möglich gemacht und biologisch entwickelte Lernfähigkeit hat eine mentale Intelligenz und auch ein Bewusstsein geschaffen. Menschliches Bewusstsein hat aus einem unbewussten- und assoziativen Lernen allenfalls ein intendiertes Lernen entstehen lassen, das über weite Strecken ebenfalls assoziativ seinen Erfolg sucht.
Erste Bedingung des Lernens ist immer ein Objekt, durch welches Lernen angestoßen wird. Wer lernt braucht einen Anlass oder einen Partner, der Lernen auslöst: Was erlernt werden muss ist in der biologischen Welt und auch beim Menschen immer ein Zusammenspiel von „Irritation und Reaktion“. Dieses kosmische Gesetz lenkt jegliches Handeln, Fühlen und Denken, mit denen umzugehen gelernt werden muss. Nach diesem Gesetz führen sensorische Wahrnehmungen zu Reaktionen. Diese Reaktionen oder Aktionen sind über weite Perioden in der biologischen Welt assoziativ erlernt- und dann genetisch angelegt worden. Das erste Objekt eines biologischen Individuums ist sein Körper, der lernen muss, sich zu entwickeln, sich gesund zu erhalten, der aber auch weh tun kann oder Lust entwickelt und nach Antworten sucht. Lernen beginnt als „Lernen des Körpers“. Seit Beginn der biologischen Evolution muss jedes biologische Geschöpf lernen, ein metabolisches- oder biochemisches Gleichgewicht, eine Homöostase zu entwickeln, wenn es überleben will. Ein starker und gesunder Körper entsteht, wenn chemische- oder elektrophysiologische Rückmeldungen jeder Zelle oder jedem Organismus annoncieren, was ihm schadet und was ihm nützt. Was einmal nützlich war wird fortbestehen, wird wiederholt und wird durch das o.g. „implizite Gedächtnis“ „erlernt“.
In der Biologie ist Metabolismus die früheste Funktion, welche erlernt werden muss. Jedes biologische Geschöpf braucht Energie und Pflanzen mussten lernen, die Sonnenenergie zu nützen. Metabolisches Lernen ist eine nie endende Abfolge von Versuch und Irrtum: Ein interagierendes Funktionssystem aus chemischen- und elektrophysiologischen Reizen wird von Rezeptoren aufgefangen und entwickelt in Zellen, in Organen oder Organismen eine bestmögliche Anpassung. Bei Tier und Mensch wird metabolisches Lernen durch ein „motorisches Lernen“ oder eine „motorische Intelligenz“ ergänzt: Motorik sichert für Mensch und Tier die Nahrungsbeschaffung. Motorisches Lernen bedeutet die Mobilität von Tier und Mensch so zu standardisieren, dass Geschwindigkeit optimiert und Energieverbrauch minimiert wird. Durch fortgesetzte Rückmeldungen der muskulären Peripherie an unser lernfähiges Zentralnervensystem gelingt diesem schließlich die optimale Mobilität. Mit der Aufrichtung des Menschen in den letzten 6 bis 12 Millionen Jahren erhielt das senso-motorische Reagieren einen kräftigen Schub und macht motorisches Lernen zu einer ersten Basis, die neue Lernziele finden und sich weiter entwickeln wird.
Das „Lernen des Körpers“ ist die früheste Stufe der biologischen Entwicklung. Meldungen aus dem Körper werden aber auch weiterhin eine Homöostase anstreben oder Krankheiten und Belastungen anzeigen. Nach dem Körper, der uns warnt und mahnt, werden Natur und Umfeld zur nächsten Spielwiese des Lernens. Man sammelt und findet, was nutzbar ist und nicht schadet. Lernen kann ein Mensch in erster Linie von jenen, die schon Erfahrung gemacht haben und geschätzt werden. Erfahrene, Alte und Weise werden zum Vorbild: Nachahmung wird zu einer wichtigen Form des Lernens. Wer von Natur und Umfeld oder von erfahrenen Menschen lernt, wird schließlich Sympathie und Vertrauen oder Antipathie und Misstrauen entwickeln. Er entwickelt Emotionen, die schließlich zu Gefühlen werden und nach Antworten in Form von sozialen- oder gedanklichen Intentionen verlangen. Umfeld und Menschen werden uns anregen. Sie werden uns aber auch aufregen und wir müssen lernen eine adäquate Antwort zu finden. Wir müssen lernen abzulehnen oder zu akzeptieren. Unsere Gefühle und Gedanken werden die menschliche Entwicklung begleiten, indem wir lernen auf eine Weise zu reagieren, die unserem Wesen entspricht. Immer antworten wir auf sinnliche Wahrnehmungen, auf angenehme- oder störende Irritationen, auf körperliche-, emotionale- oder gedankliche Einflüsse. „Irritation und Reaktion“, Anlass und Antwort lenken als kosmologisches Gesetz das menschliche Lernen und die menschliche Entwicklung.
—
Lernen stimuliert das Hirnwachstum. Lernen entsteht in neuronalen Strukturen, die schließlich zum Gehirn werden. Lernen wird zu einer die Evolution mitbestimmenden Funktion. Lernen profitiert vom Hirnwachstum und stimuliert es auch. Schon die evolutionäre Bereitstellung eines „impliziten Gedächtnisses“ oder einer lernenden senso-motorischen Intelligenz führt beim sich aufrichtenden Australopithecus zu einer Vergrößerung des Gehirns. Ist ein Schimpansengehirn etwa 385 cm3 groß, so schätzt man an archäologischen Schädelbefunden die Größe des Gehirns der Australopithecinen auf 400 bis 550, im Schnitt auf 450 cm3. In der Hominidenreihe wird sich das Hirnwachstum fortsetzen und beschleunigen. Für Homo habilis werden 640cm3, für den Homo erectus 940cm3 angegeben und das Gehirn des Homo sapiens ist 1230 cm3 groß. Größer ist nur noch das Gehirn des Homo neanderthalensis mit 1200 bis 1750 cm3, im Schnitt 1400 cm3. Lernen stimuliert das Hirnwachstum in der anthropologischen Evolution bis zum Homo neandertalensis und in der Individualentwicklung des Menschen bis zum Ende der Pubertät. Danach stagniert das Hirnwachstum, in der Evolution und auch in der Individualentwicklung. Lernen fördert das Hirnwachstum, doch stagniert dieses, wenn Gedanken oder Ideen aufkommen und schon erlernte Erfahrungen benutzt werden. Stimuliert Lernen das Hirnwachstum, während schon erworbenes Wissen ein weiteres Wachstum blockiert? Hat der Sapiens-Mensch aufgehört zu lernen? Hören wir nach Pubertät und Adoleszenz auf zu lernen, weil wir schon zu viel Wissen gesteigert haben?
In der Evolution vom Tier zum Menschen zeigt sich v.a. eine Vergrößerung des cerebralen Cortex oder der Hirnrinde31: Der „Encephalisationsgrad“, eine relative Größe von Hirngewicht und Körpergewicht, offenbart bei Säugetieren üblicherweise ein Hirngewicht von 0,3% des Körpergewichtes, beim Menschen aber von 2%. Man hat auch das Gewicht des Rückenmarks mit dem Gehirn verglichen und findet beim Huhn ein Verhältnis von 1:1, beim Hund von 1:4 und beim Menschen von 1:25. Die Bedeutung des Gehirns als Steuerungs- oder Lerninstrument des Menschen zeigt sich jedoch nicht nur an einer gegenüber anderen biologischen Geschöpfen zunehmenden Hirngröße. Auch 20% des menschlichen Energieverbrauchs wird vom Gehirn benötigt.
—
Warum das Gehirn im evolutionären Geschehen der letzten 2 bis 5 Millionen Jahre anfing zu wachsen, in den letzten 2 Millionen Jahren sein Wachstum enorm beschleunigte und in der Individualentwicklung des Menschen das Gehirn von der Geburt bis zum Ende der Pubertät um das 4 fache an Gewicht gewinnt, konnte die Forschung nicht ruhen lassen. Dass das Gehirn nicht wegen aufkommender Bedürfnisse zu wachsen beginnt, ist bereits von Darwin erkannt worden, als er Lamarcks Vererbung erworbener Fähigkeiten ablehnte. In Darwins Theorie der Entwicklung sind neu aufkommende Fähigkeiten die Folge von genetischen Mutationen, die im Gehirn neue Strukturen schaffen. Nach archäologischer Anthropologie, nach Ethnologie, Etologie und Neurowissenschaft ist heute v.a. die Genetik um Aufklärung der Evolution bemüht. Tatsächlich konnten Genetiker im Chromosom 1 von Tier und Mensch eine sog. NOTCH-Gengruppe entdecken, die bei allen Tieren zu einem Wachstum von Organen führt. Wurde das Genom des Menschen mit dem Genom von Schimpansen verglichen, so war der NOTCH2NL-Anteil der NOTCH-Gengruppe bei Schimpansen und Gorillas verkürzt gegenüber dem menschlichen Genom. Offenbar stimuliert das NOTCH2NL-Gen das Hirnwachstum: Von dem belgischen Forscherteam um Pierre Vanderhaeglen33 wurden NOTCH2NL-Gene in Mäusegenome transferiert und führten bei Mäusen zu einem intensiven Hirnwachstum: Beobachtet wurde eine Umwandlung von Stammzellen in Vorläuferzellen von Neuronen. Weniger Kopien von NOTCH2NL-Genen in Mäusegenomen führten zu geringen Größenveränderungen des Gehirns, mehr NOTCH2N-Gene führten zu einem Wachstum des Gehirns. Offenbar entsteht im Übergangsbereich vom Schimpansen oder Gorilla zum Menschen in der NOTCH-Gengruppe ein Gen-Allel NOTCH2NL, welches das Hirnwachstum beschleunigt. Ein größer werdendes Gehirn mit einer Zunahme der Neuronenzahl und einer Zunahme von Dendriten, die Neuronen zu Netzen verbinden, kann offenbar das Lernen des Menschen und seine Lernziele erweitern. Was dann als Lernziele angestrebt wird entspringt der menschlichen Neugier oder noch mehr seiner Aufmerksamkeit. Zu hoffen bleibt, dass Menschen das Richtige und das ihr Überleben Sichernde lernen.