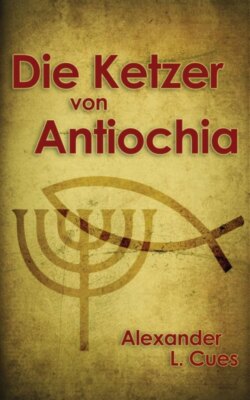Читать книгу Die Ketzer von Antiochia - Alexander L. Cues - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVIII Einige Wochen später starb Timotheus, der jüngste Bruder von Berenike, im Alter von zehn Jahren. Er hatte bereits seit Tagen über heftige Schmerzen im Unterleib geklagt. Der hinzugerufene Arzt verordnete die Einnahme eines Abführmittels, was aber nur eine kurzfristige Besserung brachte, ehe sich der Zustand des Jungen am nächsten Tag verschlimmerte. In der Nacht vor seinem Tod fieberte er hoch und erbrach sich. „Kann es sein, dass nichts geschieht ohne den Willen Gottes? Wenn er gütig ist, warum lässt er dann unseren Bruder elend sterben?“ klagte Berenike in ihrem Kummer. Alexander versuchte zu trösten: „Niemand kann den Willen Gottes ganz verstehen. Aber wir dürfen glauben, dass Christus uns nahe ist im Leid. Lass´uns nicht vergessen, dass wir hier nur Gäste und Fremdlinge sind. Unser Bruder geht uns voraus in die ewige Heimat. Er wird Gott sehen in seiner Herrlichkeit.“ Die Haut des Kindes hatte sich gelb verfärbt. Sein abgemagerter Körper wurde von heftigem Schüttelfrost gepackt. Alles, was sie ihm einflößten, kam sofort wieder heraus. Berenike wandte sich in ihrer Not an Gott, der zugelassen hatte, dass ihre Eltern umkamen und ihnen nun auch noch ihren Bruder nahm: „Was haben wir versäumt, dass du uns mit dem Tod bedrohst? Hat nicht Christus für uns gelitten?“ Es half nichts: In den Morgenstunden starb Timotheus, der Bruder, den sie so sehr geliebt hatte. Sie beerdigten das Kind auf dem Gräberfeld, das die Christianer von einem phönizischen Kaufmann erworben hatten, dessen Familiengrab sich hier befand. Er hatte mit ihnen ausgehandelt, dass auch er hier einmal beigesetzt werden sollte, wenn er auch kein Christusgläubiger war. Auf dem Heimweg nach der Beerdigung sprachen sie darüber, wie die Toten, die im Glauben an Christus gestorben waren, zu Gott gelangen. Berenike, die ihren Bruder sehr geliebt hatte, war nach wie vor untröstlich. Viele Fragen waren ihr gekommen: „Wird es eine Auferstehung der Toten geben? Wird der Leib von Gott wiederhergestellt? Oder wird nur die Seele zu Gott gelangen?“ Darauf wusste Alexander keine rechte Antwort und meinte: „Lass´uns die Prophetin fragen. Sie weiß mehr darüber und kennt sich gut aus in den Heiligen Schriften der Judäer. Vielleicht wissen auch Simon oder Kleopas mehr.“ Sie beschlossen, die Glaubensgeschwister in dieser Sache zu befragen. Alle mussten doch ihre Toten begraben und hatten deshalb großes Interesse daran zu erfahren, was mit ihnen geschieht. Antwort auf ihre Fragen kam bald darauf zur Überraschung aller von jemandem, der neu in der Gemeinde der Christianer war und den sie noch nicht kannten. Euodius, Sklave eines Ratsherrn, besuchte erst seit kurzer Zeit ihre Gottesdienste und erwies sich als philosophisch gebildet. Er unterrichtete im Hause seines Herrn die Kinder desselben, konnte lesen und schreiben und sprach Lateinisch, Griechisch, Aramäisch und Syrisch. Nachdem er drei Monate die Gottesdienste besucht hatte, begehrte er die Taufe mit Wasser und Geist. Als Simon und die Prophetin den Ernst seines Anliegens geprüft hatten, unterrichteten sie ihn wie alle anderen, die zu den Christusgläubigen gehören wollten. Nach vier Monaten stand seiner Taufe nichts mehr im Wege. Er war von nun an regelmäßig anwesend, so auch jetzt, als Alexander die Prophetin und Simon danach fragte, worauf die Christusgläubigen nach ihrem Tod hoffen dürften. „Wir werden unsere Toten wiedersehen,“ schaltete sich Euodius ein und fuhr fort: „Ich glaube, wir können uns den Tod vorstellen wie das Ausziehen eines Kleides. Gott schafft Körper aus dem Nichts und wird uns ein neues Kleid geben.“ Diese Vorstellung gefiel Berenike gut, minderte aber nicht ihre Trauer um den Verlust des jüngeren Bruders: „Er war doch noch ein Kind, unschuldig wie alle Kinder. Was hat Gott damit zu tun, wenn Kinder sterben?“ Darauf erhielt sie aber auch von Euodius keine Antwort. Simon meinte noch, es könne ja auch so sein, dass Christus selbst die Verstorbenen zu sich hole in den Wolken des Himmels. Alle waren sich einig in der Hoffnung, Gott werde sie nicht dem Tod überlassen, weil er ja auch Christus wieder lebendig gemacht habe. Die Taufe des Sklaven war ein wichtiges Ereignis, an dem alle Christusanhänger teilnahmen, denn neu Hinzugekommene wurden in ihrer Mitte immer feierlich begrüßt, ganz gleich, ob es ein Sklave oder ein Wohlhabender war. Alle trafen sich bei Sonnenaufgang am Orontes-Ufer außerhalb der Stadt in der Nähe des Daphne-Tores. Simon, der Vorsteher, Kleopas, der Armenpfleger, mit seiner Frau Rebekka, Demetrios, der Färber, mit seiner ganzen Familie, Silvia, die Frau des Commodus, Lavinia, die Sklavin, und ihre Herrin Lydia. Auch Alexander und Berenike waren mit ihren Geschwistern dabei, ja sogar Rahel, die Mutter Menachems, wohnte mit ihren Kindern der Taufe bei. Sie mussten trotz ihrer Feierlaune darauf achten, sich vorsichtig zu bewegen, um durch ihre Zusammenkunft nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, schließlich standen sie unter Beobachtung. Die Prophetin sprach ein Gebet. Euodius, der zur Vorbereitung auf das Ereignis drei Tage gefastet hatte, trat ans Ufer und entkleidete sich. Feierlich legte er sein Taufgelübde ab: „Ich entsage dem Satan und allen Dämonen und gebe allein Gott die Ehre.“ Nach diesen Worten wurde er mit dem heiligen Öl gesalbt, woraufhin Simon und die Prophetin den Täufling ins Wasser begleiteten und ihn nach seinem Glauben fragten: „Glaubst du an Jesus, den Gesalbten Gottes? Willst du auf seinen Namen getauft werden?“ Nachdem er dies laut bejaht hatte, tauchten sie ihn dreimal unter und salbten ihn ein zweites Mal. Nach der Taufe kleidete er sich wieder an und empfing ein drittes Mal die Salbung. Die Prophetin legte ihm die Hand auf, betete um den Geist Gottes und küsste den Täufling, bevor alle anderen es ihr gleichtaten. Sie waren voll Freude und Dankbarkeit, denn jetzt hatte Euodius den Geist Gottes empfangen und war einer von ihnen. Bis zur Mittagszeit lobten sie Gott, der sie zu einem Volk gemacht hatte. Nach seiner Taufe erzählte er ihnen vom Leben im Hause des Ratsherrn Basilios, der zu den reichsten Großgrundbesitzern in Antiochia gehörte: „Er hat mich vor einigen Jahren zusammen mit meinen Eltern auf einem Sklavenmarkt an der phönizischen Küste gekauft. Wir waren froh, dass wir in der Familia unseres neuen Besitzers zusammenbleiben konnten. Schon mein früherer Herr, ein reicher Händler aus Sidon, hat mich gefördert und mich zusammen mit seinen Kindern von einem Privatlehrer erziehen lassen. Meine Eltern arbeiten jetzt im Hause des Basilios. Ich durfte am Unterricht eines Grammaticus teilnehmen und lernte die Werke der großen Philosophen und Schriftsteller kennen. Mit achtzehn Jahren habe ich die Rhetorikschule des berühmten Gnaeus Domitius Afer in Rom besucht. Dort konnte ich die Rhetorik, aber auch die Rechtskunde studieren. Vor zwei Jahren kam ich wieder nach Antiochia zurück und lehre die Kinder meines Herrn das Lesen, Schreiben und Rechnen. Basilios lässt mir weitgehend freie Hand und bezahlt mich sogar für meine Dienste. Ich hoffe sehr, dass er mich auch bald in die Freiheit entlässt.“ Für die Gemeinde der Christianer bedeutete die Tatsache, dass nun ein Gebildeter wie Euodius zu ihnen gehörte, einen großen Gewinn, denn er konnte mit seinen Kenntnissen der Rechtskunde Unheil von ihnen abwenden, aber auch ihre Interessen bei der Abwicklung von Geschäften wahrnehmen und den Vorsteher Simon beraten. Schon früher als ihnen lieb gewesen ist, waren seine Fähigkeiten und Kenntnisse gefragt. Einige führende Männer des jüdischen Gemeinderates stellten Simon zur Rede wegen der Aufnahme von nichtjüdischen Gläubigen: „Sag´uns, ob sie dem Bund Abrahams angehören. Sind sie Söhne des Bundes geworden, den der Ewige mit uns geschlossen hat? Haben die Beschneidung empfangen?“ „Nein, sie sind wie die Gottesfürchtigen bei euch, feiern den Sabbat und halten sich an die Gebote, die Gott dem Noah gegeben hat. Sie beten allein zu Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, achten menschliches Leben und vergießen kein Blut.“ „Trifft es zu, dass ihr gemeinsam esst und trinkt? Auch Fleisch, das auf den Märkten gekauft wird?“ „Ja, aber nicht alle essen davon.“ „Und wer liest am Sabbat in eurer Synagoge?“ „Wir wechseln uns ab mit der Wochenlesung.“ „Dann lesen also nicht nur die Söhne der Beschneidung, sondern auch die Unbeschnittenen.“ Da Simon sich nicht der Lüge schuldig machen wollte, musste er eingestehen, dass bei ihren Zusammenkünften auch die nichtjüdischen Gläubigen den Dienst der Lesung aus der Tora wahrnahmen. Der Vorsteher Aidesios von der großen Synagoge, die auch Bet Ashmunit genannt wurde, warf ihm daraufhin entsetzt vor, die Gebote der Väter zu missachten: „Wie kannst du es dulden, dass ihr gemeinsam zu Tisch liegt und Opferfleisch genießt? Ein widerlicher Götzendienst! Wie kannst du zuschauen, dass unsere heilige Tora in den Händen von Ungläubigen liegt? Eine ganze Synagoge in den Händen der Götzenanbeter!“ Simon aber hielt dagegen und erwiderte: „Wir glauben, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat über die Söhne der Beschneidung, aber auch über die Heiden, die Jesus von Nazareth als den Gesalbten Gottes und Kyrios verehren.“ „Ketzer seid ihr, und eure Synagoge ist eine Synagoge des Satans!“ antwortete Aidesios voller Rage. „Wir achten euch von jetzt an nicht mehr als Söhne des Bundes, den der Gott unserer Väter mit uns geschlossen hat!“ Das Ergebnis dieser Konfrontation war entmutigend. Simon hatte zwar seinen Glauben verteidigt, aber jetzt mussten die Christianer damit rechnen, dass auch die Behörden davon erfuhren, dass andere Judäer sie nicht als Glaubensgenossen achteten, was unweigerlich zu neuen Verdächtigungen führen würde. Simon beriet sich deshalb mit Euodius, wie solchen Verdächtigungen zu begegnen sei und wie er bei einer erneuten Vernehmung durch den Untersuchungsrichter am besten argumentieren sollte. Euodius meinte: „Es ist am besten, wenn du bei deiner bisherigen Darstellung bleibst, dass die Nichtjuden in unserer Synagoge Gottesfürchtige sind.“ Auch diesmal ließ die Reaktion der Behörden nicht lange auf sich warten. Simon wurde durch zwei Bewaffnete vor den Richter Antigonos gebracht, der jetzt genau wissen wollte, mit was für einem Aberglauben er es bei den Christianern zu tun hatte. Er warf Simon Atheismus vor: „Ihr ehrt die Götter nicht und bringt dem Kaiser keine Opfer. Gottlosigkeit aber ist die Ursache für Aufruhr und Gewalttaten. Was für einem Aberglauben hängt ihr an?“ Simon verteidigte sich nach Kräften: „Wir opfern in Jerusalem dem Gott, der den Himmel und die Erde schuf. Er hat Mose, dem Gründer unserer Religion, die Gesetze offenbart, nach denen wir mit Erlaubnis des Kaisers leben dürfen.“ „Was ist das für ein Heiligtum, an dem ihr euren Gott verehrt?“ hakte der Richter nach. „Es ist der Tempel des Herodes, in dem geopfert wird nach den Vorschriften unserer Väter. Unsere Abgaben für den Tempel und die Priester entrichten wir einmal im Jahr.“ „Und was ist mit diesem Christos, den ihr verehrt und zu dem ihr betet?“ ließ der Richter nicht locker. „Er ist der Gesandte Gottes, genau wie die Propheten, die vor ihm gekommen sind.“ „Was lehrt euch dieser Gesandte Gottes? Den Aufruhr gegen den Kaiser?“ fragte der Richter in provozierender Weise. „Er hat uns gelehrt, dem Kaiser zu geben, was ihm gehört, und Gott zu geben, was ihm gehört.“ „Und was hat er euch gelehrt über die Menschen? Sollt ihr sie hassen und euch von ihnen fernhalten?“ „Nein, er hat uns gesagt: Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch,“ entgegnete Simon. „Trifft es zu, dass man diesen Mann wegen Aufruhrs in Jerusalem gekreuzigt hat?“ wollte der Richter wissen. „Pilatus hat ihn´König der Juden`genannt. Deshalb hat er ihn kreuzigen lassen.“ „Ist es richtig, dass ihr ihn anbetet wie einen Gott?“ „Nein, aber wir verehren ihn und glauben, dass er bald kommen wird in Herrlichkeit.“ „Wie kann ein Toter wiederkommen in Herrlichkeit?“ „Wir glauben, dass Gott ihn auferweckt hat.“ Der Richter schüttelte verwundert den Kopf und meinte: „Was für ein Aberglauben! Ein Gekreuzigter wird wie ein Gott verehrt!“ Simon versuchte weiterhin, den Richter für sich einzunehmen: „Wir achten die Gesetze und halten unsere Gläubigen an, gute Bürger dieses Landes zu sein.“ Antigonos erwiderte: „Mir liegen Zeugenaussagen vor, nach denen ihr versucht, Bürger für euren Glauben zu gewinnen. Sagt mir, zahlen alle bei euch die Steuer für den Tempel des Herodes?“ „Nein, die Gottesfürchtigen nicht. Sie feiern den Sabbat und besuchen unsere Gottesdienste.“ „Sie sind also nicht den Beschnittenen gleichgestellt?“ „Nein, sie sind Menschen, die den Ewigen fürchten und seinen Gesalbten verehren,“ versuchte Simon mit einer salomonischen Antwort zu beschwichtigen. „Aber sie feiern mit euch, essen und trinken bei euren Mahlzeiten.“ „Ja, denn wir sind gleich vor unserem Gott.“ „Wie nehmt ihr sie bei euch auf?“ „Durch ein Reinigungsbad, wie es auch die anderen Synagogen tun.“ „Aber sie werden nicht beschnitten wie bei den anderen?“ „Nein, sie werden nicht beschnitten.“ „Ihr nehmt sie also auf durch eine Taufe, sie leben nach euren Gesetzen, aber sie sind dadurch keine Judäer geworden? Was sind sie dann?“ wollte der Richter wissen. „Gottesfürchtige, die uns gleich sind.“ Simon hatte geschickt geantwortet, jedoch spürte er, dass er den Verdacht des Proselyten-Machens auch diesmal nicht ausräumen konnte, was ihm jetzt eine drakonische Strafe von drei Jahren Kerkerhaft einbrachte. Ohne ihren Vorsteher, der die Apostel Barnabas, Petrus und Paulus noch persönlich gekannt hatte, standen die Christusanhänger in Antiochia plötzlich ohne Führung da. Am nächsten Sabbat mussten sie nun beraten, wie es ohne Simon weitergehen konnte und ob es eine Möglichkeit gab, ihm zu helfen. „Lasst uns Kleopas zum Vorsteher der Synagoge wählen,“ schlug Euodius vor. „Wir müssen alles vermeiden, was unseren Stand als jüdische Synagoge gefährdet.“ Er erkannte die Wichtigkeit dieser Einstufung, weil deren Mitglieder ein eingeschränktes Bürgerrecht genossen. Sie durften ihre Angelegenheiten - wie andere Collegia auch – selbst regeln. Dazu gehörten Grundstücksangelegenheiten, aber auch die Bestattung ihrer Mitglieder. Einige meinten, Euodius solle doch selbst das Amt des Vorstehers übernehmen. Das aber lehnte er aus nachvollziehbaren Gründen ab: „Wie soll denn ein Grieche, der dazu auch noch ein Sklave ist, eine jüdische Synagoge leiten?“ fragte er sie. Da war leider einleuchtend und so wählten sie einstimmig den Armenpfleger Kleopas zum neuen Leiter der Synagoge der Christianer. Außerdem begrüßten sie den Vorschlag des Euodius, dass er im Auftrag aller Gläubigen noch einmal mit dem Untersuchungsrichter sprechen sollte, um eine Minderung der Strafe für Simon zu erreichen. In den folgenden Monaten wurden die Christusanhänger von den Behörden in Ruhe gelassen. Kleopas erwies sich als geistbegabter neuer Leiter der Gemeinde, denn er besaß die Gabe der Krankenheilung. Durch seine Tätigkeit hatte er sich im jüdischen Bezirk, aber auch bei Teilen der Bevölkerung des syrischen Bezirks hohes Ansehen erworben. Immer noch litten viele Menschen unter den Zerstörungen, die das Erdbeben angerichtet hatte. Die Christianer hatten schon kurz nach dem Beben eine Armenspeisung eingerichtet, die aus der Gemeindekasse bezahlt wurde. Sie bekamen auch des Öfteren Spenden von angesehenen Bürgern, die selbst nicht zu ihnen gehörten. Das beförderte wiederum ihren Ruf in der Stadt, und immer mehr Menschen besuchten ihre Versammlungen, darunter auch Judäer der anderen Synagogen, was natürlich den dortigen Vorstehern nicht passte. Diese begegneten den Christianern, die sie von nun an als Minim, als Ketzer, betrachteten, mit immer größerem Misstrauen. Zur neuen Armenpflegerin wählten die Gläubigen Berenike, die durch ihr freundliches Wesen viele Sympathien genoss. Sie musste nun mit einigen Helfern die Speisung für die Bedürftigen organisieren, hatte aber auch die Kranken zu versorgen. Gelegentlich hospitierte sie bei Herophilos, dem Arzt aus der Cyrenaika, der ein Nachbar von Menachems Familie war. Er machte sie bekannt mit verschiedenen Krankheitsbildern, die er auf die Stockung des Blut- und Pneumastroms zurückführte. Auch lernte sie die Pulszählung kennen sowie verschiedene Heilmittel aus Pflanzen und Mineralien, aber auch aus tierischen Stoffen. Herophilos zeigte ihr, wie sie anzuwenden und zu dosieren sind. In den Erzählungen über Jesus von Nazareth aber fand sie das, was sie für ihre Tätigkeit als Heilerin als das Wichtigste erkannte: Christus war der beste Arzt für Leib und Seele. Wenn Menschen zum Glauben an ihn fanden als ihren Retter, erlebten sie Heilung und fanden ihr Heil. Nach einigen Monaten der Ruhe wurde die Gemeinde erneut vor eine schwere Prüfung gestellt, als ihr Vorsteher Kleopas überraschend erkrankte. Als er am Vorabend des Sabbat die Synagoge betrat, um dort die Kerzen auf den Leuchtern anzuzünden, erfasste ihn ein heftiger Schwindel, so dass ihm schwarz vor den Augen wurde und er zu Boden stürzte. Erst nach einiger Zeit fand ihn seine Frau Rebekka, die ihn zur Abendmahlzeit erwartete. Sie holte sich Hilfe bei Glaubensgeschwistern, die in der Nähe wohnten. Zusammen betteten sie den Bewusstlosen in der Synagoge und versuchten, ihm Wasser einzuflößen, was mit einiger Mühe auch gelang. Als er erwachte, mussten sie feststellen, dass er nicht sprechen und sich nicht aufrichten konnte. Berenike wurde hinzugerufen, die auch gleich den Arzt Herophilos mitbrachte, der mit ihrer Unterstützung versuchte, den Kranken wieder auf die Beine zu stellen. Ihre Bemühungen blieben jedoch umsonst. Auch das Sprechen wollte nicht mehr gelingen. Nur ein unartikuliertes Lallen kam aus dem Mund des Patienten, dessen Zustand sich auch in der Folgezeit nicht besserte. Kleopas konnte unter diesen Umständen keinesfalls mehr die Leitung der Christusgläubigen wahrnehmen. „Wir müssen überlegen, wie es ohne Kleopas mit unserer Gemeinde weitergehen kann,“ mahnte Alexander. Fast alle waren der Meinung, dass Euodius der geeignete Vorsteher wäre. Aber die Möglichkeit, ihn zu wählen, blieb ihnen ja aus den bekannten Gründen verwehrt. Ein Sklave als Leiter der Christusanhänger – das war nicht möglich. So blieb nur die Hoffnung darauf, dass er bei seinen Bemühungen um eine Verkürzung der Kerkerhaft Simons Erfolg haben würde, so dass dieser wieder sein Amt würde ausüben können. Zum Abschluss des Abends forderte Euodius alle auf: „Lasst uns der Zwischenzeit dafür beten und mit wohlgefälligen Taten dem Richter zeigen, dass von unserer Gemeinde keine Gefahr für den Staat und seine Behörden ausgeht.“ Bei der nächsten Zusammenkunft der Gläubigen erzählte Demetrios, er wolle mit seiner Frau am Fest des Apollo in Daphne teilnehmen. „Wir haben eine Einladung meines Patrons. Er will dem Gott der schönen Künste seine Dankbarkeit dafür zeigen, dass sein Sohn von einer schweren Krankheit, die mit langem Fieber einherging, wieder genesen ist,“ erklärte er. Seine Glaubensgenossen konnten kaum glauben, was sie da hörten. Sie waren bestürzt und voll Abscheu über dieses Ansinnen. Einer der ihren, der sich von den Abgöttern bekehrt hatte, um dem wahren Gott zu dienen, ging hin und wollte vor einem steinernen Bild opfern, das von Menschen gemacht war! Nach einer Pause, in der sich Betroffenheit ausgebreitet hatte, ergriff die Prophetin das Wort. Auch sie verurteilte die Absicht des Demetrios scharf: „Gott sind beide gleich verhasst, der Gottlose und sein gottloses Werk. Das Werk wird samt dem Meister bestraft werden.“ Demetrios aber versuchte sich zu verteidigen: „Das bin ich meinem Patron schuldig. Er hat mich gebeten, am Fest in Daphne teilzunehmen.“ „Warum sagst du ihm nicht, dass du nur dem einen, wahren Schöpfer-Gott dienen willst?“ fragte ihn Alexander. „Weil er es nicht verstehen würde, dass wir nur einen Gott kennen.“ „Es kann doch aber nicht sein, dass wir wieder Götzen anbeten, die mit Händen gemacht sind!“ meinte Lavinia, die Phönizierin. „Und was machen wir, wenn der Kaiser wieder unser Opfer verlangt?“ fragte die Frau des Demetrios. „Wir werden nicht opfern und unsere Hände besudeln,“ antwortete die Prophetin und zitierte noch einmal die heiligen Schriften: „Götzenbilder zu ersinnen ist der Anfang der Hurerei, und sie zu erfinden ist des Lebens Verderben.“ Demetrios und seine Frau verließen an diesem Abend vorzeitig die Synagoge. Ihre Absicht, das Heiligtum des Apollo in Daphne zu besuchen, verärgerte die Gläubigen und war Anlass für Bestürzung und Trauer. Berenike und Alexander begleiteten Rahel auf dem Nachhauseweg. Sie waren froh, die Sorge um Menachem mit ihnen teilen zu können. Fast zwei Jahre waren nun schon vergangen seit seiner Abreise, und noch immer war keine Nachricht von ihm angekommen. Dabei hatte er der Mutter doch versprochen, aus Rom einen Brief zu schicken, sobald er die Möglichkeit dazu hatte. Den beiden Frauen wurde das Herz schwer, wenn sie an Menachem dachten. „Wie kann er sich dort verständigen? Er spricht doch nicht die Sprache der Römer!“ sorgte sich Rahel, und Berenike antwortete: „Ich glaube, dass man in Rom auch Griechisch versteht, und das spricht Menachem doch sehr gut. Vielleicht lernt er aber auch schnell zu sprechen wie die Römer.“ Da pflichtete ihr Rahel bei: „Das kann schon sein. Er ist doch ein sehr kluger junger Mann.“ Berenike aber fürchtete manchmal, dass Menachem sie in Rom vielleicht auch vergessen würde. Er bekam doch so viel Neues zu sehen und zu hören! Diese Befürchtung behielt sie aber für sich. Als der zweite Winter nach seiner Abreise vergangen war, wurde die Sorge um Menachems Ergehen zur Freude aller beendet. Ein berittener Bote brachte Nachrichten von einem phönizischen Handelsschiff, das im Hafen von Seleukia Pieria festgemacht hatte. Es brachte nicht allein Nachrichten aus Rom, sondern auch aus Cypros und Alexandria, wo es Waren aufgenommen hatte. Der Bote hatte gute Nachrichten für Rahel und ihre Kinder, aber auch für Berenike. Menachem schrieb auf Griechisch und schilderte, was er in Rom und Alexandria, wo er jetzt weilte, erlebt und gesehen hatte. Er teilte auch mit, mit wem er sich getroffen hatte und wer ihm bei seinen Studien geholfen hatte. Außerdem stellte er seine Rückkehr in sechs Monaten in Aussicht, noch vor dem Anbruch der Herbststürme, die das Befahren des Meeres zu einem großen Risiko machten. Die Freude war groß bei den Frauen, und Berenike beschloss, ihrem Bruder Alexander und ihrer Freundin Lavinia davon zu erzählen!