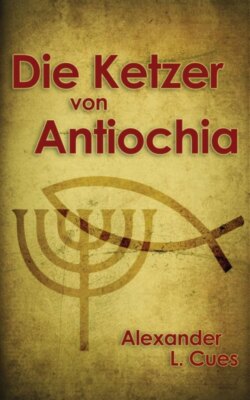Читать книгу Die Ketzer von Antiochia - Alexander L. Cues - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Als Menachem erwachte, wusste er nicht, wo er sich befand. Es war stockfinster. Die Mischung aus Staub und Leichengeruch machte ihm das Atmen fast unmöglich. Eine blutende Wunde am Kopf ließ ihn erschrecken. War sie die Ursache für den stechenden Schmerz, der ihm beinahe die Besinnung raubte? Er vermochte es nicht zu sagen, genau so wenig, wie lange er hier schon gelegen hatte. Es kam ihm vor wie eine Ewigkeit. Er erinnerte sich nur noch an zwei, drei furchtbare Erschütterungen, das entsetzte Schreien der Menschen, das vom Lärm des zusammenstürzenden Hauses übertönt wurde. Als sich die Katastrophe ereignete, waren sie gerade mit der Zubereitung ihres armseligen Essens beschäftigt. Es gab einen Brei aus Getreideresten, die sie außerhalb der Stadtmauern gesammelt hatten. Beißender Qualm erfüllte wie immer den einzigen Raum ihrer Wohnung im dritten Stockwerk des Mietshauses im jüdischen Viertel von Antiochia. Sie lebten auf diesem beengten Raum mit sechs Personen: die Eltern, Arie und Rahel, mit den vier Kindern: Menachem, der Älteste, seine Schwestern Zippora und Lea und der Bruder Dror, der gerade erst vier Wochen alt war. Wo waren sie jetzt? Hatten Sie den Einsturz ihres Hauses überlebt? Quälende Gedanken überfielen ihn und ließen ihn nicht mehr los. Würde man nach ihnen suchen? Aus eigener Kraft war es ihm unmöglich, sich nicht aus dieser Trümmerwüste zu befreien. Aus der Ferne drangen leise Stimmen an sein Ohr: das Wimmern der Verletzten, deren Gliedmaßen gebrochen waren, die verzweifelten Rufe nach den Kindern, den Eltern, die unter den eingestürzten Mauern begraben waren. Die meisten hatten keine Chance, dem Verderben zu entrinnen. Ihre Insula war wie alle Wohnhäuser ihres Stadtbezirks aus getrockneten Lehmziegeln errichtet, die selbst ohne Erdstöße manchmal in sich zusammenfielen, weil die Grundmauern die Belastung nicht tragen konnten. In den oberen Stockwerken zogen sie oft zusätzliche Mauern ein, um weitere Menschen unterbringen zu können. So wuchs die Gefahr eines Einsturzes mit jedem neuen Bewohner. Menachem machte sich wenig Hoffnung, gefunden zu werden. Wenn die Eltern und Geschwister tot waren, würde niemand nach ihm fragen. Überlebende ergriffen aus Angst vor Seuchen nach solchen Katastrophen die Flucht. Schwer Verletzte lagen oft tagelang herum und starben vor Durst. Er aber wollte leben. Sie hatten unsägliche Mühen bei der Übersiedlung nach Antiochia auf sich genommen. Welchen Sinn hätte das also gehabt, würde er jetzt elend zugrunde gehen? Vor vier Jahren waren sie aus dem Bergland von Galilaea hergekommen. Menachem war gerade zwölf geworden. Er hütete in der Heimat immer die kleine Ziegenherde, von der die Familie lebte. Der Vater stellte Decken her aus Ziegenhaaren, die Mutter machte Käse und backte Brote aus Weizen und Gerste. Sie waren immer fromme Judäer gewesen, die den Sabbat feierten und die Speisegebote beachteten, wie ihre Vorfahren es schon seit Generationen getan hatten. Sie hielten Abstand zu den Fremden, die von Tyros herüber kamen, um mit ihnen zu handeln. Die Händler brachten lederne Gürtel mit und Amphoren für Wein und Öl. Manchmal tauschte der Vater aber seine Decken ein gegen nützliche Dinge, die sie im Hause brauchten: Öllampen, Kämme und Besen. Es war ein einfaches aber erträgliches Leben. Dann kam jedoch das verhängnisvolle Jahr, in dem kein Regen fiel und die Tiere keine Nahrung mehr fanden. Eins nach dem andern mussten sie schlachten. Die Parzellen, die der Vater geerbt hatte, mussten an den Großgrundbesitzer verkauft werden, damit sie sich wenigstens noch etwas zu essen kaufen konnten. Als auch dieses Geld zu Ende ging, musste der Vater als Tagelöhner anheuern. Der bescheidene Lohn reichte aber bald nicht mehr aus, um die Familie zu ernähren. Schließlich beschlossen die Eltern, in die Stadt Antiochia zu ziehen, wo ein Bruder der Mutter mit Frau und Kindern lebte. Sie zogen mit ihren wenigen Habseligkeiten fort aus dem Dorf Kedesh, wo es für sie keine Zukunft mehr gab. Vorsichtig tastete er über sein Gesicht. Die Wunde befand sich über dem rechten Auge, wo ihn ein Stützbalken getroffen hatte. Die Blutung war mittlerweile zum Stillstand gekommen, doch er musste unbedingt seinen Durst stillen und die Wunde auswaschen. Bei dem nahezu aussichtslosen Versuch, sich aus seiner Lage zu befreien, durchzog ein heftiger Schmerz seinen linken Fuß. Als er das Bein abtastete, wurde der Schmerz unerträglich. Das Fußgelenk war zertrümmert und bedeckt von einem Gemisch aus Lehm und Blut. Ihm wurde klar, dass er sich ohne Hilfe niemals würde befreien können. Er musste an die jüngeren Geschwister denken. Sie konnten die Katastrophe unmöglich überlebt haben. Und wenn doch, würden sie an den Folgen ihrer Verletzungen sterben. Er schob die unerträgliche Vorstellung beiseite. Dieser Gedanke war ihm zu schmerzhaft, denn zwei weitere Geschwister, ein Junge und ein Mädchen, waren schon kurz nach der Geburt an Infektionen, die mit hohem Fieber und rötlichen Flecken auf den kleinen Körpern einhergingen, gestorben. Der jüdische Arzt, den sie aufsuchten, nannte die Krankheit „Fleckfieber“. Helfen konnte er ihnen nicht. Er gab ihnen den Rat, ihr Wasser aus einer anderen Zisterne zu holen. Das bedeutete eine Verdoppelung des Weges für die Kinder bei der Beschaffung von Wasser, das sie aus dem syrischen Stadtbezirk holen mussten. Manchmal jagten die Anwohner sie einfach davon. Und jetzt bangten sie um das Leben des kleinen Dror, der bis jetzt noch gesund geblieben war. Menachem dachte gerade, dass er wieder ohnmächtig werden würde, als er Stimmen über sich hörte. Er konnte nicht verstehen, was in dieser für ihn fremden Sprache gerufen wurde. Mit letzter Kraft brachte er einen verzweifelten Schrei hervor, bevor ihm erneut die Sinne schwanden. Als er erwachte, schaute er in zwei fremde Gesichter. Ein junger Mann, seiner Kleidung nach ein Grieche, und eine syrische Frau beugten sich über ihn. Die Wunde am Kopf schmerzte unerträglich. Jemand hatte ihm einen Kopfverband angelegt. Er bemerkte, dass die Frau seinen verletzten Fuß versorgte. Als der Mann ihn fragte: „Willst du etwas trinken?“ zuckte er zusammen. Angst und Misstrauen überfielen ihn. Die Eltern hatten ihn gelehrt, im Umgang mit Fremden vorsichtig zu sein. Judäer waren oftmals Opfer von Anschlägen. Besonders feindlich verhielten sich ihnen gegenüber die eingeborenen Syrer, deren Sprache er nicht verstand. Warum halfen diese Fremden ausgerechnet ihm? Wohin hatte man ihn gebracht? Er wusste, dass die Stadt eine Brutstätte des Verbrechens war. Besonders jetzt, nach dem Erdbeben, waren mit Sicherheit Scharen von Plünderern unterwegs. Herumliegenden Leichen, aber auch schwer Verletzten wurde alles genommen, was irgendwie zu gebrauchen war. Der Raum, in dem er sich befand, zeigte bedrohlich wirkende Risse im Mauerwerk. Es war lebensgefährlich, sich hier aufzuhalten. Jeden Moment konnte das Dach einstürzen. Wussten seine Retter nicht, in welcher Gefahr sie sich hier befanden? Als hätte sie seine Gedanken gelesen, sagte die Frau: „Wir haben die Mauern abgestützt. Das Dach ist heil geblieben. Wenn nicht ein neues Beben kommt, sind wir sicher. Du brauchst dich nicht zu fürchten.“ Als er zu trinken versuchte, zitterte er so stark, dass ihm der Becher aus der Hand fiel. Die Frau füllte ihn neu und half ihm, den Becher zum Mund zu führen. „Lass´ Dir Zeit. Es ist genug da.“ Auch sie sprach Griechisch, das er gut verstand. Die Nachbarn im Haus waren aus Kreta nach Antiochia gekommen. Von ihnen hatte er die Sprache gelernt. Jetzt erst merkte er, dass noch andere Personen im Raum lagen und versorgt wurden. Zwei lagen ganz nahe bei ihm, ihr schmerzhaftes Stöhnen war für ihn deutlich zu vernehmen. Zwei weitere Verletzte lagen auf der anderen Seite des Raumes neben dem Eingang. Sie schienen zu schlafen. Er konnte nicht erkennen, ob es sich um Männer oder Frauen handelte. Wieder wandte sich die Frau an ihn: „Du brauchst unbedingt Ruhe. Versuche zu schlafen.“ Er war jedoch noch viel zu aufgewühlt von den Geschehnissen, um einfach schlafen zu können. Zudem beschäftigte ihn die Frage, bei was für Menschen er sich hier befand. Er konnte sich nicht vorstellen, was diese Menschen bewegte, sich um die Verletzten zu kümmern, wagte jedoch nicht, seinen Rettern eine Frage zu stellen, die sich abwechselnd mal dem einen, dann dem anderen Verletzten zuwandten, ihnen zu trinken gaben und die Wunden versorgten. In einer Nische des Raumes sah er einen Tisch, auf dem er eine Buchrolle erkennen konnte. Als sich die Tür öffnete, betrat ein weiterer Mann den Raum, an Kleidung und Haartracht unschwer als Judäer zu erkennen. Er begrüßte die beiden Helfer mit einem Kuss und sagte: „Kyrios Jesous“. Diese erwiderten seinen Gruß mit denselben Worten. In einer bereitstehenden Schüssel wusch er den Staub von seinen Füßen und ließ sich von den anderen erzählen, wie es um die Verletzten stand. Dann kam er auf Menachem zu und fragte ihn, wie er heiße. „Menachem, Sohn des Arie aus Kedesh,“ antwortete er stockend und mit leiser Stimme. „Ich glaube, wir haben deine Eltern und Geschwister gefunden. Sie leben, aber dein Vater ist schwer verletzt. Er hat immer wieder deinen Namen gerufen. Sie werden gerade hierher gebracht.“ Als er diese Worte des Fremden vernahm, wollte Menachem sich aufrichten, spürte aber, dass seine Kraft dazu nicht reichte. „Du wirst sie bald sehen. Sie können nicht aus eigener Kraft gehen. Es kann aber nicht mehr lange dauern. Bleib´nur ruhig liegen.“ Diese Nachricht hatte eine beruhigende Wirkung auf ihn und er schlief trotz seiner Schmerzen wieder ein. Er wurde geweckt durch das ihm wohlbekannte Weinen eines Kindes, welches er sofort als die Stimme seines kleinen Bruders Dror erkannte, der in den Armen der Mutter lag, die gerade hereingetragen und auf eine Decke gelegt wurde. Wieder wollte er sich aufrichten, um ihr etwas zuzurufen, fiel aber auf sein Lager zurück und schlief weiter. Unruhig wälzte er sich hin und her. Er erinnerte sich im Traum daran, wie sie nach Antiochia gekommen waren. Die Stadt war ihm zuerst unheimlich und gefährlich erschienen. Ihre hohen Mauern, die engen Straßen mit den Mietshäusern, der Lärm, der Schmutz und der unsägliche Gestank von Abwässern und Garküchen – das alles war ganz anders als die liebgewonnenen Lebensumstände in seinem Heimatdorf in den Bergen Galilaeas. Sie fanden zunächst Unterkunft beim Bruder der Mutter und seiner Familie, was die große Umstellung zumindest ein wenig erleichterte. Jakob ben Zakkai war im jüdischen Viertel ein angesehener Mann. Er konnte lesen und schreiben und half ihnen, sich bei den Behörden registrieren zu lassen. Er kannte sich zudem im Rechtswesen aus und verfasste Gutachten für Handwerker und Händler, die mit dem Magistrat der Stadt um Steuern und Abgaben stritten. Man konnte ihn durchaus als wohlhabend bezeichnen, denn er besaß ein Mietshaus mit vier Stockwerken, das mit seiner Rückwand einen Teil der Mauer bildete, die das jüdische vom syrischen Viertel trennte. Die eigene Wohnung bestand aus drei Zimmern, einer Küche und hatte eine Latrine, was schon ein gewisser Luxus war. Eins der Zimmer wurde freigemacht für Menachems Familie. Als einige Zeit später eine Familie im dritten Stock am Fleckfieber starb, zogen sie in deren Wohnung, die aus einem Zimmer und einer kleinen Nische bestand, die sie als Vorratskammer benutzten. Neben ihren Schlafstellen, der kleinen Wiege für den Bruder und der Feuerstelle gab es noch eine Truhe im Zimmer, in der die Habseligkeiten der Familie aufbewahrt wurden: ein paar Ziegenfelle, der Gebetsschal des Vaters, Silberschmuck der Mutter, Essgeschirr und die Sabbatleuchter mit ihren Kerzen. Wenn man aus dem Fenster schaute, konnte man in die Zimmer des gegenüberliegenden Hauses hineinblicken. Die Straße war so schmal, dass man die Gespräche der Bewohner von gegenüber gut mithören konnte. Diesmal wurde er geweckt, als man seinen schwer verletzten Vater hereintrug, der eine große Kopfwunde erlitten hatte und vor Schmerzen stöhnte. Man legte ihn neben Menachem auf eine Decke. „Abba“, flüsterte er, „kannst Du mich hören?“ Der Vater drehte ihm den Kopf zu und seufzte vor Glück: „Dem Himmel sei Dank. Du lebst! Ist die Mutter auch hier? Und deine Geschwister?“ „Die Mutter ist hier, mit Dror. Von Lea und Zippora weiß ich nichts. Sind sie mit dir zusammen im Haus gewesen, als das Unglück passierte?“ „Nein, sie waren unten mit den Kindern deines Onkels. Ich konnte ihre Schreie hören. Sie haben nach mir gerufen, aber ich konnte ihnen nicht helfen.“ Der Vater war zu schwach, um weiter zu reden. Der fremde Judäer gab ihm zu trinken und schaute besorgt auf seine Verletzungen. Als der Vater eingeschlafen war, wandte er sich an Menachem und sagte: „Es sieht aus, als wenn dein Vater auch innere Verletzungen hat. Er hat mehrmals Blut gespuckt, als wir ihn hierher getragen haben.“ Dann beugte er sich über den Vater und wusch die Wunde an dessen Kopf behutsam aus. Jetzt konnte der Junge entsetzt feststellen, dass der Vater über und über mit Blut bedeckt war, das seine Kleider mit dem Staub zusammen gelb-rötlich gefärbt hatte. Seine anfängliche Freude über die Wiedervereinigung mit seinen Eltern wich immer mehr der Angst vor dem, was vor ihnen lag. Was sollte aus ihnen werden? Menachem dachte voller Verzweiflung daran, dass sie nun auch ihre kümmerliche Wohnung mit ihren wenigen Besitztümern verloren hatten, ihnen war nichts von dem geblieben, was sie gerade erst aufgebaut hatten. Der Vater hatte im griechischen Stadtbezirk, der direkt am Orontes lag, bei einem Färber Arbeit gefunden. Er selbst lernte schnell, seine Tage auf der Straße zu verbringen und etwas zu verdienen. Das war schwer und gefährlich. Manchmal half er einem Gemüsebauern, dessen Vorfahren makedonische Soldaten waren, seinen Stand aufzubauen und die Auslagen zu bewachen. Da gab es dann hin und wieder ein paar Oliven, einen Kohlkopf oder auch ein paar Bohnen für die Familie. Ab und zu schleppte er Wasserkrüge für Nachbarn ihrer Insula. Auch half er bei Bauarbeiten an und in Wohnhäusern des jüdischen Wohnbezirks, wo viel gebaut wurde. Er flickte dort Dächer und half den Bewohnern dabei, Wände einzuziehen, um den vorhandenen Wohnraum zu unterteilen. Das alles verschaffte ihm einige Kupferasse, deren eine Hälfte er seiner Mutter gab, während er die andere Hälfte in einen Lederbeutel legte, den er Tag und Nacht nicht ablegte. Jetzt musste er an den Onkel und seine Familie denken. Ruth, die Frau des Onkels, war schwanger. Sie warteten auf ihr drittes Kind. Joel, der Sohn, war sieben, die Tochter Rahel fünf Jahre alt. Der Onkel hatte damit angefangen, seinen Kindern Lesen und Schreiben zu lehren. Menachem durfte dabei sein und lernte schnell. Das spornte die beiden Kinder an, die es ihrem älteren Cousin gleichtun wollten. Er wollte schnell lernen und sich immer mehr Wissen aneignen, denn er hatte ein großes Ziel vor Augen. Baumeister wollte er werden. Das war sein Geheimnis. Noch niemandem hatte er davon erzählt. Er hatte heimlich die Bibliothek der Stadt aufgesucht, wo man die Baupläne der Tempel und des kaiserlichen Palastes bewundern konnte. Gerade als er sich vorstellte, wie er bald wieder seine hebräischen, griechischen und lateinischen Buchstaben auf den Papyrus malen würde, vernahm er, dass die Tür ein weiteres Mal geöffnet wurde. An der Hand einer phönizischen Sklavin betraten seine beiden Schwestern den Raum. Zippora, die Ältere, war kreidebleich und Lea, die Jüngere, weinte und versuchte so schnell wie möglich zur Mutter zu kommen, die beide Kinder sofort gesehen hatte. Menachem konnte nicht glauben, was er mit eigenen Augen sah: Beide Mädchen waren unverletzt! Auch die Mutter war überwältigt und fing vor Schmerz und Freude laut zu weinen an. Die Phönizierin begrüßte die anwesenden Helfer mit einem Kuss und dem Gruß „Kyrios Jesous“, den diese erwiderten. Dann kümmerte sie sich weiter um die beiden Kinder. Seltsame Menschen, dachte Menachem. Sie schienen sich alle zu kennen, obwohl sie doch Griechen, Syrer, Judäer oder Phönizier waren. Wie konnte es sein, dass Handwerker, Sklaven und Freigelassene sich küssten? Und was bedeutete dieser merkwürdige Gruß? Wer war dieser Jesus? Traf sich die Gruppe vielleicht sogar im Geheimen? Das wäre durchaus möglich, denn die Polizeibehörden der Stadt duldeten solche Zusammenschlüsse nicht. Wer nicht angemeldet und registriert war, musste mit hohen Strafen rechnen. Meistens wurden die Anhänger lebenslang in die Steinbrüche geschickt. Menachem erinnerte sich an einen Vorfall in der Nachbarschaft des makedonischen Gemüsehändlers. Dort trafen sich Anhänger des Isiskultes, meistens Handwerker aus dem syrischen Bezirk. Einmal hatten sie gerade ihr monatliches Festmahl beendet, den Göttern geopfert und sangen ihren Paian, als plötzlich Wachsoldaten in ihr Lokal eindrangen. Sie wurden festgenommen und in Ketten abgeführt. Man machte ihnen den Vorwurf, Aberglauben zu verbreiten. Letztendlich stellte sich heraus, dass die Zusammenkünfte der Gruppe nicht genehmigt waren. Alle Anwesenden wurden daraufhin in Ketten gelegt und zur Arbeit in den Steinbrüchen verurteilt. Ob seine Retter wohl auch einem Aberglauben anhingen? Der nächste Tag brachte ihm ein wenig Aufklärung. Es war der Abend vor Jom Rishon, dem ersten Tag der Woche. Unmittelbar nach Sonnenuntergang wurde er durch Singen und Beten geweckt. Mit zum Himmel erhobenen Händen standen sie da und riefen ihren Gott an: Der junge Grieche, die Syrerin, der Judäer, die Sklavin und noch ein paar andere, darunter einige Judäer, aber auch andere Syrer und Griechen, Männer und Frauen. Dann setzten sie sich an einen Tisch, sprachen den Segen und brachen das Brot, wobei sie in Jubel ausbrachen. Menachem verstand einige Worte: „Verkündigt den Tod des Herrn, bis dass er kommt.“ Sie aßen und tranken aus einem Kelch, der herumgereicht wurde. Nach ihrem Mahl holten sie eine Schriftrolle aus der Nische, aus der der Judäer den Wochenabschnitt aus dem Propheten Jesaja vorlas, ehe die Syrerin das Wort ergriff und den Text auslegte. Zum Abschluss küssten sich alle und verabschiedeten sich mit dem Gruß „Kyrios Jesous“. Einige verließen dann den Raum, andere wandten sich wieder den Verletzten zu und pflegten ihre Wunden. Für den Jungen bestand nach dieser Beobachtung kein Zweifel daran, dass er mit seinen Eltern und Geschwistern in einer Synagoge war. Diese Menschen lebten offensichtlich nach jüdischer Sitte. Sie sprachen den Segen über dem Brot, legten die Tora aus und lobten Gott. Aber weshalb taten sie das am ersten Tag der Woche und nicht am Sabbat? Und weshalb aßen und tranken die Judäer zusammen mit Ungläubigen? Und wieso durfte eine Frau die Tora auslegen? Er würde den Grund für diese Merkwürdigkeiten herausbekommen und nahm sich vor, einen seiner Retter zu fragen, am besten den jungen Griechen. Am Abend dieses Tages erlag sein Vater seinen schweren inneren Verletzungen. Menachem hatte gewusst, wie es um seinen Vater stand, dennoch war es ein Schock für ihn. Sie begruben den Vater am nächsten Tag auf einem Platz, der sich im Eigentum ihrer Helfer befand. Der jüdische Friedhof ihres Wohnbezirks war total verwüstet und deshalb eine Bestattung dort unmöglich. Menachem fühlte sich nun immer mehr alleingelassen in dieser großen Stadt mit so vielen fremden Menschen, die anders waren als er und die Seinen. Er sehnte sich zurück in die Heimat. Er vermisste die Berge Galiläas und den Duft von frischem Thymian. Nachts, im Traum, sah er die vertrauten Gesichter der Großeltern und der Nachbarn in Kedesh. Ob sie wohl noch am Leben waren? Sein Schmerz tat unendlich weh, aber er weinte nur, wenn er allein war. Er vermisste die Umarmung des Vaters und seine aufmunternden Worte. Er ahnte, dass es jetzt auf ihn ankommen würde, und so gab er sich große Mühe, seine jüngeren Geschwister zu trösten, obwohl er sich selbst in seiner Trauer nach Trost sehnte. Es kostete ihn unendlich viel Kraft. Außerdem machten ihm seine Verletzungen noch sehr zu schaffen. Die Mutter hatte sich in Schweigen gehüllt. Der Schmerz hatte sie verstummen lassen. Erst nach einigen Tagen richtete sie die ersten Worte an ihren Sohn: „Du wirst stark und klug werden wie dein Vater. Er hat dir viel zugetraut.“ Diese Worte gingen Menachem nicht mehr aus dem Sinn.