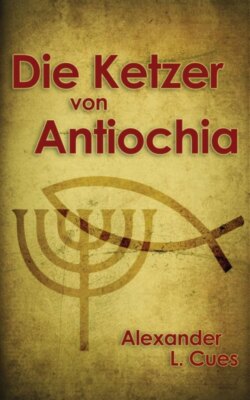Читать книгу Die Ketzer von Antiochia - Alexander L. Cues - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеXII In der Stadt war viel in Bewegung, der Wiederaufbau wurde jetzt zusehends vorangetrieben. Sechs große Lastschiffe, allesamt voll mit Baumaterial aller Art, hatten in wöchentlichem Abstand in Seleukia festgemacht und wurden entladen. Das Imperium Romanum machte gewaltige Anstrengungen, den Aufbau der Metropole Antiochia zügig voranzubringen. Die Sklavenkarawanen brachten unendlich viele Säcke mit römischem Zement in die Stadt. Dreißig Elefanten, die auf einem Platz in der Nähe des Brückentores außerhalb der Stadtmauern gehalten wurden, räumten Tag für Tag riesige Steine zur Seite, die noch immer auf Plätzen und Märkten herumlagen und die Straßen blockierten. Menachem und die Baumeister aus Rom und Alexandria ließen zuerst einmal die Kanäle trockenlegen, um Schadstellen zu sichten und sie dann mit Einsatz von Zement reparieren zu können. Sie ließen den Legaten und den Magistrat wissen, dass die vollständige Reparatur der Wasserversorgung mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen würde. Für die Bevölkerung waren diese notwendigen Maßnahmen mit zusätzlichen erheblichen Belastungen verbunden. Die Wege zu den wenigen Zisternen, die noch mit Wasser gespeist werden konnten, wurden damit länger und beschwerlicher. Öffentliche Bäder und Latrinen standen nur für wenige zur Verfügung. Menachem hatte die schwierige Aufgabe, den Menschen zu erklären, warum ihnen neue Belastungen auferlegt wurden, was er mit großem Einsatz meisterte. Er besuchte zusammen mit seinen Baumeistern persönlich die Menschen in ihren Mietshäusern und erklärte ihnen die Notwendigkeit der Baumaßnahmen. Auch stellte er ihnen in Aussicht, dass nach Fertigstellung der Maßnahme in jedem der Stadtbezirke ein Dutzend neue Zisternen in Betrieb genommen werden sollten. Außerdem konnte er die Wiedereröffnung von zwei Bädern ankündigen, die von König Agrippa in der Regierungszeit des Augustus erbaut und durch das Erdbeben beschädigt worden waren. Schließlich ließ er in den syrischen und griechischen Stadtbezirken und in direkter Nachbarschaft zur Kolonnadenstraße zehn kleinere Bäder errichten, die dem Wohlergehen der Einwohner dienten. Den Baumeister aus Alexandria, Symmachos, ließ er durch den Magistrat zum Curator aquarum ernennen. Diesem oblag von da an nicht nur die Versorgung der öffentlichen Einrichtungen mit Wasser, sondern auch die Vergabe von Konzessionen für die Wasservergabe an Privathaushalte. Für den Bau von Wohnungen stand ihm das Heer der Sklaven zur Verfügung, von denen die meisten allerdings erst angeleitet werden mussten. Dreißig von ihnen, die Kenntnisse in der Herstellung von Betonmauern besaßen, ernannte er zu Bauleitern. Sie ließen für den Bau der mehrgeschossigen Wohnhäuser hölzerne Schalwände errichten, die mit einem Gemenge aus Bruchsteinen und Mörtel aufgefüllt wurden. Das so entstandene Gussmauerwerk wurde verputzt oder mit Ziegeln verblendet. Mit diesem Verfahren konnten die Bauleute stabile drei- und viergeschossige Häuser errichten. In den Erdgeschossen dieser Häuser befanden sich Läden und Werkstätten, in denen Handel und Gewerbe aller Art einen neuen Platz finden sollten. Die darüber liegenden Zwischengeschosse dienten der Gewinnung von Wohnräumen. Menachem ordnete an, aus Gründen des Brandschutzes diesen Wohnungen Arkaden vorzulagern. Der zweite Stock dieser neuen Gebäude wies jeweils fünf großzügige, nebeneinander liegende Räume auf, die durch ein Flurzimmer auf der Vorderseite des Hauses miteinander verbunden wurden. Auf der dritten Etage wiederum waren drei nebeneinander liegende, kleine Räume im rechten Winkel zur Fassade angeordnet. Ein häufig vorhandener vierter Stock wies eine ähnliche Raumaufteilung auf wie der dritte. In den oberen Stockwerken mussten die Wände aus Kostengründen leichter gebaut werden als darunter. Menachem konnte aber verhindern, dass hier lediglich Holz verbaut wurde, was für den Brandschutz von größter Bedeutung war. Es kostete ihn viel Mühe, seine Vorstellungen umzusetzen und den Magistrat davon zu überzeugen, dass Brandschneisen und öffentliche Plätze ebenso wichtig waren wie neuer Wohnraum. Dafür musste aber zusätzlicher Platz geschaffen werden, der dann wiederum für neue Wohnungen nicht mehr zur Verfügung stand. Die pekuniären Interessen von Senatsmitgliedern aus Rom und vornehmer Familien aus Antiochia standen dem Brandschutzgedanken ebenfalls des Öfteren im Wege, was Menachems Arbeit unnötig erschwerte. Dass die Pläne trotz dieser Schwierigkeiten umgesetzt werden konnten, war einmal mehr der Autorität des alten Porphyrios zu verdanken, der Menachem energisch zur Seite stand und sich gegen solchen Widerstand durchsetzen konnte. Der Name des kaiserlichen Architekten war bald in aller Munde. Er nannte sich jetzt – nach seinem berühmten Lehrer in Rom – Menachem Celer. Sein Ruf bekam noch einen besonderen Glanz, als Maler und Bildhauer, die mit dem letzten Schiff gekommen waren, die Tempel und Bäder der Stadt mit Kunstwerken von außerordentlicher Schönheit wiederherstellten. Reiche Männer des antiochenischen Adels überboten sich aus Prestigegründen darin, für die Kunstwerke zu spenden. Mosaikböden in den Bädern des Agrippa zeigten die griechischen Götter Soteria und Apolausis, den Duft einer Blume genießend. Beiden Gottheiten wurde die Macht zugesprochen, die Menschen vor Krankheiten zu schützen und solche zu heilen, die krank waren und Schmerzen erlitten. Landschaftsmaler ließen an den Wänden des kaiserlichen Palastes und der Bäder phantasievolle Gärten entstehen, in denen sich Löwen und bunte Vögel zeigten. Andere wiederum schufen Bilder des weintrinkenden Dionysos und der schaumgeborenen Aphrodite, an der Seite ihren sterblichen Adonis mit seinem Jagdhund. Als die umfassenden Arbeiten nach drei Jahren fast abgeschlossen waren, beauftragte der Legat seinen Architekten, die Erinnerung an die Elefanten zu bewahren, die beim Aufbau der Stadt so großartig geholfen hatten. Menachem unterbreitete ihm daraufhin den Vorschlag, das Tetrapylon-Tor mit zwei Elefanten-Statuen einzurahmen, so dass jeder, der sich dem Palast näherte, an diesen Statuen vorbeiging und sie bestaunen konnte. Die Mauer, die Seleukos I. mehr als dreihundert Jahre zuvor entlang des Orontes errichtet hatte, schützte nun wieder die Stadt nach Westen hin, und auch die mächtigen Steine des Daphne-Tores wurden übereinander geschichtet und mit einem neuen Bogen geschmückt. Die Zahl der Sitzplätze des Dionysos-Theaters, gelegen am Hang des Silpios-Berges, wurde verdoppelt. Ein Teil von ihnen wurde außerdem mit einem Dach versehen, um die gut betuchten Besucher vor der Witterung zu schützen. Menachem hatte Wort gehalten und die Wasserversorgung der Bevölkerung gesichert. Auch war es ihm gelungen, die Voraussetzungen zu schaffen für glanzvolle Olympische Spiele, die einmal in Antiochia stattfinden sollten. Damit sicherte er sich die Anerkennung des Legaten, der seinen eigenen Ruhm mehren konnte und seinen Baumeister vorbehaltlos unterstützte.