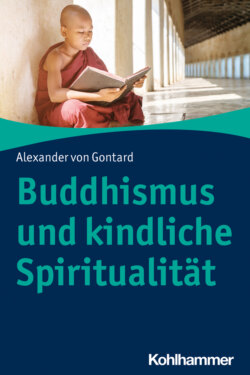Читать книгу Buddhismus und kindliche Spiritualität - Alexander von Gontard - Страница 36
Tibet
ОглавлениеMehrfach hatte ich die Gelegenheit, Novizen in buddhistischen Klöstern zu beobachten, obwohl ich nicht direkt mit Kindern und Jugendlichen gesprochen habe.
Ich kann mich daran erinnern, ein tibetisches Kloster am Stadtrand von Kathmandu zu besuchen. Die traditionellen Zeremonien sollten schon beginnen und wir Besucher waren schon spät dran. Eine Gruppe von jungen Novizen allerdings hatte sich noch mehr verspätet als wir. Sie rannten so schnell sie konnten, schossen den Berg hinab, sprangen über Stufen und jauchzten in Vorfreude, genau wie Jugendliche überall auf der Welt. Zum Schluss schafften sie es gerade rechtzeitig in die Gebetshalle und legten ihre Sandalen auf den Stufen vor dem Kloster ab. Während der Zeremonie und den Rezitationen, Gesängen und Reden, die sich über Stunden hinzogen, hatte ich viel Gelegenheit, die Novizen zu beobachten. Manche waren eifrig dabei und widmeten sich den Ritualen mit Inbrunst. Andere waren eindeutig gelangweilt und schauten herum. Schließlich machten einige Jungen Quatsch und mussten von ihren Lehrern ermahnt werden. Nach einer Stunde von Rezitation kam eine Pause. Ohne Ausnahme waren alle Jungen glücklich über diese Unterbrechung und Erholungspause mit Süßigkeiten und Tee, die sie auch uns Gästen anboten. Zusammengefasst schienen die Novizen genauso zu sein wie normale Schulkinder, nicht anders als Kinder überall auf der Welt. Die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern schien liebevoll und umsorgt zu sein. Die Jungs waren gut genährt und erzogen. Ich überlegte mir, wie es sein müsste, von Anfang an von den Lehren des Buddha beeinflusst zu werden. Wie müsste es sein, einer solchen besonderen Umgebung ausgesetzt zu sein? Ich überlegte, welche psychischen Residuen die Gesänge, die Meditation, die Konzentration auf den Atem, die Infragestellung und Diskussion des Dharma, der Lehre des Buddha, bei der inneren Entwicklung dieser Jungen hinterlassen würden.
Ein besonderer Eindruck während meiner Reisen in Tibet war die Freude der meisten tibetischen Menschen, die ich traf – trotz der unglaublichen Unterdrückung ihrer Kultur über viele Jahrzehnte hinweg. Wir pilgerten für mehrere Tage um den heiligsten Berg Tibets, den Kailash, und zelteten dort. Der Kailash ist für viele Religionen der heiligste Berg. Die Eindrücke dieses archetypischen Berges haben mich seitdem immer begleitet. Es ist streng verboten, den Berg zu besteigen, da es ein Sakrileg und Missachtung bedeuten würde. Wir folgten den Buddhisten und Hindus, indem wir im Uhrzeigersinn um den Berg liefen, während die Pilger der Bön-Religion, der ursprünglichen Religion Tibets vor dem Buddhismus, gegen den Uhrzeigersinn liefen. Jede Person wurde offen und freundlich begrüßt, was auf einer Höhe von 5 700 m mit reduziertem Sauerstoffgehalt ziemlich anstrengend war. Familien und Kinder, selbst Babys und junge Mönche, wanderten um den Berg herum. Sie schienen glücklich, friedvoll und reich gesegnet.
In ihrem bewegenden Bericht beschreibt Kama Lekshe Tsomo die Kindheit im Gebirge des Himalaja. Sie schreibt, dass Eltern:
»ihre Kinder lieben und möchten, dass sie glücklich sind. Kinder werden schrittweise sozialisiert und erzogen, andere zu respektieren und zu der Familie und dem Gemeinschaftsleben beizutragen. Die Disziplin ist eher streng, aber die Familienbeziehungen sind insgesamt liebevoll, vor allem wenn die Kinder jung sind« (Tsomo 2013, S. 378).
In früheren Zeiten durften Kinder, wie zuvor erwähnt, ab einem Alter von 6–8 Jahren in das Kloster eintreten, d. h., sobald sie Krähen wegjagen konnten. Die klösterliche Gemeinschaft wurde zu einer Ersatzfamilie und Kinder wurden Lehrlinge, indem sie Aufgaben und Verantwortungen ohne Druck übernahmen. Wie
Abb. 13: Selbst Babys werden von ihren Eltern um den Berg Kailash in Tibet getragen. Tibeter aller Altersgruppen beteiligen sich an der Pilgerwanderung um diesen heiligsten aller Berge.
Tsomo es beschrieb: »die klösterliche Disziplin für Kinder ist relativ entspannt; solange die Kinder ihre erwarteten Aufgaben und Verpflichtungen erfüllen, haben sie alle Freiheiten zu spielen, lieben und explorieren« (Tsomo 2013, S. 382). Manche Kinder treten auf ihren ausdrücklichen Willen hin freiwillig in das Kloster ein. Sie werden nicht gezwungen, dem Kloster beizutreten. Auch dürfen sie das Kloster jederzeit wieder verlassen, wenn sie es wünschen.
Dagegen ist eine besonders problematische tibetische Tradition der Glaube an Tulkus, vermutlich eine der schwierigsten und überholtesten Praktiken für jeden außerhalb des tibetischen Buddhismus. Tulkus sind die angeblichen Reinkarnationen von verstorbenen buddhistischen Meistern. Wie Ary (2013) aufzeigte, wurden seit den 1970er Jahren sogar Tulkus in westlichen Familien identifiziert. Nach tibetischen Traditionen werden ausgewählte Säuglinge mit verschiedenen Aufgaben getestet, indem ihnen Objekte ihres angeblichen Vorgängers vorgelegt werden. Wenn sie die Objekte erkennen und auswählen, wird dieses als Zeichen der Identifikation als Tulku angesehen. Weiterhin werden wundersame Ereignisse oder psychische und körperliche Eigenschaften als weitere Beweise der Reinkarnation gesehen. Sobald sie als solche erkannt wurden, wurden die ausgewählten Kinder zur Erziehung ins Kloster geschickt und von ihren Eltern getrennt.
Ary erinnert sich daran, dass er im Alter von drei Jahren als Tulku identifiziert wurde. Angeblich war er ein frühreifes und spirituelles Kind mit ungewöhnlichen Vorlieben und Fähigkeiten gewesen. Eine intensive Ausbildung und Anleitung durch tibetische Meister folgte. Ary kann seine Ambivalenzen deutlich formulieren:
»Die Annahme, dass man eine Fortsetzung eines vorherigen Menschen, nichts weniger als eines buddhistischen Meisters, sei, ist ein zweischneidiges Schwert. Obwohl es einem ein unterschiedliches Verständnis von Familie und Verwandtschaft vermittelt, kann es auch eine schwere Last von Erwartungen mit sich bringen« (Ary 2013, S. 420).
Von Ary wurde erwartet, dass er sich nicht wie ein Kind, sondern wie sein erwachsener Vorgänger verhält. Auch musste er größere Verantwortung übernehmen. Ary zufolge sagte der Dalai Lama wiederholt, dass er nicht sicher sei, ob die Identifikation von Tulkus im Westen eine gute Idee sei (Ary 2013, S. 427). Aus der Sicht der modernen Kinderpsychologie wäre es lobenswert gewesen, wenn der Dalai Lama verkündet hätte, dass die Idee der Tulkus insgesamt keine gute Lösung für Kinder darstellt. Schon ab einem frühen Alter werden Kinder mit religiösen und elterlichen Erwartungen sowie extremen Projektionen konfrontiert – alle ohne dies selbst zu entscheiden und ohne Einwilligung. Weiterhin werden Kinder in einem frühen und prägenden Alter und zu einem Zeitpunkt von ihren Eltern getrennt, an dem solche Trennungen traumatisch sein und lebenslange Folgen nach sich ziehen können. Dies ist nicht vergleichbar mit einer Situation, in der Kinder sich aus einem eigenen Bedürfnis heraus und aufgrund einer Berufung nach einem spirituellen und kontemplativen Leben sehnen, wie im zuvor zitierten Beispiel der Geschichte von Thich Nhat Hanh.