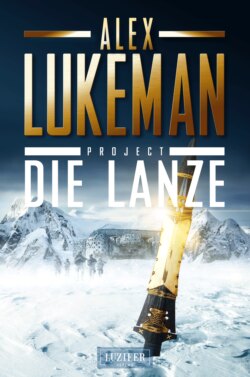Читать книгу DIE LANZE (Project 2) - Alex Lukeman - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 11
ОглавлениеAuf der deutschen Forschungsstation an der Prinzessin-Martha-Küste der Antarktis war der Frühling in vollem Gange. Während der letzten vier Wochen war das Thermometer über den Gefrierpunkt gestiegen. Die Erderwärmung und das Ozonloch waren heiße Themen im Speisesaal.
Die dünner werdende Ozonschicht war Hans Schmidts Fachgebiet. Mit seinen dreißig Jahren war er bereits eine bekannte Größe auf dem wachsenden Gebiet der Umweltstudien. Hans hatte ein gewinnendes, offenes Gesicht, braune Augen und blonde Haare. Über die letzten Monate hatte er seinen Bart wachsen lassen und ein leichter Rotton deutete auf seine Wikinger-Vorfahren. In einem Monat würde er nach Deutschland zurückkehren und seine Jugendliebe, Heidi, heiraten. Das Leben war gut zu Hans.
Er trug hohe, braune Schnürstiefel, eine feste Hose über Thermounterwäsche, zwei Hemden und eine offene rote Jacke. Dazu hatte er eine fellgefütterte Mütze mit oben zusammengebundenen Ohrenklappen. Antarktisches Wetter konnte selbst in den wärmeren Monaten jederzeit umschlagen.
Er hatte sich für die Benutzung einer Schneeraupe angemeldet und Otto Bremen, den Chef der Station und leitenden Geophysiker, überredet, sich mit ihm ins Landesinnere zu den Bergen der Fenriskjeften, dem »Maul von Fenris«, benannt nach dem riesigen, heißhungrigen Wolf der nordischen Mythen, zu begeben. Es war noch weitestgehend nicht erkundetes Territorium.
Bremen war älter, Anfang fünfzig. Er war stämmig und kleiner als Hans. Sein Gesicht war rund und fröhlich, was ihm schon oft eine Rolle als Weihnachtsmann beschert hatte. Über seinen blauen Augen hatte er buschige Augenbrauen, die langsam weiß wurden und seine großen Ohren hielten eine etwas schief sitzende Brille mit Silberrand. Er trug einen gefütterten, gelben Parker, auf dessen Schulter die deutsche Flagge gestickt war. Dazu trug er feste Stiefel und robuste Hosen.
Sie fuhren aus der Garagenhöhle, die in das Eis unter der Station gegraben war, und hielten auf die Berge zu. Die Heizung in der hohen Kabine des Tucker Sno-Cat war bei dem guten Wetter auf niedrig gestellt. Hans öffnete ein Fenster einen Spalt weit, um frische Luft hereinzulassen. Der Tucker war eines von drei identischen Fahrzeugen, die Eric Reinhardt, ein wohlhabender amerikanischer Geschäftsmann deutscher Abstammung, der Station gespendet hatte.
Der große Allison Dieselmotor rumpelte mit einem zufriedenen Dröhnen vor sich hin. Sie fuhren über den Schnee und das Eis zu den eine Stunde entfernten Bergen. Mit seinen beiden 60 Gallonen Tanks, der geschlossenen Kabine und dem großzügigen Stauraum war der Tucker in diesem Teil der Welt wie ein Rolls Royce.
Bremen hantierte mit einem weiteren Geschenk von Reinhardt herum, einem experimentellen Gerät, das mittels Ultraschall Mineralablagerungen entdecken sollte. Die Fenrisberge würden eine gute Testgelegenheit bieten. Bis jetzt hatte im antarktischen Eis noch niemand etwas Erwähnenswertes gefunden, nur ein wenig Eisen und etwas Kupfer. Nichts davon versprach eine kommerzielle Erschließung. Abgesehen davon verhinderte der Antarktisvertrag jegliche größeren Bergbauunterfangen.
Die große Schneeraupe näherte sich den Bergen und Hans hielt sich parallel zu diesen, während er nach irgendetwas ungewöhnlichem im schmelzenden Schnee und Eis Ausschau hielt. Nach zehn Minuten fing das Mineral-Suchgerät zu piepen an.
»Vor uns«, sagte Otto. »Laut dem Gerät nur etwa drei- oder vierhundert Meter.« Er schaute auf ein Diagramm. »Eine hohe Dichte an Eisen und Kupfer, die Anzeige spielt verrückt.«
»Schau mal, dort!« Hans deutete durch die Windschutzscheibe.
Er verlangsamte und brachte den Tucker zu Stehen. An der Seite von einem der gezackten Gipfel hatten sich Eis und Schnee in der Frühlingsschmelze gelöst. Ein grauer, regelmäßiger Umriss zeichnete sich vor dem dunklen Fels ab.
»Was zur Hölle ist das denn?« Hans ließ den Motor im Leerlauf.
»Keine Ahnung. Sieht aus wie von Menschen gemacht. Genau dorthin weist das Gerät.«
»Ich weiß von keiner Station und auch von keinem Camp, die hier gewesen sein könnten.«
Stationen wurden in der Antarktis häufig aufgegeben und verlassen. Beide Männer waren mit der Geschichte der Region vertraut und keiner von ihnen hatte je von irgendetwas hier gehört.
Sie kletterten aus der Kabine und gingen auf die Bergwand zu. Im Fels befanden sich zwei breite Türen aus rostendem Stahl, jeweils gute drei Meter fünfzig hoch. Eis und Schnee blockierten den unteren Teil der Türen.
Beiden Männern war ihre Aufregung anzusehen.
»Was meinst du?«, fragte Otto. »Kommen wir da rein?«
»Vielleicht können wir den Zugang freiräumen.«
»Versuchen wir es.«
Die Schneeraupe war vorn mit einer schweren Schaufel ausgestattet, die sie normalerweise nutzten, um die Landebahn für die Versorgungsflugzeuge in Schuss zu halten. Otto und Hans kletterten zurück in die Kabine. Hans legte einen Gang ein und manövrierte den Tucker zu den Türen. Er senkte die Schaufel und begann mit der Arbeit. Nach zwanzig Minuten war der Zugang freigeräumt.
Die Männer standen vor den Türen. An beiden befand sich jeweils ein großer U-förmiger Griff.
»Sie müssen nach innen aufgehen.« Hans rieb sich mit seinem Handschuh über das Gesicht. »Niemand würde Türen haben, die sich nach außen öffnen. Die würden vom Schnee blockiert werden.«
»Ich frage mich, ob sie verschlossen sind.«
»Wogegen? Pinguine? Probieren wir es aus, dann werden wir ja sehen.«
Sie stemmten sich mit aller Kraft gegen eine der Türen, bis sie sich mit einem rostigen Quietschen öffnete. Nun drückten sie auch noch die andere Tür nach innen. Dahinter lag Dunkelheit.
Hans ging zurück zum Tucker und wendete ihn, sodass er direkt auf den Eingang ausgerichtet war. Er schaltete die sechs Halogen-Scheinwerfer ein und stellte auf Fernlicht. Das Innere erstrahlte in brillantem weißem Licht. Er griff sich zwei Taschenlampen aus der Kabine und ging zu Otto.
Ein hoher Tunnel verlief schnurgerade in den Berg hinein. Lange erloschene, elektrische Glühbirnen waren in regelmäßigen Abständen in der Mitte der Decke angebracht.
»Wer auch immer das gebaut hat, hat sich direkt in den Berg gegraben.«
»Wofür könnte es nur gewesen sein?«, fragte Otto. »Das ist riesig. Dafür benötigte man eine Menge an Ausrüstung. Ich habe nie von irgendwas dieser Art hier gehört.«
Ein Stück im Innern blieb Hans an einem Raum zu ihrer Rechten stehen.
»Das könnte ein Wachraum gewesen sein.« Er deutete auf einen frostbedeckten Ofen in der Ecke. »Das sieht wie etwas von vor sechzig oder siebzig Jahren aus.«
»Ein Militärstützpunkt? Wozu? Wer hat ihn gebaut?«
Auf der anderen Seite des Korridors befand sich eine Küche mit Essbereich, groß genug für etwa hundert Mann. Sie passierten zwei Kasernenräume mit grauen Holzspinden neben Militärbetten. Hans öffnete einen Spind. Leer.
Sie gingen den Korridor entlang, vorbei an Räumen, die vermutlich Offiziersquartiere waren, mit jeweils nur zwei Militärbetten pro Zimmer. Sie gelangten an einen Funkraum. Ein Mikrofon und eine Telegrafen-Taste befanden sich dort noch auf einem Metalltisch, neben einer großen Sender-Konsole, die über Kabel mit einem hohen Gestell voller Empfänger und Test-Ausrüstung verbunden war. Neben dem Sender befand sich eine Holzkiste. Otto öffnete die Kiste. Darin befand sich so etwas wie eine Schreibmaschine, mit einer komplexen Anordnung von Buchstaben und Knöpfen.
Alles war von einer dicken weißen Frostschicht überzogen. Otto wischte über die Vorderseite des verstummten Senders. Die Schalter waren auf Deutsch beschriftet. Beide Männer sahen das Hakenkreuz zur gleichen Zeit.
»Heilige Scheiße! Das muss Dönitz' geheime Basis sein!«
Großadmiral Karl Dönitz, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine in Nazi-Deutschland, hatte einmal »eine unbezwingbare Festung in der Antarktis« erwähnt, aber niemand hatte jemals einen Beweis für ihre Existenz finden können. Jetzt standen Otto und Hans in dieser Festung.
Hans griff nach einem Logbuch, das auf dem Tisch lag. Er blätterte hindurch, ohne die Wörter aufzunehmen, legte es wieder hin.
»Dieser Kurzwellen-Kram war in den Vierzigern der neueste Stand der Technik«, sagte Otto. »Schau dir die Größe von dem Sender an. Das müssen mindestens zwei Kilowatt sein. Es gab seit dem Krieg Gerüchte von diesem Ort, aber keiner wusste jemals, wo er war oder ob es ihn tatsächlich gab.«
»In Berlin wird man nicht gerade glücklich sein über das hier.«
»Keiner möchte noch über den Nazi-Scheiß nachdenken. Was sie damit machen, ist ihre Sache. Aber wir müssen es melden.«
Sie verließen den Funkraum und gingen weiter den Gang hinunter. Im nächsten Raum befanden sich zwei große Dieselgeneratoren, still und kalt. Abgasrohre verschwanden in der Decke.
Weiter unten im Tunnel befanden sich vier weitere Räume an den Seiten. Drei waren leer. Der vierte enthielt sechs große Holzkisten, die alle mit einem Adler und einem Hakenkreuz markiert waren. Hans wischte den Frost von einer der Beschriftungen.
Er schaute zu Otto. »Da steht Küchenzubehör.«
»Das ist eine Menge an Zubehör.«
In einer Ecke entdeckte Otto eine lange Brechstange, die gegen die eisige Wand gelehnt war. Er griff danach und brach den Deckel einer Kiste auf. Er leuchtete mit seiner Taschenlampe hinein.
»Kein Küchenzubehör. Sieh dir das an!«
Die Kiste war mit Gemälden gefüllt. Sie spähten hinein.
»Das ist ein Vermeer!«, sagte Hans. »Ich erkenne den Stil. Oder es ist eine verdammt gute Kopie.«
»Keiner würde hier eine Kopie verstauen.« Otto brachte den Deckel wieder auf der Kiste an. »Das Gemälde ist ein Vermögen wert. Es muss während des Krieges gestohlen worden sein. Ich würde wetten, alle diese Kisten sind voller Dinge, die die Nazis gestohlen haben.«
Sie gingen den Tunnel entlang, vorbei an zwei großen, verschlossenen Türen zu ihrer Linken. Die Türen bewegten sich nicht, als Otto versuchte, sie zu öffnen. Am Ende des Korridors gelangten sie an eine Stahltür mit einem Speichenrad und einer Zahlenscheibe.
Hans versuchte, das Rad zu drehen, aber es ließ sich nicht bewegen.
»Wenn sie Gemälde im Wert von Millionen außerhalb dieses Tresors gelassen haben, was könnte dann da drinnen sein?«
Otto zuckte mit den Schultern. »Wer weiß? Wir sollten besser zurückkehren und den anderen Bescheid geben. Das wird unsere Forschungszeiten total durcheinanderbringen, sobald Berlin Leute schickt, um sich all das hier anzusehen.«
»Betrachte es von der positiven Seite. Es gibt bestimmt einen Finderlohn für die Kunstwerke. Vielleicht fällt dabei eine anständige Finanzierung für uns ab. Außerdem sorgt es für Publicity. Das schadet nie.«
In der Wissenschaftswelt war Ruhm etwas Gutes. Beide Männer glaubten, dass die Zukunft soeben um einiges vielversprechender geworden war.
Zurück auf der Station kontaktierte Otto Berlin über Satellit und berichtete von ihrem Fund. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, dass noch jemand anderes zuhören könnte.