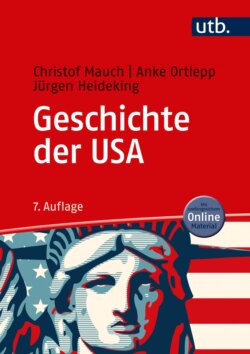Читать книгу Geschichte der USA - Anke Ortlepp - Страница 14
Gemeinsame englische Institutionen und KulturKulturKolonialzeit
ОглавлениеNeben verstärkter zentraler Kontrolle wirkten aber noch andere, möglicherweise wichtigere Elemente dem Auseinanderdriften der Kolonien entgegen. Zum einen bildete sich im politischen Leben eine gewisse institutionelle Gleichförmigkeit heraus, die auf das Vorbild des englischenGroßbritannien Parlaments zurückzuführen ist. So gaben sich im Laufe der Zeit fast alle Kolonien ein legislatives Zweikammer-System, in dem ein vom Volk (d.h. von den Grundbesitzern und Steuerzahlern) gewähltes Unterhaus (Assembly oder House of Representatives) das Gegengewicht zum Gouverneur, zum Gouverneursrat (dem Oberhaus oder Senat) und zur königlichen BürokratieRegierungssystemBürokratie bildete. Im Vergleich zu EnglandGroßbritannien war die Basis der Repräsentation sehr breit, denn trotz der Zensusbestimmungen konnten im 18. Jahrhundert 50–80 Prozent der erwachsenen weißen Männer aktiv am politischen Leben teilnehmen. In NeuenglandNeuengland (s.a. Nordosten, Regionen) hatte jede Gemeinde (Town) das Recht, einen oder zwei Abgeordnete ins Kolonialparlament zu schicken; in der Mitte und im SüdenSüden erfolgte die Wahl auf der Ebene der Kreise (Counties) oder Kirchengemeinden (Parishes). Parallel zum Machtgewinn des Westminster-Parlaments trotzten die kolonialen Assemblies den Gouverneuren immer mehr Befugnisse ab, insbesondere im Steuerwesen. Sie bestanden auch, wie das englische Parlament, auf der schriftlichen Fixierung von Rechten und Privilegien, die zum Ausgangspunkt für spätere Grundrechtserklärungen (Bills of Rights) werden konnten. Von New HampshireNew Hampshire bis GeorgiaGeorgia machte das Tauziehen zwischen den Parlamenten und den Gouverneuren einen wesentlichen Teil der kolonialen Politik im 18. Jahrhundert aus. Sowohl die Strukturen als auch die Praktiken und Konflikte des englischenGroßbritannien RegierungssystemsRegierungssystem waren also den meisten Siedlern gut vertraut und bildeten sich bis zu einem gewissen Grade in Nordamerika wieder ab.
Als weitere Bindemittel kamen das englische Gewohnheitsrecht (common lawCommon Law) und die englische Sprache hinzu. Da das gesamte Gerichtswesen auf dem common lawCommon Law beruhte, wurden seine Regeln auch für diejenigen Siedler verbindlich, die aus anderen, kontinentaleuropäischen Rechtskulturen kamen. Die englische SpracheKulturKolonialzeit mussten sie lernen, wenn sie am politischen Leben der Kolonien teilnehmen wollten. KulturellKulturKolonialzeit bewahrten sich beispielsweise die DeutschenEinwanderungEthnienDeutsche in PennsylvaniaPennsylvania und die Niederländer in New YorkNew York ein großes Maß an Autonomie, doch die Abgeordneten, die sie in die Parlamente schickten, um ihre Interessen zu vertreten, waren allesamt zweisprachig. Das ebenso hartnäckige wie falsche Gerücht, Deutsch wäre beinahe die offizielle Sprache der Vereinigten Staaten geworden, geht auf historische Missverständnisse, z.T. auch auf bewusste nationalistische Propaganda im Kaiserreich und in der NS-Zeit zurück. In Pennsylvania und MarylandMaryland erschienen ab Mitte des 18. Jahrhunderts deutschsprachige Zeitungen, und die Gesetze beider Kolonien wurden sowohl in deutscherEinwanderungEthnienDeutsche als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Alle Parlamentsdebatten fanden aber auf Englisch statt, und wer über das Geschehen in den Kolonien und Europa informiert sein wollte, der tat gut daran, eine der bedeutenden englischsprachigen Zeitungen zu abonnieren. Solche „Gazetten“ wurden kostenlos vom Postdienst befördert, den die englische Kolonialverwaltung seit 1710 aufbaute und den Benjamin FranklinFranklin, Benjamin als königlicher Postmaster General in den 1750er Jahren wesentlich erweiterte. In einer Zeit, als die Kutschfahrt von New York nach PhiladelphiaPhiladelphia drei Tage oder länger dauerte, waren solche Verbindungen für das Zusammengehörigkeitsgefühl besonders wichtig.
Die gebildeten Kolonisten verstanden sich als Angehörige einer transatlantischen KulturgemeinschaftKulturKolonialzeit und nahmen durchaus aktiv an den geistigen Bewegungen und Auseinandersetzungen der Europäer teil. Das betraf die AufklärungAufklärung, die in PhiladelphiaPhiladelphia besonders starke Resonanz fand, ebenso wie den Pietismus, der das Great AwakeningGreat Awakening beeinflusste. Viele Söhne wohlhabender Familien absolvierten ihr Studium in EnglandGroßbritannien, und die neueste englische und französische LiteraturKulturKolonialzeit erreichte in relativ kurzer Zeit amerikanische Leser. Besondere Aufmerksamkeit fanden – neben den Werken von BlackstoneBlackstone, Sir William, HumeHume, David und MontesquieuMontesquieu, Charles de Secondat, Baron de – englische politische Schriftsteller, die das Zeitgeschehen kritisch kommentierten. Bezeichnenderweise wurde in NeuenglandNeuengland (s.a. Nordosten, Regionen) und den Mittelkolonien die radikale Form dieser Kritik (vorgetragen von den Real WhigsWhig-Partei und Commonwealthmen) stärker rezipiert als ihre gemäßigte Variante in Form der Country-IdeologieCountry-Ideologie eines Lord BolingbrokeBolingbroke, Henry St. John, Viscount, die dafür im SüdenSüden besser ankam. Ob diese intellektuellenKulturKolonialzeit Einflüsse allerdings schon ein amerikanisches Sonderbewusstsein entstehen ließen oder ob sie das gemeinsame englische Erbe festigten, ist schwer zu ermessen.
In PhiladelphiaPhiladelphia, das sich nach 1720 zur kulturellen Hauptstadt der Festlandskolonien entwickelte, wurden aufklärerische Ideen am entschiedensten in praktische Neuerungen umgesetzt. Diese Vorrangstellung der QuäkerQuäker-Kolonie ist eng mit der Person Benjamin FranklinsFranklin, Benjamin verbunden, der nach der Jahrhundertmitte, als er sich lange Zeit in diplomatischer Mission in LondonLondon und ParisParis aufhielt, zur Leitfigur einer praktisch-gemäßigten amerikanischen AufklärungKulturKolonialzeitAufklärung avancierte. FranklinFranklin, Benjamin neigte seit seiner ersten Englandreise 1724/25 dem Deismus zu, verzichtete aber auf religiöse Spekulation und konzentrierte sich auf sein berufliches Fortkommen. Im Poor Richard’s Almanack säkularisierte er ab 1732 calvinistischeCalvinisten Tugenden und übermittelte den Zeitgenossen Verhaltensregeln und Lebensweisheiten, die zu einem Leitfaden für den amerikanischen self-made man wurden. Nach dem Aufstieg zum angesehensten Buchdrucker und Zeitungsverleger Nordamerikas konnte er sich 1748 aus dem Geschäftsleben zurückziehen und seinen wissenschaftlichen und politischen Interessen widmen. Große Bedeutung für die Verbreitung aufklärerischen Gedankenguts erlangten die von ihm 1743 organisierte American Philosophical Society, die Library CompanyLibrary Company als erste öffentliche Bibliothek in den Kolonien sowie das College of PhiladelphiaKulturKolonialzeit. Um FranklinFranklin, Benjamin bildete sich ein Kreis von Aufklärern, aus dem der Astronom David RittenhouseRittenhouse, David, der Arzt Benjamin RushRush, Benjamin, der Literat Francis HopkinsonHopkinson, Francis und die Künstler Benjamin WestWest, Benjamin und Charles Willson PealePeale, Charles Willson herausragten. Sie hielten Verbindung mit gleich gesinnten Persönlichkeiten und Gruppen in den anderen Kolonien und korrespondierten mit aufklärerischen Organisationen und wissenschaftlichen Akademien in Europa. In der ebenso vitalen wie toleranten und weltlich geprägten Atmosphäre Philadelphias vollzog sich die Gleichsetzung von Amerika, naturwissenschaftlicher Erkenntnis und sozialem Fortschritt, die das öffentliche Bewusstsein der Revolutionsepoche prägen sollte. Das puritanische NeuenglandNeuengland (s.a. Nordosten, Regionen) konnte auf diesem Gebiet trotz des relativ hohen BildungsniveausBildungswesenKulturKolonialzeit nicht ganz mithalten: Erst 1780 gründete der Rechtsanwalt und Politiker John AdamsAdams, John in BostonBoston die American Academy of Arts and SciencesAmerican Academy of Arts and Sciences als Gegenstück zur American Philosophical SocietyAmerican Philosophical Society.