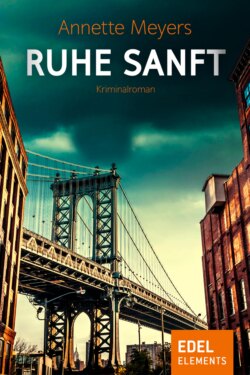Читать книгу Ruhe sanft - Annette Meyers - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWetzon ging gern im Schnee spazieren, besonders in diesem weichen weißen Pulver, das herabschwebte, unverbindlich Gesicht und Kleider bestäubte und woandershin flog, wann immer sie stehenblieb, um sich abzuschütteln.
Der Wind hatte ein wenig nachgelassen. Der Verkehr war schwach, als hätten die Leute den Wetterbericht gehört und beschlossen, nicht in die Stadt zu kommen. Im oberen Teil der Park Avenue waren die Bäume auf den Inseln in der Mitte schon in Weiß gekleidet. Schneeflocken blieben an Wetzons Wimpern hängen, lagen feucht auf ihren Lippen und Wangen.
New York ist wirklich schön bei seiner ersten Begegnung im Jahr mit dem Schnee, dann zeigt es sich beinahe von seiner besten Seite. Aber im Lauf des Winters verändern sich die Stadt und der Schnee – sie werden schmutzig, eisig und gefährlich. Häßlich. Wie die Menschen, dachte Wetzon. Und dann rügte sie sich selbst. Halt, halt, warum plötzlich so zynisch, Kleines?
»Hallo, Kate, hallo, Steve«, sagte sie laut und hob grüßend die rechte Hand, als sie am Haus der Hepburn und dann an Sondheims vorbeiging, die nebeneinander in der 49. Street standen. Die Straße war ungewöhnlich still. Der Schnee dämpfte alle Geräusche, und außer ein paar Verrückten war niemand draußen. »Uff!« sagte sie wiederum laut, in dem wunderbaren Gefühl des Alleinseins schwelgend, das man nur erleben kann, wenn man mitten in einem Schneeschauer durch eine New Yorker Straße geht. Die Stille war wirklich herrlich. Gesprochene Worte kamen als weiße Fahne hervor und trugen nicht weit vom Sprecher.
Sie blickte sich um. Ein Stück weit weg sah sie die einsame Gestalt eines Mannes im Trenchcoat, der einen Schirm hielt. Während sie hinsah, klappte er ihn immer wieder zu und auf und versuchte vergebens, den angesammelten Schnee abzuschütteln.
Auf der Second Avenue bewegten sich die Fahrzeuge im Schneckentempo Richtung Süden, während die Schneedecke dicker wurde. Hupen tönten wie Nebelhörner, mehr zur Warnung als aus Ärger.
Sie seufzte. Es würde im Lauf des Tages nur schlimmer werden.
Sie trat den Schnee von den Stiefeln ab und drehte sich vorsichtig, damit sie nicht den Halt verlor, im Kreis, um den restlichen Schnee zu entfernen, bevor sie die Tür zum Büro öffnete.
B. B. sah auf, den Telefonhörer am Ohr, und lächelte. Mit dem kurzgeschorenen Haar und der athletischen Figur sah er mehr nach einem Marineinfanteristen als nach einem Headhunter in Ausbildung aus.
»Sekunde, bitte«, sagte er höflich, aber bestimmt ins Telefon. Er legte seine Hand über die Sprechmuschel. »Guten Morgen, Wetzon.«
»Guten Morgen, B. B.«, sagte sie, während sie den Mantel weghängte und leise zählte, »drei, vier …«
»Guten Morgen, Wetzon!« Harold schoß aus dem Kämmerchen, das sie für ihn im Vorzimmer eingebaut hatten, als B. B. eingestellt worden war.
»Fünf«, sagte Wetzon, als sie sich zu Harold umdrehte. Er hatte weniger als fünf Sekunden gebraucht, um Punkte bei ihr gutzumachen. Er wetteiferte so fleißig mit B. B., als habe er vergessen, daß B. B. eingestellt worden war, weil Harold endlich als Headhunter und mit eigenen Kandidaten arbeiten wollte.
»Guten Morgen, Harold«, sagte sie. »Wie geht’s, wie steht’s? Hast du nicht heute morgen jemand zum Gespräch bei Bache?«
»Wir mußten wegen des Wetters absagen. Ein Stau auf dem Long Island Expressway.«
»Kein Grund, warum es ausgerechnet heute anders sein sollte.« Es gab immer irgendwo auf dem Long Island Expressway einen Stau. »Zu dumm. Versuche, so bald wie möglich einen neuen Termin anzusetzen. Sonst noch wer? Stehen bei dir heute Gespräche an?« Sie öffnete die Tür zu dem Büro, das sie mit Smith teilte.
»Nein«, antwortete Harry bedrückt und zog sich in sein Kabuff zurück. »Das Wetter hat mich richtig lahmgelegt.«
»Mein Name ist Bailey Balaban«, sagte B. B., »und ich arbeite für Smith und Wetzon … wir machen Personalberatung in der Wall Street …«
Wetzon schloß die Tür hinter sich. Sie liebte ihr Büro. Alles war schwarz und weiß und rot. Schwarze Vinylfliesen auf dem Boden, weiße Wände und Regale, weiße Aktenschränke und rote Arbeitsflächen. Ihr Teil des Raums war ein bißchen vollgestopfter als Smith’ Teil, mit Erinnerungen aus ihrem früheren Leben als Broadwaytänzerin, altem Krimskrams, den sie mit den Jahren auf Flohmärkten gesammelt hatte, zwei eigenartig aussehenden Aloes mit langen Ranken und Stapeln von Zeitungen, Zeitschriften und »Fahndungsbogen« mit Interviews von potentiellen Kandidaten.
Smith’ Bereich war ordentlicher. Kundenakten, mehrere Bilder von ihrem Sohn Mark in unterschiedlichem Alter und eine Prominentenkarte von Connecticut, auf der verzeichnet war, wo die tollen Leute wohnten.
»Himmel, da bist du ja endlich«, rief Smith. »Was für ein Tag, und es ist nicht einmal zehn Uhr! Alle Welt sagt ab.« Sie stand auf, um Wetzon herzlich zu umarmen. Smith sah phantastisch aus – groß, schlank, Kleidung von Donna Karan, wadenlanger Faltenrock aus schwarzem Wolljersey, dunkelroter Rollkragenpullover, lange schwarze Jacke und hohe schwarze Lederstiefel.
»Umwerfend, wie immer«, sagte Wetzon, indem sie die Umarmung erwiderte. »Wie viele Termine hatten wir?« Sie wandte sich ab, um die Nachrichten für sich durchzusehen. Hazel hatte angerufen.
»Termine? Keine Termine. Meine Party.«
»Was, Smith, wer hat denn abgesagt?« Smith’ Party war ihr ziemlich gleichgültig. Sie dachte an Hazel.
»Die Crowleys zum Beispiel und Gordon Harworth.«
»Na ja, die Crowleys wohnen in Wilton, damit mußte man rechnen, in Connecticut sieht es sicher schlimm aus. Und Gordon Harworth war, wenn ich mich recht entsinne, die ganze Woche in D.C., um wieder über die illegalen Machenschaften in der Branche auszusagen. Noch jemand?«
»Bis jetzt noch nicht, aber ich weiß einfach, daß noch welche absagen.«
»Also wirklich, Smith! Gestern hast du noch überlegt, ob du nicht zu viele eingeladen hast.«
»Du hast recht. Ich werde mir vorerst keine Sorgen machen. Wie war das Gespräch?«
»Verrückt. Er möchte wechseln, aber er kann nicht weg … weil – hör gut zu – weil er für das FBI arbeitet …«
»Was? Was hast du gesagt?« Einen Augenblick lang vergaß Smith ihre Party völlig und war ganz Ohr.
»Du hast richtig gehört. Kannst du das glauben? Er kam mir auch nicht besonders intelligent vor.«
»Wahrscheinlich lügt er«, meinte Smith. »Die lügen doch alle. Bestimmt hat er ein Problem, das Übliche, Konflikte mit der SEC, unbefugter Handel oder sonst was.«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Bei L. L. Rosenkind ist irgendeine Gaunerei im Gange, in die ein paar Makler verwickelt sind, jedenfalls deutete er das an. Ich glaube, er wollte herausbekommen, ob er irgendwo hingehen könnte, nachdem …«
»Nachdem was?«
»Nachdem die Ermittlung abgeschlossen ist.«
»Na, wenn das wahr sein sollte, was ich ernstlich bezweifle, hoffe ich, du hast nichts gesagt, was uns in Schwierigkeiten bringen könnte«, erwiderte Smith grimmig. »Die Tarockkarten haben mich gewarnt …«
»Smith, wovon redest du überhaupt?«
»Weil er vermutlich, falls er für das FBI arbeitet, ein Mikro hatte.« Sie kehrte Wetzon verärgert den Rücken, um ein Privatgespräch entgegenzunehmen. »Hallo, Zuckerstück«, gurrte sie ins Telefon, »wie geht’s meinem Leonola heute?« Sie sprach mit Leon Ostrow, beider Anwalt und ihr »erster Kavalier«, wie sie ihn manchmal nannte.
Wetzon kam sich dumm vor. Sie versuchte, sich zu erinnern, was sie zu Peter Tormenkov gesagt hatte. Harmloses Zeug, soviel stand fest. Smith war so exzentrisch, daß Wetzon gelernt hatte, einen großen Teil dessen, was sie sagte, nicht ernst zu nehmen. Aber manchmal hatte Smith eben doch recht.
Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und wählte die Nummer, die Hazel hinterlassen hatte.
Was würde Hazel wohl denken, wenn Wetzon sie »Zuckerstück« oder »Hazola« nennen würde? Sie unterdrückte ein Lachen. Gut gemacht, Wetzon. Laß dich nicht von Smith ins Bockshorn jagen.
»Hallo.« Hazels Stimme klang hohl, aber fröhlich.
»Tagchen, meine Freundin«, sagte Wetzon munter.
»Oh, Sie, Leslie. Ich bin so froh, Ihre Stimme zu hören. Es tut mir so leid wegen gestern … daß ich Sie da hinein …«
»Ich möchte keine Entschuldigungen von Ihnen hören, gnädige Frau«, sagte Wetzon mit gespielter Strenge. »Ich bin froh, daß ich mit Ihnen dort war.«
»Es war schrecklich, Leslie. Die arme Peepsie. Ich weiß, daß sie Angst hatte und durch die Krankheit verwirrt war, aber so etwas zu tun …«
»Hazel, vergessen Sie nicht, sie war nicht auf der Höhe. Aber jetzt möchte ich erst einmal was von Ihnen wissen. Wann läßt man Sie raus?«
»Es kann mir gar nicht schnell genug gehen, Leslie. Ich finde Krankenhäuser wirklich scheußlich. Ihr netter Freund Silvestri kommt heute nachmittag wieder vorbei, um mich nach Hause zu bringen. Das war so reizend von Ihnen.«
»Silvestri? Ach so, natürlich.« Was hatte Silvestri vor? »Wann hat er Sie angerufen?«
»Gar nicht. Er kam mich ganz früh heute morgen besuchen.«
»Du lieber Gott, Hazel. Sie müssen ihn für einen Penner gehalten haben. Er sah furchtbar aus.«
»Na, hören Sie, Leslie, nach so langer Zeit sollten Sie wissen, daß mir so etwas egal ist. Ich mag ihn. Und ich verstehe, warum Sie ihn mögen«, fügte sie hinzu.
Wetzon wurde rot. »Um welche Zeit kommt er wieder?« fragte sie aufgeregt.
»So um drei. Machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen, Liebe. Ich bin sehr traurig, aber es geht mir gut. Ich muß einige Dinge für Peepsie regeln … man hat Marion immer noch nicht ausfindig machen können.«
»Hazel, müssen Sie das machen? Ist sonst keiner da?«
»Nur ein Rechtsanwalt, der sie eigentlich nicht kannte. Außerdem möchte ich es.«
»Na gut, ich habe einen Termin so um vier, wenn er nicht abgesagt wird. Das Wetter ist scheußlich, falls Sie es nicht bemerkt haben. Ich habe vor, hochzukommen und kurz bei Ihnen reinzuschauen, bevor ich nach Hause gehe.«
Wetzon spürte Smith’ zornigen Blick, als sie den Hörer auflegte.
»Wetzon«, sagte Smith wutentbrannt, »falls du wegen dieser alten Schachtel zu spät zu meiner Party kommst, bringe ich dich um.«