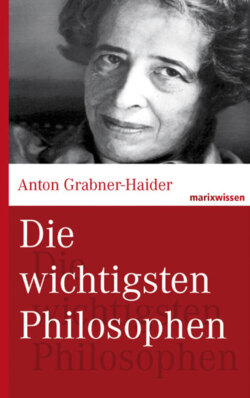Читать книгу Die wichtigsten Philosophen - Anton Grabner-Haider - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9. EPIKUR (341–270 V. CHR.)
ОглавлениеEpikur entstammte einem alten Adelsgeschlecht und wurde auf der Insel Samos, wohin sein Vater etwa zehn Jahre vor seiner Geburt gezogen war, geboren. Im Alter von 14 Jahren sandte ihn sein Vater zwecks besserer Ausbildung zum Demokriteer Nausiphanes nach Teos, und man darf zu Recht vermuten, dass der Grund für seine an Demokrit gemahnende Naturphilosophie zu jener Zeit der Unterweisung gelegt wurde.
Im Jahre 323 ging er nach Athen, um seinen Ephebendienst abzuleisten, doch dürfte er während dieser zwei Jahre auch mit allen wichtigen philosophischen Strömungen jener Zeit vertraut geworden sein. Als er nach seiner Ephebenzeit wieder nach Samos zurückkehrte, traf er die Seinen dort nicht mehr an, da die athenischen Siedler von Perdiccas vertrieben worden waren.
Als er 32 Jahre alt war, entschloss er sich, selbst als Philosophielehrer aufzutreten. Nach wenig glücklichen Versuchen in Mytilene gelang es ihm, in Lampsakos am Hellespont eine große Zahl von Anhängern um sich zu scharen, die ihm im Jahre 306 nach Athen folgten, wo er sich ein Haus mit einem großen Garten kaufte, in dem vor allem philosophiert wurde, was der Gemeinschaft den Beinamen »Die Philosophen im Garten« einbrachte. Dort blieb er auch bis zu seinem Tode.
Von seinen zahlreichen Werken, man spricht von dreihundert Schriftrollen, sind zumindest drei Lehrbriefe vollständig erhalten. Alle übrigen wurden offensichtlich nach 313 n. Chr. von den Christen als Ausdruck des Heidentums und des Atheismus vernichtet. Im Unterschied zu der Stoa und speziell zu den Skeptikern gilt für Epikur und seine Schule, dass der Schulgründer fast göttliche Verehrung genoss, die ihm vom heterogenen Schülerkreis, zu dem auch Frauen und Sklaven gehörten, bereitwillig entgegengebracht wurde. Seine Schule war sehr straff organisiert, für die Mitglieder gab es feste Regeln und sogar eigene Feiertage. Vor allem aber überragte Epikur alle seine Schüler so sehr, dass sich eine dogmatisch verfestigte Lehre herausbilden konnte, die auch von den auf ihn folgenden Schulhäuptern nicht wesentlich umformuliert wurde.
Bei Epikur steht die Naturerkenntnis nicht um ihrer selbst willen im Zentrum seiner Bemühungen, wie er im Brief an Herodotos bekennt: »… wobei ich zugleich meinem Drange folge, mich unablässig um die Erkenntnis der Natur zu bemühen, um in dieser Tätigkeit ein friedvolles Leben zu finden«.
Unter diesen Aspekt sind alle seine naturwissenschaftlichen Anstrengungen zu subsumieren, die letztlich eine Religionskritik genauso einschließen wie eine Sinnsuche bezüglich des menschlichen Daseins. So sind auch seine Erkenntnisse auf diesem Gebiet nicht originell, wohl aber die sich ergebenden Konsequenzen, etwa im Hinblick auf seine Ethik, die auf einer Kausalitätsbeziehung beruht. Doch auch das teleologische Denken, wie es für Aristoteles typisch ist, wird von Epikur abgelehnt, der sich somit bezüglich seines Weltbildes nur auf die Kausalität stützen möchte. Dies geht schon aus dem ersten Satz seiner kurz gefassten naturwissenschaftlichen Darstellung hervor, wenn er schreibt: »Nichts kann aus dem Nichts entstehen. Andernfalls würde alles aus allem entstehen können, ohne dass es dazu auch nur im Geringsten eines Zeugungsstoffes bedürfte.« Offensichtlich war ihm die Vorstellung einer naturhaften Irregularität ein Gräuel, und eine Harmonie im Kosmos war an strenge Regularitäten mit kausalen Abfolgen gebunden. Der durchgehende Determinismus hatte den enormen Vorteil, dass nun der Kosmos berechenbar war, nicht mehr als Spielball und Laune der Götter oder blindwütiger Gewalten angesehen wurde. Diesen Gedanken drückte vor allem der Konstanz-Satz aus: »Die Gesamtheit des in der Natur Vorhandenen ist nämlich von Anbeginn und in alle Ewigkeit unveränderlich, weil es nichts gibt, in das es sich verändern könnte. Gibt es doch neben dem All nichts, das etwa in es eindringen und eine derartige Ver-wandlung bewirken könnte.«
Gemeingriechisch war seine Ansicht, dass das All aus Körpern und dem leeren Raum dazwischen bestehe und dass die Körper entweder unzusammengesetzt oder zusammengesetzt sind. Demokrit folgt seiner Behauptung: »… folglich müssen die Urdinge unteilbare Wesenheiten (Atome) des Körperlichen sein.«
Dieses statische Weltbild wird auch durch die Charakterisierung der stets in Bewegung befindlichen Atome nicht aufgehoben, da nirgendwo der Aspekt der Metamorphose ausgedrückt wird: »Diese unteilbaren Bestandteile (Atome) sind unaufhörlich durch alle Ewigkeit in Bewegung, teils in weiten Abständen voneinander, teils auf der Stelle schwingend. Letzteres dann, wenn ihre eigene Drehung sie gewissermaßen an den Ort fesselt oder wenn sie in den Drehschwung anderer einbezogen sind.«
Zur Vervollständigung seines demokritischen Bildes fehlt nur noch die Bestimmung dessen, was zwischen den Atomen liegt – es ist dies das Leere: »Die Atome prallen beim Zusammenstoß dank ihrer Härte so weit aneinander, als möglich ist, um kraft ihrer Schwungverflechtung wieder an die alte Stelle zurückzukehren. Für diesen Vorgang gibt es jedoch keinen Anfang, denn die Atome sind ewig und ebenso das Leere.«
Wie sehr Atomismus dazu tendiert, mit einem Materialismus verknüpft zu werden, kann am besten bei seiner Behandlung des Erkenntnisproblems gesehen werden, wenn er die schwierige Frage behandelt, wie Sinneseindrücke von Dingen und Gegenständen entstehen. Er geht dabei von einer Abbildtheorie aus, wenn er erklärt: »Es gibt Abdrücke, die den festen Körpern gleichgestellt sind, jedoch durch ihre Zartheit weit verschieden von den Dingen, die durch sie wahrnehmbar werden. Können doch in der uns umgebenden Luft sehr wohl solche Ablösungen vorkommen, auch die zur Schaffung von Unebenheiten und Ebenheiten erforderlichen Anlagen, und es können auch Abströmungen entstehen, welche die Lagerung und Reihung (der Atome) genau so bewahren, wie sie sie im Körper selbst hatten. Diese Ausformungen nennen wir ›Abbildchen‹ (eidôla). Ihr Flug durch das Leere durchmisst, wenn ihm nichts entgegentritt, an das er anprallen könnte, jede erdenkliche Entfernung in unvorstellbar kurzer Zeit; und was uns an ihm wie Verlangsamung oder Beschleunigung erscheint, ist in Wirklichkeit nur das Vorhandensein oder Fehlen eines Hindernisses.«
»Desgleichen muss man annehmen, dass auch der Geruch ebenso wie das Gehör niemals eine Empfindung in uns hervorrufen würden, wenn nicht gewisse von dem Gegenstand ausgehende Massen vorhanden wären, die so eingerichtet sind, dass sie das entsprechende Sinneswerkzeug erregen; wobei die einen eine beunruhigende und unangenehme, die anderen eine beruhigende und freundliche Geruchsempfindung hervorrufen.« Ja, sogar die Bildung der Begriffe geschieht im Sinne natürlicher Lautäußerungen.
Epikur extrapoliert seine atomistische Ansicht nicht nur auf die Sinneseindrücke, sondern auch auf die Seelenvorstellung; er muss dies wohl, um einerseits eine immanente Konsistenz des Lehrgebäudes aufrechtzuerhalten und um andererseits seinen Gedanken von der Sterblichkeit und Vergänglichkeit alles Menschlichen (also auch der Seele) zu untermauern. Wegen seiner Naturwissenschaft hätte man seine Lehre sicherlich nicht von christlicher Seite her so sehr bekämpft, wohl aber wegen seiner Leugnung einer unsterblichen Seele. Dazu führt Epikur aus: »Wenn die ganze Atommasse des Körpers sich auflöst, dann zerstreut sich auch die Seele, besitzt nicht mehr die gleichen Fähigkeiten wie vorher, wird auch nicht mehr erregt, kann also auch nicht mehr wahrnehmen. Denn man kann sie sich nicht als etwas denken, das für sich allein, d.h. außerhalb des zusammengesetzten Ganzen, wahrnimmt und solcher Erregung mächtig ist, wenn die sie bedeckenden und umfassenden Körperbestandteile nicht von der gleichen Beschaffenheit sind wie die, in denen die Seele ihre Erregbarkeit besitzt.«
Epikur überträgt seine atomistische Ansicht auch auf die Seelenvorstellung. Diese atomistisch aufgebaute Seelenlehre, die auch nur eine funktionale Definition kennt, da die Seele unmittelbar an die Funktionsweise der Atommasse gebunden ist, stellt die Basis dar für jene Ansicht, wonach man sich nicht um das Jenseits bekümmern solle, da der Tod nicht sei, wenn wir sind, und vice versa.
In einem eigenartigen Kontrast dazu steht seine Ansicht von den Göttern. Im Brief an Menoikeus findet sich eine Stelle, die deswegen aufhorchen lässt, weil in ihr ein völlig neuer Gottesbegriff vorkommt: »Denn Götter gibt es, da wir sie doch offenbar zu erkennen vermögen. Nur sind sie nicht so, wie die große Menge sie denkt, denn wie sie sich die Götter vorstellt, so sind sie nicht; und nicht der ist gottlos, der die Gottesvorstellung der Masse beseitigt, sondern wer den Göttern die Ansichten der Masse anhängt. Was die Masse über die Götter aussagt, entspricht nämlich nicht der richtigen Gotterkenntnis, sondern falschen Vermutungen.«
Da für ihn Fragen der Ethik im weitesten Sinne, die sich für den Einzelnen – und nicht etwa für die polis oder einen Staat – ergeben können, im Zentrum seiner Überlegungen standen, ist es nicht verwunderlich, dass er bei den vielen verschiedenen Schulrichtungen der Philosophie, die sich alle mehr oder minder stark mit ethischen Fragen abmühten, nicht nur Zustimmung, sondern auch kritische Ablehnung erfuhr. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Epikur selbst auch von allen philosophischen Gegnern stets gewürdigt, ja sogar verehrt wurde. Erst das Christentum brachte den Gesichtspunkt in die Debatte, dass Epikur und sein Kreis eine Aggregation von Prassern und Säufern gewesen seien, die eine ›Philosophie aus dem Bauch‹ gepflogen hätten. Im Zuge der (zumindest in der Theorie) vorgenommenen totalen Abwertung der Lust durch Christen bot sich die epikureische Hochschätzung der hedoné als willkommener Zielpunkt der Kritik geradezu an.
Da seine diesbezüglichen Ansichten offensichtlich schon zu seiner Zeit von philosophischen Konkurrenzunternehmen missverstanden wurden, stellte er im Brief an Menoikeus dezidiert fest: »Wenn wir nun also sagen, dass Freude unser Lebensziel ist, so meinen wir nicht die Freuden der Prasser, denen es ums Genießen schlechthin zu tun ist. Das meinen die Unwissenden oder Leute, die unsere Lehre nicht verstehen oder böswillig missverstehen. Für uns bedeutet Freude: keine Schmerzen haben im körperlichen Bereich und im seelischen Bereich keine Unruhe verspüren. Denn nicht eine endlose Reihe von Trinkgelagen und Festschmausen, nicht das Genießen schöner Knaben und Frauen, auch nicht der Genuss von leckeren Fischen und was ein reichbesetzter Tisch sonst zu bieten vermag schafft ein freudevolles Leben, vielmehr allein das klare Denken, das allem Verlangen und allem Meiden auf den Grund geht und den Wahn vertreibt, der wie ein Wirbelsturm die Seelen erschüttert. An allem Anfang aber steht die Vernunft, unser größtes Gut.«
Werke: Über die Natur; Lehrbriefe, Fragmente der Lehrsätze.