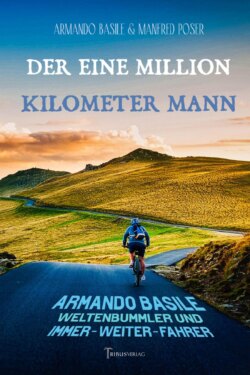Читать книгу Der Eine Million Kilometer Mann - Armando Basile - Страница 10
Der Westmann
ОглавлениеGelesen wurde in Apulien damals wenig, vor Ankunft des amerikanischen Films kam Texas nicht vor. Doch erwähnen sollte man Emilio Salgari (1862-1911), den Veroneser, der wie am Fließband Abenteuergeschichten schrieb, die alle Jugendlichen bis in die 1970-er Jahr hinein kannten. Darunter war auch der Band „Al Polo Australe in Velocipede“ (1896): Mit dem Rad zum Nordpol. Damals schon machten sich Abenteurer mit dem Rad auf, um die Welt zu erobern. Einer von ihnen war Frank Lenz aus Pittsburgh, der ab 1892 20.000 Meilen auf drei Kontinenten zurücklegte, bevor er, wie David V. Herlihy in seinem Tatsachenbericht „The Lost Cyclist“ erzählt, irgendwo in der Türkei verschwand.
Von 1962 bis 1964 wurden Karl-May-Romane verfilmt, mit Lex Barker und Pierre Brice. Armando las als junger Mann vermutlich nicht, darum konnte er auch nicht „Old Shatterhand“ und „Winnetou“ kennen oder die anderen Romane des Radebeulers, der 1842 geboren wurde und 1912 starb. Mays Ruhm hielt sich über viele Jahre des 20. Jahrhunderts, und deutsche Männer im Alter Basiles haben die Geschichten um „Old Shatterhand“ verschlungen (Armandos Biograf, zehn Jahre jünger als dieser, tat es jedenfalls).
Es liegt nicht völlig fern, Armando auch in diesen Romanen zu suchen und zu finden. Im bedeutenden „Winnetou I“ bekommt der Ich-Erzähler, der als Hauslehrer amtiert, den Auftrag, mit Büchse und Pferd einen Vermessungstrupp zu begleiten. Sam Hawkens, ein kleiner Mann mit großer Erfahrung, will das „Greenhorn“ unter seine Fittiche nehmen, und er lacht immer „Hihihihi“ und sagt „wenn ich mich nicht irre“. Ihn fragt der spätere Old Shatterhand, wohin es gehe? „In den Wilden Westen, mit mir! … Immer den Canadian hinauf und nach Texas hinein.“ Hawkens und zwei andere Westmänner sind Kundschafter, und es geht um die Eisenbahn, der man einen Weg in den Westen bahnen will.
Damit gehörte man zu den Abgesandten der wirtschaftlichen Macht im Osten, und im Gefolge hatte man Goldsucher, Glücksspieler, leichte Mädchen und Schwerverbrecher, Hasardeure und Maulhelden, und alle suchten leicht verdientes Geld und eine neue Zukunft. Das Leben war gefährlich, die Waffe saß locker, man ballerte drauflos und rottete so nebenbei fast die Bisons aus. Bevor die Siedler eintrafen, soll es 30 Millionen von ihnen gegeben haben; heute sind es nach der „exzessiven Bejagung“ rund 30.000, ein Tausendstel des Ur-Bestands.
Die US-Armee half, den Weg in den Westen freimachen, und die Ureinwohner (Indianer, weil man zunächst meinte, man habe Indien entdeckt) wurden belogen und betrogen, bekriegt, als primitiv und tierähnlich abqualifiziert, dezimiert (erschossen) und in Reservate gesteckt. Der Ruf Go West! ging mit viel Blutvergießen einher. Man muss sich dessen mit Scham erinnern.
Die Eisenbahn dampfte seit 1869 durch den Kontinent, als die durch Chinesen verlegten Schienen der Central Pacific Railroad mit denen der Union Pacific, die Iren beschäftigte, in Promontory im Bundesstaat Utah zusammenkamen. So sehr die „Railroad“ zum Mythos wurde – heute transportieren manchmal vier Lokomotiven 130 Waggons: Nordamerika wurde ein Land für Flieger und Autofahrer, und Radfahrer überhaupt sind noch seltener als Bisons.
Wenn man in Sam Hawkens im Buch Winnetou Züge von Armando Basile wiedererkennt, würde man ihm in „Durch die Wüste“, dem Auftaktbuch von Mays Orientserie, die Rolle des Hadschi Halef Omar zusprechen. Gleich auf der ersten Seite wird der unentbehrliche Assistent von Kara Ben Nemsi porträtiert, wie immer mit etwas penetrantem Humor. Hadschi Halef Omar war klein, dabei hager und dünn. „Er besaß einen ungewöhnlichen Scharfsinn, viel Mut und Gewandtheit und eine Ausdauer, die ihn selbst die größten Beschwerden überwinden ließ.“ Das klingt sehr nach Armando Basile, der statt Cowboy auch Westmann oder Wüstenreisender sein könnte, auch wenn er selten in der Wüste war. Dafür kennt er den Balkan, wohin Halef Omar seinen Chef in „In den Schluchten des Balkan“ und „Durch das Land der Skipetaren“ begleitet.
Der Vollständigkeit halber seien auch die 736 Kurzromane von Gerd Fritz (G. F.) Unger (1931-2005) erwähnt, dessen Helden Billy Jenkins oder Kirby Starbow heißen. Auch in ihnen fände Armando gut Platz. Der Gute kämpft immer für die Gerechtigkeit, legt sich mit der Macht an und wird schnell zum Outlaw und Desperado, der sich verbergen muss.
Im Comic haben wir da Lucky Luke, der mit seinem Pferd Jolly Jumper im Wilden Westen aufräumt und dem Guten zum Sieg verhilft. Seit 1946 wurden dreißig Millionen Alben des belgischen Zeichners Morris verkauft, was Lucky Luke gleich hinter Asterix rangieren lässt. Der deutsche Zeichner Mawil, 1976 in Ost-Berlin geboren, hat mit seinem 2019 erschienenen Band „Lucky Luke sattelt um“ eine Hommage an den Helden geschaffen. Lucky gerät darin zwischen die Fronten: Ein Hochrad-Förderer will das Rad mit Kettenantrieb stoppen, sogar durch Revolverhelden. Der Held wird von seinem getreuen Pferd getrennt und muss mit einem Rad so schnell wie möglich San Francisco erreichen. Passt auch zu Armando.
Auch Gestalten am Rande der Gesellschaft sind mit Armando verwandt. Der „Hobo“ war ein Wanderarbeiter, der sich mit Güterzügen fortbewegte. Er besaß vielleicht eine Gitarre oder eine Mundharmonika und lebte von der Hand in den Mund, und in Krisenzeiten gab es Tausende von ihnen. Der Radfahrer ist in Amerika immer eine Art Hobo, für den es in Britt im Staat Iowa sogar ein Museum und einen Friedhof gibt.