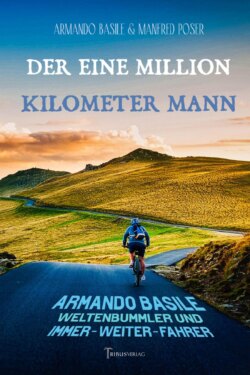Читать книгу Der Eine Million Kilometer Mann - Armando Basile - Страница 16
Der Italiener
ОглавлениеAuf dieser Weltreise, am 6. Februar 2017, brachte ein Flugzeug aus Manila Armando nach Djakarta. Ihm fällt dazu ein:
„Da war ich zum dritten Mal und da habe ich zum zweiten Mal einen Geburtstag ‚gefeiert‘. Ich gönnte mir eine Cola und ein Sandwich. Mehr Feier gab es nicht, auch wenn es mein siebzigster Geburtstag war.“
Armando Basile trinkt keinen Alkohol und raucht nicht. Schokolade und Coca-Cola sind sein einziges Laster. Milch verträgt er nicht, Kaffee nimmt er auch nicht zu sich. Und das will ein Italiener sein? Spaghetti mag er, eine italienische Fahne begleitet ihn, am Rad befestigt, und sein Helm ist in den Farben des Landes, in dem er geboren wurde.
Italien 1947
Dorthin, nach Italien, schauen wir, und wir blicken diese siebzig Jahre zurück, ins Jahr 1947. In Rom drehte Vittorio de Sica seinen Film „Fahrraddiebe“, in dem man sieht, wie hunderte Arbeiter in die Stadt radeln. Ohne Fahrrad kam man nicht vorwärts. Mit einem Fahrrad war man schon ein kleiner König, man konnte sich bewegen und etwas verdienen. In dem preisgekrönten Film klebt Antonio Ricci (Lamberto Maggiorani) in Rom Plakate. Da wird ihm sein Rad gestohlen. Den ganzen Film über suchen er und sein Sohn (Enzo Staiola) den Dieb, am Ende klaut er selber ein Rad, wird gestellt und verprügelt. Harte Zeiten nach dem Krieg in Italien.
„Als Kind habe ich gar kein Fahrrad gehabt. Ich hatte vier Geschwister. Eine Stiefschwester und zwei Stiefbrüder aus der ersten Ehe meines Vaters und noch einen Bruder aus seiner zweiten Ehe, insgesamt waren wir also fünf. Ich war glücklich, habe alles gehabt. Für mich und meinen Bruder wurde alles getan. Als Kinder haben wir immer viereckige Schokolade gekauft, und da waren immer, Medaillen drin, groß wie 2-Euro-Stücke, Coppi, Bartali oder Anquetil, dann haben wir immer gespielt.“
Der 1914 bei Florenz geborene Bartali gewann 1948, als Armando eineinhalb Jahre alt war, nach zehn Jahren Pause wieder die Tour de France, und man meint, er habe dadurch das Volk geeint und eine Staatskrise verhindert. „Gino nazionale“ war das große Idol, war Il Pio, der Fromme und der Schweiger. „Tanta strada nei miei sandali, / quanta n‘avrà fatto Bartali…” So sang Paolo Conte, der am Straßenrand auf Bartali wartet und sang, er sei mindestens ebenso viele Kilometer mit seinen Sandalen gelaufen, wie Bartali auf dem Rad zurückgelegt habe. Die 1950-er Jahre gehörten im Radsport dann eindeutig dem schlaksigen Fausto Coppi, der mit vierzig Jahren starb. Seit 2017 heißt sein Geburtsort, in dem zuletzt zweiundneunzig Seelen lebten, „Castellania Coppi“. Eine seltene Ehrung.
Armando war noch längst kein „König“, als Coppi 1952 „Tour“ und Giro d’Italia gewann, sondern ein kleiner Junge, dem man seinen Vornamen übelnahm. Man wusste, wo man hingehörte.
„Zu Hause haben sie zu mir Fernando gesagt. Meine Oma meinte: Armando ist ein Name für bessere Leute, für die vom Adel… Aber es war zu spät, meine Eltern hatten den Namen schon auf dem Standesamt angemeldet. Heute noch nennen mich alle Verwandten Fernando.“
„Ich bin acht Jahre in der Schule gewesen: Fünf Jahre ‚elementare‘, dann Avviamento, eine Art Berufsschule und drei Jahre Realschule, da hat mein Vater noch gelebt, er war Maurer. Ich half meinem Vater nachmittags schon am Bau, der Boss schenkte mir kleines Taschengeld. Ich war sechzehn als ich die Schule fertig hatte.
Mein Vater hat dann in der Schweiz gearbeitet, in Zug am Zugersee, dann ist es uns besser ergangen. Er fragte mich: ‘Was willst du machen, weiter in die Schule gehen oder mit mir in die Arbeit kommen?‘ Ich habe keine Lust mehr gehabt zu lernen. Mein Kopf war immer schon in der Schweiz, und ich wollte schon immer reisen. Meine besten Fächer in der Schule waren Erdkunde und Sport. Und das passt exakt zu mir!“
„Mein Vater hat mich also nach Zug mitgenommen, weil ich sagte: ‘Ich möchte mit dir kommen, in die Schweiz, und arbeiten. Ich kaufte mir schon in Lecce ein Buch Deutsch-Italienisch und durch die Reise habe ich schon was gelernt. Ich war sechzehn und bin nachher oft alleine gereist.“
O Sole mio
Trotzdem: Italiener sind heiter. Sie singen gern. Vielleicht nicht bei der Arbeit, aber sonst, wenn sie allein sind.
„Wenn ich alleine bin, singe und singe ich, auf Französisch, auf Englisch, auf Deutsch, auf Türkisch: Marina, Marina, Benbeyas, benbeyas, tschokayas, üschüyorum, döngel, döngel arti k istiorum…. Dann Capri, c’est fini, oder Mi sono innamorato di Marina, una ragazza muy carina. Leute bleiben stehen, und besonders Frauen haben es gern, wenn jemand singt, und in den Restaurants singe ich für die Frauen und lasse mich mit ihnen fotografieren.“
Italiener haben Charme. Und sie singen gern. Was man während der vielen Stunden im Sattel denkt, ist eine andere Frage. Man ist halb konzentriert und halb abwesend, die Beine tun von alleine ihren Dienst, angetrieben durch den Willen. Der Geist ist frei, zu wandern. Radfahren ist ein wenig wie Meditation. Man sagt auch, dass Bewegung das beste Mittel dagegen ist, an Alzheimer zu erkranken. Aber auch der Radfahrer ist nicht gegen gelegentliche Ausfälle gefeit.
„In Schweden vergaß ich (2014) meine Geheimnummer der Sparkassenkarte. Hatte sie mit einer anderen durcheinandergebracht. Nichts kam. Karte gesperrt. Ich hatte kein Geld mehr. Dann kam ich an einen Campingplatz, hab ein italienisches Lied gesungen, und eine Frau aus Rom lobte mich. In einem großen Indianerzelt war innen ein Feuer, da war‘s sehr warm, sie sagte, ‘Sie können kommen und den Touristen ein paar Lieder vorsingen.‘ Ich sang alle Lieder, die mir einfielen, habe damit Geld gesammelt und Geld verdient, dann noch in Finnland Blechdosen eingesammelt und in den Laden gebracht und so jeden Tag umgerechnet fünf oder sechs Euro bekommen, um Brot zu kaufen.“
Autos
Ein echter Italiener liebt Automobile. Auch das hat Armando im Blut. In Deutschland kaufte er sich 1987 einen Mercedes, der noch null Kilometer auf dem Tacho hatte, und als seine Mutter in Freiburg starb (sein Vater wurde nur zweiundfünfzig Jahre alt: Leukämie) und in Italien bestattet werden sollte, konnte er mit ihm nur ganz langsam fahren, kaum schneller als mit seinem Fahrrad. Übertrieben hat er es danach mit dem Autofahren nicht, auch wenn’s ein Mercedes war.
„Mein neuer Mercedes, mit dem bin ich in zwanzig Jahren 50.000 Kilometer gefahren, und ich hatte mit dem Rad ein Jahr, in dem ich 53.000 Kilometer gefahren bin. Das war 2011. Der Mercedes war zwanzig Jahre alt und als ich ihn verkaufte, habe ich noch 1000 Euro dafür bekommen. 33.000 Mark hat er damals gekostet. Mir gefällt ein roter Mustang. Das ist das einzige Auto, das mich begeistert. Ich bin durch Kalifornien und sah einen, bremste, und sagte dem Mann, der seine Hand an der Tür hatte: ‘Hi, this is my car.‘ – ‘Oh, congratulations. Yes, I like a Mustang, may I take a photo?’”
Ein Mustang. Heißt ja wie ein Pferd, das unserem Cowboy am Herzen liegt. Auch das Ferrari-Museum in Modena hat er besucht. Daran fährt man als Italiener nicht vorbei.
Essen
Und ein echter Italiener isst gern. Das Essen spielt bei Armando immer eine Rolle. Er spricht oft davon. Länder werden nach ihrer Kost qualifiziert – Thailand gut, Indien schlecht, Türkei gut, Bulgarien schlecht. Wobei man die dauernde Klage des Radfahrers über den trockenen Reis mit der Miniportion Gemüse in Indien relativieren muss: Indien hat eine hervorragende Küche, wie wir nun durch viele Restaurants in Deutschland wissen, nur liefern die Garküchen am Straßenrand gegen geringe Gebühr eben nur karge Kost, die sich arme Inderinnen und Inder noch leisten können. Armando braucht nicht unbedingt Fleisch, aber Spaghetti Bolognese sind ein Traumbild, das ihn in den langen Monaten in Indien verfolgte, und wenn ihn eine Freundin fragt: ‘Was willst du essen, Armando?‘ dann antwortet er: ‘Spaghetti.‘
Italienerinnen und Italiener können ganze Abende nur übers Essen reden, ohne sich auch nur eine Sekunde zu langweilen. Zum Glück haben auch die Germanen Einflüsse vom Mittelmeer aufgenommen, im Fernsehen wird gekocht wie wild, man kennt französische und italienische Rotweine, aber dennoch schrieb ein Autor namens Adam Fletcher in seinen „Zehn Phasen der vollständigen Germanisierung“, man habe es darin weit gebracht, wenn man ein „großes Apfelsaftschorle“ ordere, tüchtig Kartoffeln koche, und überhaupt: Wurst und Brot, Wurst auf Brot, Wurst im Brot, darin erschöpfe sich die deutsche Kochkunst. Armando Basile wird davon ein Lied singen können, doch leistet auch er Entwicklungshilfe.