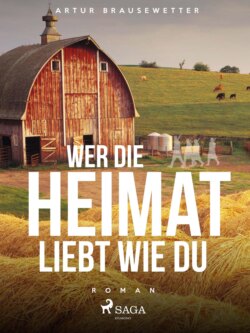Читать книгу Wer die Heimat liebt wie du - Artur Brausewetter - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNach dem Abendessen ging man in das Wohnzimmer, und die Unterhaltung drehte sich um minder ernste Dinge. Etwas harmlos Frohes lag in der Luft und auf den Gesichtern. Fritz hatte ein kleines Geplänkel mit der hübschen Hanna eröffnet, bei dem ihre Samaritertätigkeit wieder eine Rolle spielte. Und sie antwortete ihm so schlagfertig und mit so gutem Witz, dass ihm dieses heitere Duell eine wachsende Freude bereitete. Ihrer beiden Augen leuchteten vor Kampfeslust, der Eintritt der ernsten Männer, die sich in die veränderte Stimmung nicht gleich zu finden wussten, störten sie wenig, sie beachteten ihn kaum und scherzten in der Unbekümmertheit ihrer Jugend weiter.
Ihr froher Sinn ging auch über die Sorgen und Leiden der alten Frau hinweg, die, das müde Haupt an ein Kissen gelehnt, in der Ecke des altertümlichen Sofas sass. Nur ab und zu flog ein kurzer, mitleidiger Blick aus den jungen Mädchenaugen zu ihr hinüber. Warum machte sie sich nur so viele schwere Gedanken? Das Leben war doch so schön und reich! Man musste es nur recht sehen und mit guter Zuversicht anfassen! Ihr Los war doch auch wahrhaftig kein leichtes gewesen. Von früher Kindheit an verwaist und mittellos, nur von der Wohltat der Grosseltern erhalten zu werden — nicht jeder würde es so gefasst auf sich nehmen! Aber sie hatte den Mut nie verloren. Und wenn sie einmal ganz allein dastehen müsste, sie wollte den Kampf nicht fürchten. Ob die Grossmutter immer noch an Fritzens ernste Worte vorher im Garten dachte? Aber sie hatte recht gehabt, sie glaubte ihn einigermassen schon zu kennen: er hatte es so böse nicht gemeint. Er gehörte auch zu den Starken und Mutigen, die, wenn es darauf ankam, keinem Feinde weichen würden. Es stand auf seinen Zügen geschrieben. Sie hatte die Männer gern, die ernst und froh zugleich sein konnten, ein jedes zu seiner Zeit.
Er aber schaute mit Wohlgefallen in ihre Augen. Unter den dichten blonden Haaren, die sich fast bis an ihre Brauen schmiegten, leuchteten sie manchmal wie die Kornblumen im stillen Ährenfeld. Es war das Gesunde, Ländliche und das ländlich Reine, das er in dieser frischen Mädchengestalt fand und liebte.
Hans drängte zum Aufbruch. Die Droschke stand schon vor der Tür. Der Onkel lag gewiss schon im Bett. Aber die Hutemach, die nie schlafen ging, bevor alles im Hause war, würde auf sie warten. Fritz konnte seinem Wink nicht länger widerstehen, er erhob sich endlich und verabschiedete sich mit herzlichen Dankesworten von dem Pfarrer und seiner Frau. Nun reichte er auch Hanna die Hand.
„Auf bessere Nachbarschaft von heute ab! Nicht wahr? Und wenn Sie Ihre Pflicht“ — er legte einen leisen Ton auf dies Wort — „einmal wieder nach Bärwalde führt, dann vergessen Sie nicht, dass da im Gutshause ein alter kränklicher Mann wohnt, dem ein frohes Wort und Gesicht ein wenig Sonnenschein in sein Dunkel bringt. Und — dies natürlich nur nebenbei — auch ein junger, dem nach dem schweren Frondienst auf dem Felde ein wenig Aufmunterung gewiss nicht schaden kann. Oder ist das zu gering für Samaritertätigkeit?“
„Ich werde es mir in mein Merkbuch für Besuche schreiben, vielleicht vergesse ich es dann nicht.“
„Einverstanden und Lebewohl! Oder hoffentlich auf Wiedersehen!“
„Ich freue mich, dass meine brüderliche Mahnung auf so fruchtbaren Boden gefallen ist,“ sagte Hans, als sie beide, eng aneinandergelehnt, auf der kleinen Droschke sassen und die fromme Stute in der Erwartung des heimatlichen Stalles einige kühne Sprünge machte, zu denen sie sich sonst nicht verstieg. „Du wirst dich jetzt um deinen Pfarrer hoffentlich ein wenig mehr kümmern.“
Fritz wusste nicht recht: war es aufrichtige Meinung, die aus den Worten des älteren Bruders sprach, oder versteckte Neckerei? Er wollte es für das erstere nehmen.
„Und ich bin dir dankbar,“ gab er zurück, „dass du mich zu diesem Besuch angeregt hast. Es wird nicht mein letzter gewesen sein.“
Es war das einzige, was Fritz auf der Fahrt sprach. Von da ab war er schweigsam, bis sie nach Hause kamen.
Adl. Malkitten, den 15. September 1913.
Lieber Hans!
Ich möchte Dir heute mitteilen, dass ich mich nach längerer Überlegung entschlossen habe, meine Stellung hier aufzugeben. Meine beiden Jungens, die in einer eben abgehaltenen Prüfung gut abgeschnitten haben, kommen jetzt auf das Gymnasium, und mit einem kleinen Mädchen von sechs Jahren allein und aufs neue wieder anzufangen, habe ich wenig Neigung, obwohl man mich dringend darum bittet. Überhaupt hat die Erfahrung meinem ursprünglichen und Dir öfters geäusserten Empfinden recht gegeben: meine Anlagen und Fähigkeiten eignen sich mehr für das weiblich praktische als für das pädagogische Gebiet. Die Erfolge, die ich hier errungen, liegen mehr in der Begabung und dem eifrigen Streben meiner Zöglinge als in mir begründet.
Deine Briefe, lieber Hans, bereiten mir stets ein herzliches Vergnügen. Allein ich habe immer das Gefühl, als ob bei aller Deiner Freude, wieder in unserm geliebten Ostpreussen zu wirken, doch auch eine wunde Saite in ihnen tönt. Und nun schilt meine schwesterliche Ängstlichkeit, die Dir schon so manchen Verdruss bereitet: aber ich finde, es wird nicht genügend für Dich gesorgt. Du weisst, worauf dies hinaussoll. Schon als Dozent in Bonn batest Du mich wiederholt, zu Dir zu kommen und Deinen Haushalt zu führen. Damals konnte ich nicht. Und, offen gestanden, mein lieber Junge, ich wollte auch nicht. Das Feld, das sich mir bot, war mir, bei aller Liebe für Dich, zu klein. Jetzt bist Du Geistlicher an einer grossen Gemeinde, und was Du mir einige Male andeutetest, verstehe ich sehr gut: es fehlt Dir bei Deiner Arbeit in der Gemeinde an einer weiblichen Helferin.
Also kurz und klar: willst Du mich, so komme ich gern, führe Dir den Haushalt, suche Dir das Leben ein wenig behaglicher zu machen und befriedige meinen Tätigkeitsdrang in der Mitarbeit an den Aufgaben für Deine Gemeinde.
Schreibe mir nun ebenso offen, was Du denkst. Ich bin jeden Augenblick bereit; ja, ich darf hinzufügen, dass der Wunsch, Dir etwas sein zu können und mit Dir gemeinsam zu leben, nicht ohne Einwirkung auf meine Kündigung hier war.
Sei herzlich gegrüsst, alter Junge, von Deiner treuen Schwester
Else.
Nichts konnte Hans willkommener sein als dieser Brief, den er eines Morgens auf seinem Schreibtisch fand. Else hatte das Richtige getroffen. In der Tat, er war einsam. Er vergrübelte sich in den langen Abenden, die er beinah ausnahmslos an seinem Schreibtisch zubrachte, in allerlei geistige Fragen und Probleme; die Mahlzeiten, die er, mässig bereitet, stets allein einnahm, gewährten ihm auch kein Ausruhen, weil er ungehindert seine Gedanken weiterspinnen konnte; manche guten Pläne, mit denen er sich für seine Gemeinde trug, blieben unausgeführt, weil ihm die weibliche Hand fehlte. Wer konnte sie ihm besser bieten als seine Schwester!
Sie war die jüngste von ihnen drei. Als sie Kinder waren, hatte der Altersunterschied ein näheres Verhältnis zwischen ihnen nicht aufkommen lassen. Das trat erst ein, als er zur Arbeit für das zweite theologische Examen in das Haus seiner Mutter, die nun auch längst heimgegangen war, zurückkehrte. Damals war sie siebzehn Jahre, aber von einer Reife, die über ihr Alter hinausging, und von einem Wissensdurst, der sie an manchen seiner Arbeiten mit Verständnis teilnehmen liess. Die treue Kameradschaft, die sie beide ihr ganzes Leben einander bewahrt, hatte damals begonnen. Erst später erfuhr er, dass sie in jenem Winter jede Einladung, jede Aufforderung einer Freundin abgelehnt hatte, um nur die eine Abendstunde, die er für sie frei hatte, mit ihm zusammen zu sein. Sie hatte ihm nie etwas davon gesagt. Nun erfüllte ihn die Aussicht, das alte Verhältnis jetzt, wo er ihrer mehr als je bedurfte, wieder aufbauen zu können, mit aufrichtiger Freude.
Else war gekommen. In der entschlossenen Art, die ihr von je zu eigen war, hatte sie gleich in den ersten Tagen manche Veränderung in dem Hause wie in der Lebensweise des Bruders vorgenommen. Sie leuchteten diesem zuerst nicht ganz ein, aber bald spürte er ihren Nutzen.
Er hatte inzwischen seine Vorlesungen begonnen, für die ihn Bürgermeister Stoltzmann gewonnen hatte, und in denen er in regelmässiger Reihenfolge eine Entwicklung der deutschen Religionsphilosophie von Kant bis auf die heutige Zeit geben wollte. Er hatte diese Arbeit gern übernommen, denn sie führte ihn in die geistigen Kreise zurück, die er verlassen hatte.
Obwohl der Gegenstand nicht leicht war, so waren die Anmeldungen doch in so starker Zahl eingegangen, dass Dr. Stoltzmann den grössten Saal nehmen musste, der ihm in der Stadt zur Verfügung stand.
Hans blätterte die Liste der Teilnehmer durch. Alle bekannten Namen waren in ihr verzeichnet: höhere Beamte mit ihren Damen, Offiziere, viele einzelstehende Frauen, die auch seine Predigten regelmässig hörten, der erste Bürgermeister mit seiner Gattin — nur ein Name fehlte: Edith von Barrnhoff.
Er wusste, dass sie mit dem Beginn des Winters Reckenstein verlassen hatte, weil ihr Vater sich hier in der Stadt einer dauernden Behandlung unterziehen musste. Er hatte sie des öfteren auf der Strasse gesehen, auch einigemal gesprochen. Zeit genug hatte sie — lag eine Absicht in ihrem Fernbleiben? Er musste über sich selber lächeln, dass ihm bei einer so unerwartet grossen Teilnahme das Fehlen eines einzigen Namens Verdruss bereitete.