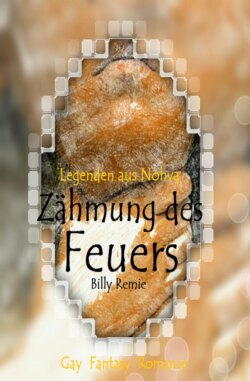Читать книгу Zähmung des Feuers - Billy Remie - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11
Оглавление»Durch die Plünderung des Tempels haben wir die Kriegskassen wieder aufgefüllt«, sagte Lord Schavellen und schwenkte den Weinbecher in seiner Hand, »es dürfte kein Problem darstellen, die Truppen für die bevorstehenden Kämpfe aufzurüsten. Allerdings stehen wir nun vor anderen Problemen. Uns fehlen Männer. Bauern wie Soldaten verlassen scharenweise das Gebirge, nachdem sie alle gesehen haben, wie sich der Blutdrache offenbarte. Ihr solltet zu Eurem Volk sprechen, es zurückgewinnen. Macht ihnen Angst vor dem Drachen.«
»Verzeiht, Lord Schavellen«, König Rahff hatte große Mühe, seinen Unmut gegenüber seines Verbündeten zurückzuhalten, »gewiss habt Ihr Nachsicht mit mir, weil ich gerade alles andere als Gedanken für den Krieg habe. Mein Sohn – mein letzter Sohn, wohl bemerkt – ist verschwunden. Was ich jetzt benötige, sind Männer, die nach ihm suchen.«
Der Lord von Dargard wirkte alles andere als erfreut darüber, aber auch er war imstande, seine wahren Gedanken nicht offen auszusprechen.
Sie saßen gemeinsam an der großen, massiven Tafel im dunklen Versammlungsraum der Schwarzfelsburg, draußen im Hof waren noch die Aufräumarbeiten nach der Verwüstung durch den Drachen zu hören.
»Selbstverständlich, Eure Hoheit«, der Lord neigte ergebend sein Haupt, »ich werde einen Suchtrupp mobilisieren. Wo, sagten die Augenzeugen, sei der Drache abgestürzt?«
»Irgendwo in der Wildnis«, murmelte Cocoun gelangweilt. Er hing in seinem Stuhl und puhlte den Dreck unter seinen Fingernägeln raus, er schien der Besprechung nur körperlich beizuwohnen, sein blondes, kurzes Haar hing ihm ungekämmt in der Stirn.
König Rahff bedachte Lord Schavellen mit einem genervten Blick, der daraufhin seinem verzogenen Sohn unter dem langen Tisch einen Tritt verpasste.
Cocoun zuckte zusammen und blickte seinen Vater verwundert an, bis dieser ihn anfunkelte und mit einem Kopfnicken auf Rahff deutete.
Cocoun sah dem König in die Augen und Rahff stellte abermals fest, dass zu viel Trotz und Auflehnung in dem jungen Mann steckten.
Mit einem falschen Lächeln richtete Cocoun sich in seinem Stuhl etwas auf und lehnte sich mit dem Rücken gegen die gepolsterte, rote Samtlehne. »Verzeiht, Eure Hoheit. Ich war nur kurz in meinen eigenen Gedanken.«
Rahff beschloss, ihn zu ignorieren, und wandte sich lieber wieder Lord Schavellen zu, der zwar fanatisch aber wenigstens berechenbar war.
»So wie ich unseren Feind kenne, wird er erneut zur Festung wollen«, fürchtete Rahff. »Ihr seht also, dass es nicht nur darum geht, Cohen zu retten. Wir dürfen nicht riskieren, dass M`Shier frei herumläuft. Und Clivias Bastard erst recht nicht!«
»Ihr hättet beide töten sollen«, warf der Lord von Dargard ihm vor.
»Ihr hättet ihn nicht zurückbringen dürfen!«, rief Rahff erbost. »Außerdem bin ich kein Mann, der einen Säugling ermordet, oder einen ohnehin besiegten Feind tötet, wenn ich ebenso gut Blutvergießen vermeiden kann. Die Verbannung war ein Akt der Gnade, der, wie Ihr sehr wohl wisst, meiner Beliebtheit nach der Tyrannei meines Vaters dienlich war.«
Schavellen sah ihn überrascht an, weil Rahff ihn für all das verantwortlich mache. Dann wurden seine Lippen schmal und er strich sich arrogant über sein bronzefarbenes Seidenhemd. »Ich wollte ihn töten, Ihr habt ihn hierhergebracht.«
»Er war verbannt und er hielt sich an die Abmachung!«, tadelte Rahff den Lord, allmählich ging ihm mit diesem die Geduld aus. »Er war in Carapuhr. Über zwei Jahrzehnte lang! Das Meer stand zwischen ihm und mir. Und ihr habt, trotz meines Verbots, das Portal benutzt, das erst kürzlich entdeckt, und demnach unerforscht und unberechenbar ist, um Meuchelmörder auszuschicken! Ich musste ihn retten. Und wie ihr seht, stimmen die Gerüchte.«
»Und was wollt ihr jetzt tun?«, fragte Cocoun im gelangweilten Ton. Er sah Rahff in die Augen und zuckte hochnäsig mit den Schultern. »M`Shier ist ein Feind und er hasst uns alle, soweit ich im Bilde bin. Selbst wenn Cohen recht hat, und wir vor einer Bedrohung durch Dämonen stehen, wird uns der Blutdrache niemals helfen.«
Rahff sah ihn mit verengten Augen an. »Cocoun, muss ich Euch etwa verdeutlichen, wie entsetzlich die Folgen für uns wären, sollten wir ihn frei rumlaufen lassen?«
Lord Schavellen pflichtete König Rahff bei. »Nein, nein, das geht nicht. Wenn er sich mit den Rebellen zusammenschließt oder – die Götter mögen uns bewahren – die Festung lebend erreicht, wird er seine Rache vermutlich noch bekommen. Wir können es nicht riskieren, auch nur noch einen Verbündeten zu verlieren.«
Und Rahff wusste nur zu gut, wie viele ihrer angeblichen Verbündeten bedroht wurden, damit sie ihre Treue hielten. Verzweifelt rieb er sich das Gesicht. Sein Königreich stand auf wackligen Beinen.
»Dann töten wir ihn«, sagte Cocoun leichthin. »Ich mache es selbst, wenn Ihr wollt.«
»Und wenn es stimmt, was die Leute flüstern?«, fragte Rahff abfällig. »Sollen wir wirklich die einzige Waffe töten, die den Dämonenfürsten besiegen kann?«
»Wenn es denn einen Fürsten gibt«, warf Cocoun ein, er klang alles andere als davon überzeugt. »Ich meine, hat ihn schon jemand gesehen?«
»Ihr seid ein Narr«, sagte Rahff nur noch zu ihm und drehte sich wieder zu Lord Schavellen, der sich nachdenklich das Kinn rieb.
»Haben wir Mittel, ihn zu fangen?«, fragte Rahff verzweifelt. »Ihn zu bändigen?«
Der Lord sah ihm eine Weile stumm in die Augen, ehe er bedauernd den Kopf schüttelte. »Wie können wir ohne Magie einen Drachen fangen und zähmen, mein König? Die Kirche ließ alle Hexen verbrennen, die praktizierten.«
Ja, natürlich, jetzt war wieder nur die Kirche daran schuld, obwohl Schavellen selbst ein enthusiastischer Hexenverfolger gewesen war.
So eine verdammte Scheiße … Wäre Rahffs Vater nicht schon tot, hätte er ihn jetzt für all das Chaos umgebracht. Hätte er sich kein anderes Fundament als die Kirche für seine Herrschaft aussuchen können? Verflucht seien die Götter, wie sollten sie das überleben?
Rahff stützte das Gesicht in die Hände und trug ihnen auf: »Findet einfach meinen Sohn.«
Cohen war ihm das wichtigste im Leben. Er war sein Erstgeborener, der Sohn, auf den er stolz war wie auf keinen anderen.
Er hatte Raaks und Sevkin verloren, die ihm seine zweite Frau geschenkt hatte, aber obwohl ihr Verlust ihn hart getroffen hatte, war die Vorstellung, Cohen zu verlieren, noch einmal das Tausendfache schlimmer.
Cocoun und Lord Schavellen erhoben sich, ihre Stühle wurden zurückgeschoben, der ansonsten stille Raum wurde von dem Geräusch ratschender Stuhlbeine über Holzboden erfüllt. Langsamen Schrittes trotten sie davon, als habe ihr Auftrag keine Eile.
»Und findet ihn besser lebend«, rief er ihnen nach. Leise fügte er für sich selbst hinzu: »Oder ich hänge euch beide für eure Inkompetenz!«
Wenn Cohen nicht gefunden und zurückgebracht wurde, waren sie alle dem Untergang geweiht. Er war der einzige Mann, dem Rahff es zutraute, Nohva zu regieren. Vielleicht sogar den Krieg zu beenden.
Aber Rahff kannte seinen Sohn sehr gut und er hatte schon seit einiger Zeit – seit Sevkins Hinrichtung, um genau zu sein – bemerkt, dass Cohen nicht mehr der Mann war, zu dem Rahff ihn erzogen hatte.
Cohen hatte schon immer ein eigenes Verständnis für die Welt gehabt. Er war kein Dickkopf, nicht so wie er. Cohen war klug wie seine Mutter, beherrscht, sein Herz saß am rechten Fleck.
Er gehörte nicht auf diese Seite des Krieges, das hatte Rahff von Anfang an gewusst. Sein Sohn war nicht wie diese fanatischen Männer, nicht wie Schavellen und sein Sohn es waren, die dämliche, altmodische Gesetze ausnutzten, um ihre eigene kranke Vorstellung einer gestrickt getrennten Welt durchzusetzen. Cohen war jemand, der nach Gerechtigkeit trachtete, die er auf dieser Seite des Konflikts gewiss nicht fand.
Als Sevkin noch lebte, war Cohens Sinn für Gerechtigkeit kein Problem gewesen. Rahffs jüngster Sohn vermochte es wie kein anderer, Cohen … abzulenken. Ihn zu kontrollieren und zu manipulieren. Doch ohne Sevkin hatte Rahff Angst, dass er Cohen auf eine Weise verlieren konnte, die ihm das Herz brechen würde.
***
Ihre Schritte hallten laut durch die hohen Flure der königlichen Burg, während sie sich schleunigst von der Leibgarde entfernten, die vor dem Ratszimmer des Königs positioniert waren.
»Ich werde hier bei dem König bleiben«, beschloss Cocouns Vater, »du reitest nach Dargard zurück und mobilisierst Truppen.«
Cocoun hatte keine Lust, ausgerechnet für den Mann Rettung zu schicken, den er abgrundtief hasste. »Macht das doch selbst, Vater, ich habe andere, vergnüglichere Verpflichtungen.« Zum Beispiel, die Geburtenrate unter den Dienstbotinnen im Palast erheblich ansteigen zu lassen, dachte er lüstern. Nicht, dass sie ihm freiwillig zur Verfügung standen, das wäre ja langweilig.
Als sie sich außer Hör- und Sichtweite der Wachen befanden, packte der Lord Cocoun bei der Kapuze seines purpurfarbenen Umhangs und stieß ihn in eine kleine Nische in der Wand, in der ein Bild der Hure hing, die Rahff der Erste zu seiner Frau gemacht hatte, nachdem er die Burg zurückerlangt hatte. Ein grässliches, dürres Weib, dem selbst auf dem Gemälde die Falschheit in den schmalen, kleinen Augen stand.
Cocoun fuhr zu seinem Vater herum, der einen knochigen, alten Finger auf ihn richtete und ihm die dürre, lange Hakennase ins Blickfeld schob.
»Jetzt hör mir mal gut zu, mein Sohn«, zischte der Lord leise, »du tust, was ich dir sage, und zwar besser unverzüglich.«
Die Dringlichkeit in der Stimme seines alten, schwachen Vaters ließ Cocoun aufhorchen.
Der Lord leckte sich nervös über die trockenen, schmalen Lippen, als er etwas ruhiger aber nicht minder bedeutungsvoll fortfuhr: »Du musst deine besten Männer ausschicken. Der Blutdrache darf unter keinen Umständen überleben!«
Cocoun begann zu verstehen, trotzdem runzelte er fragend die Stirn. »Welchen Vorteil bringt dir sein Tod?«
Der Lord schlug Cocoun die flache Hand ins Gesicht, so das Cocouns Kopf leicht herumflog. Er war Schläge von seinem Vater gewöhnt, auch wenn sie ihn immer wütend machten, ließ er es über sich ergehen und sah dem Lord wieder kühl in die Augen.
»Denk einmal nach, Cocoun, und streich die Perversität, die dich deines Verstandes mehr als mir lieb ist beraubt, aus deinem Kopf!«
Der Lord sah sich über die Schulter, um sicher zu gehen, dass sie noch ungestört sprechen konnten, ehe er eindringlich weitersprach: »Der Blutdrache wird mehr als einmal in den heiligen Schriften unserer Kirche erwähnt. Er ist ein Symbol für die Einigkeit der Völker Nohvas. Verstehst du nicht? Er ist das Glied, das alles zusammenfügen kann! Wenn er in Erscheinung tritt, werden sich sogar die Angehörigen der menschlichen Kirche – nicht nur die unterdrückten Luzianer – gegen die wenden, die eine strikte Trennung der Religionen und Völker anstreben. Sie werden sich gegen uns wenden! Er darf nicht überleben!«
Ein bösartiges Lächeln breitete sich auf Cocouns Lippen aus, als er zu begreifen begann.
»Vater«, sagte er selbstzufrieden, »Ihr müsst lernen, Euch deutlicher auszudrücken. Wenn es ums Töten geht, braucht Ihr mich gewiss nicht zweimal bitten. Ich werde sofort meine besten Krieger kontaktieren. So schwer kann es ja nicht sein, einen Drachen zu töten.«
Sie würden ihn im Schlaf überraschen, wenn er noch in Menschengestalt war, überlegte sich Cocoun. Zu schade, dass er nicht selbst mitkommen konnte, aber er war einfach zu wertvoll für solch eine niedere Aufgabe. Wozu sollten sonst die ganzen Bastarde gut sein, die in die Armee gezwungen wurden? Sollten sie sich mal als nützlich erweisen.
Der Lord entspannte sich etwas und trat von seinem Sohn zurück. Er nickte einmal bestimmend und bedeutete Cocoun, sich unverzüglich auf den Weg zu machen.
Mit einem hinterlistigen Lächeln verließ Cocoun die Burg und beauftragte seine Diener, alles für die Abreise vorzubereiten.
Während er sich zu den Gemächern seiner Gattin begab – wobei er zugeben musste, dass er öfter bei ihren Zofen gelegen hatte als bei ihr – dachte er daran, dass er gleich noch eine weitere Bedrohung aus der Welt schaffen konnte.
Cohen.
Dieser dreckige, kleine Bastard war ihm seit ihrer frühen Kindheit ein Dorn im Auge. Dabei waren sie eigentlich einst gute Freunde gewesen. Aber dann musste Cohen ja ausgerechnet zu diesem Mann heranwachsen, der allein aufgrund seiner verwegenen Ausstrahlung auf Frauen wirkte wie Licht auf Motten.
Natürlich galt Cocoun weiterhin als schönster Mann der Ebenen, zudem war er wohlhabend und würde bald der Lord der Hauptstadt werden. Aber trotzdem hatte Cohen immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wenn sie zusammen waren.
Des Königs Bastard. Vielleicht lag es einfach nur daran, dass er ein Bastard war und die Frauen sich zu Verbotenen hingezogen fühlten. Oder es lag daran, dass er – auch wenn er nur ein Bastard war – ein Sohn des Königs war. Möglicherweise hatte es auch etwas mit seiner stillen, unergründlichen Art zu tun. Er wirkte unnahbar auf jeden, der ihn nicht kannte, und je mehr er schwieg, je mehr strengten sich die Frauen an, ihm zu gefallen.
Cohen hatte Cocoun nie eine Frau streitig gemacht, doch leider waren viel zu oft hübsche Damen, auf die Cocoun bereits ein Auge hatte, von ihm abgesprungen, um Cohen ihre Gunst zu zeigen. Ohne Erfolg.
Vielleicht konnte Cohen nichts für seine Anziehungskraft, trotzdem machte es Cocoun rasend vor Eifersucht. Weshalb er sich daran ergötzte, seinem Gegenspieler so oft er konnte, das Leben zu vermiesen. Erst als die im Jugendalter waren, dann später, als er ihm Sevkin genommen hatte, nicht zu vergessen: all die kleinen Streiche und Seitenhiebe aus Worten, mit denen er Cohens Stand niedermachte. Und natürlich seine Lieblingsgeschichte über sich und Cohen, die sich damals in Dargards Kerkern ereilte.
Und jetzt sollte dieser Bastard König werden?
Sein König werden?
Das würde Cocoun zu verhindern wissen. Allein dafür, dass seine eigene Frau immer leuchtende Augen bekam, wenn Cohen ihr auch nur zunickte, würde Cocoun ihn umbringen lassen.
Außerdem wollte er selbst König werden, was schon schwer genug war. Rahff musste ohne Erben sterben, soviel war sicher, also musste erst Cohen und dann Rahff ins Gras beißen.
Nachdem er in die Gemächer seines Eheweibs geplatzt war – sie trank gerade Tee – und ihr befohlen hatte, alles zusammen zu packen, verließ er die Burg erneut und ging zu den Ställen, wo seine Leibwache auf ihn wartete.
Marmar war ein großer, stämmiger Mann mit langem, braunem Haar, schmalen, mandelförmigen Augen und bronzefarbener Haut. Sein Vater stammte vom Wüstenvolk ab, er selbst war ein Bastard einer Hure aus Dargard. Cocoun hatte ihn betrunken in den Straßen der Hauptstadt gefunden und beschlossen, diesem dreckigen Hund eine Aufgabe zu geben.
Die Dankbarkeit des Mannes war in unermüdliche Loyalität umgeschlagen.
Marmar war ein roher, wilder und berechenbar kühler Zeitgenosse, der das Töten vielleicht sogar noch mehr genoss als Cocoun selbst.
»Mein Herr«, begrüßte Marmar Cocoun und verneigte sich kurz in seiner schwarzen Rüstung.
Cocoun trat mit einem listigen Lächeln zu ihm. »Du stinkst wie ein Ochse, Marmar.«
Marmar schmunzelte zurück. »Die Huren haben mir letzte Nacht viel abverlangt.«
»Ich hoffe, du hattest genügend Spaß letzte Nacht«, sagte Cocoun bedeutungsvoll und trat zu dem großen Streitross, das an einem Pfahl angebunden neben Marmar stand und mit einem gewaltigen Huf schabte. Er klopfte auf den schwarzen Hals des Tieres und sprach weiter: »Denn du wirst eine Weile auf Reisen gehen.«
Neugierig geworden horchte Marmar sofort auf. »Herr?«
»Nimm deine besten Männer mit, ich habe einen Auftrag höchster Wichtiger für euch«, verkündete Cocoun und grinste. »König Rahff will, dass wir schnell seinen Bastard finden. Du reitest jetzt gleich los und suchst besser nach Cohen und den anderen beiden Flüchtigen.«
Marmar hörte den Unterton in Cocouns Stimme und trat mit zu Schlitzen verengten Augen näher an seinen Gebieter heran. »Und wenn ich sie gefunden habe, Herr?«
Cocoun sah zu ihm auf und betonte bedeutungsvoll: »Es wäre doch zu schade, wenn dem Bastard da draußen etwas zustoßen und er nicht zurückkommen würde, nicht wahr?«
Marmar verstand nur zu gut, er grinste verschlagen. »Vielleicht erwischen ihn Straßenräuber, bevor er gerettet werden kann.«
Cocoun seufzte gespielt bedauernd. »Das wäre wirklich äußerst bedauerlich.«