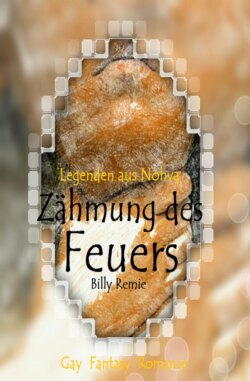Читать книгу Zähmung des Feuers - Billy Remie - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеEtwas mehr als zwei Wochen nach seiner Befehlsverweigerung, kehrte Cohen mit seinen treuen Gefährten zur königlichen Burg zurück. Er fühlte sich wie der größte Versager und teilte keineswegs die große Begeisterung über seine »Gute Tat«, so wie seine Männer.
Er hatte einen Befehl verweigert, schlimmer noch, er hatte das »Schlachtfeld« einfach verlassen und seine Verbündeten im Stich gelassen. Mal davon abgesehen, dass er damit seinen Eid gehalten hatte, hatte er einen anderen Eid damit gebrochen.
Manchmal war das Leben eines Soldaten wirklich nicht leicht. Und gerade für jemanden wie Cohen, dem Ehre alles bedeutete, was einen Mann ausmachen sollte, war sein eigenes Vergehen schwer zu ertragen.
Und zu allem Überfluss konnte er sich auch noch von diesem kleinen Sadisten, Cocoun – den Sohn und Erbe des Lord Schavellen – die ganze Reise bis nach Hause anhören, welch feiger Bastard er doch wäre.
Das brach auch im Hof der Burg nicht ab, als Cohen Galia einem Stallburschen übergab und seine Männer verabschiedete, die sich schnell in ihre Stammtaverne, »Zum Raben«, aufmachten – sie luden ihn ein, mitzukommen, doch er musste zuerst diese unangenehme Sache seines Verrats dem König vortragen. Cocoun ließ einfach nicht von ihm ab.
Nachdem der große Mann mit den blauen Augen und dem kurzen blonden Haar seinen anmutigen weißen Hengst abgegeben hatte, eilte er Cohen mit einem überheblichen Gang hinterher.
»Was der König jetzt wohl von seinem Lieblingssöhnchen halten wird, hmmm?« Er liebte es, auf den Fehlern anderer herumzureiten. »Ich muss schon sagen, Cohen, ich hätte nie von dir erwartet, dass du Angst vor ein paar Priestern hast!« Er lachte ihn aus und klopfte ihm mit der flachen Hand auf die Schulter. »Scheint dich noch ganz schön aus dem Wind zu bringen, dass wir deinen Bruder hängen ließen, habe ich recht?«
Cohen blieb so abrupt stehen, dass Cocoun es erst nach einigen Schritten bemerkte. Verwundert drehte er sich nach Cohen um, der mit angespannten Muskeln stocksteif mitten im Burghof stand und die Hände abwechselnd zu Fäusten ballte und wieder öffnete. Er mahlte mit den Kiefern und blickte diesem Scheusal von einem Menschen in das selbstgerechte Gesicht.
Cocoun war einst Cohens bester Freund gewesen, damals, als sie noch Kinder gewesen waren. Aber ihre Freundschaft war schon lange dahin. Er hatte irgendwann bemerkt, dass Cocoun zu einem äußerst unangenehmen Zeitgenossen heranwuchs. Stets hatte er Cohen herablassend behandelt, weil Cohen nur ein Bastard war. Sie hatten sich schon lange nichts mehr zu sagen. Jedoch hatte Cohen ihn erst dann richtig zu verabscheuen begonnen, als er Cocoun einmal dabei zugesehen hatte, wie er aus reiner Lust und Laune die Dienerinnen in seinem Haus schikanierte. Wobei das Wort »Schikanieren« für das, was er ihnen angetan hat, stark untertrieben schien. Cocoun hatte Spaß daran, Untergebene zu foltern, zu vergewaltigen und aus reiner Lust und Laune zu töten. Cohen wusste es besser als jeder andere.
Und das wirklich Schlimme daran war, dass es offensichtlich in Ordnung für die Menschen war. Niemand behelligte ihn deshalb. Niemand hatte je versucht, ihm eine Falle zu stellen, um seine Verbrechen ans Tageslicht zu bringen. Aber Sevkin wurde hingerichtet, obwohl er nie jemanden wehgetan hatte.
Nun ja, niemanden außer letzten Endes Cohen.
Cocoun trat etwas näher, die Mittagssonne spiegelte sich in der auf Hochglanz polierten Silberrüstung, der leichte Wind bewegte seinen purpurnen Umhang, der nicht einmal ihm gehörte.
Noch immer bewohnte die Familie Schavellen den einstigen Königspalast in Dargard, und noch immer lagerten dort die Besitztürmer der Airynns. Cocoun bediente sich gerne an ihren Umhängen und schmückte sich wie ein König. Und nachdem Sevkin nun auch tot war, standen die Chancen, dass die Krone nach des Königs Tod an die Familie Schavellen überging, sehr hoch. Denn Cohen war und blieb ein Bastard ohne Rechte. Etwas Anderes wollte er auch gar nicht sein. Nicht, wenn er sich Cocoun vor Augen führte.
Cohen hätte dem anderen zu gerne das zufriedene Grinsen aus dem Gesicht geprügelt, doch damit hätte er Cocoun nur in die Hände gespielt.
»Ich weiß wirklich nicht, wieso wir mal Freunde waren«, platze es Cohen unverwandt heraus.
»Ich bin eben charmant«, konterte Cocoun und zuckte arrogant die Schultern.
Cohen schnaubte herablassend und ging kopfschüttelnd an seinen ehemaligen Freund vorbei. »Meine Frau erwartet mich, Cocoun, also entschuldige mich bitte.«
Cocoun sah ihm nach und rief provozierend: »Richte ihr schöne Grüße von mir aus, sie ist eine Augenweide. Zu schade, dass sie keinen Stand hat, sonst wäre sie meine Frau geworden.«
Mit den Zähnen knirschend zwang sich Cohen, weiter zu gehen.
***
»Das war kein Kampf Soldat gegen Soldat, Vater, das war ein Niedermetzeln von Unbewaffneten.«
In den Gemächern des Königs war es düster. Stets waren die dicken Samtvorhänge zugezogen, ihr Rot wurde nur von den Fackeln und Kerzen angestrahlt, die der König selbst am Tage aufstellen ließ. Es war reichlich warm in diesem großen Raum, im Kamin brannte ein Feuer, obwohl draußen bereits milde Winde wehten. Doch König Rahff war auf Grund seines Alters ein Mann, dem schnell kalt wurde.
Der König saß hinter seinem Schreibtisch, unzählige Schriftrollen und Briefe türmten sich vor ihm auf, er wirkte müde und genervt. Trotz seines Alters war Rahff jedoch noch ein Mann, indem Leben steckte. Er hatte sich seiner Schlankheit und seiner Muskeln bewahrt, auf seinen Wangen war ein gepflegter, silberner Bartschatten zu erkennen, und sein dunkles Haar war erst kürzlich wieder kurz geschnitten worden, was ihn jünger wirken ließ. Cohen wusste, dass sein Vater noch immer ein ernstzunehmender Krieger war, den kein Feind unterschätzen sollte.
»Wir werden es auf deinen Eid schieben«, beschloss der König. »Mach dir deshalb keine Sorgen. Wie du schon sagtest, es war keine Schlacht. Ich habe dich ohnehin nur mitgeschickt, damit mir jemand eine ehrliche Beurteilung der Geschehnisse dort berichten kann. Dir habe ich vertraut, diesem kleinen Schavellen Spross allerdings nicht. Wenn Cocoun etwas gegen dich vorzutragen hat, werde ich ihm ausrichten, dass du so gehandelt hast, wie die Krone es von dir erwartet.«
Die Worte seines Vaters erleichterten Cohen keineswegs. Er fühlte sich immer noch wie ein Feigling. Vermutlich, weil Cocoun ihn zwei Wochen lang als solchen beschimpft hatte.
»Für mich findest du immer Ausreden«, murmelte Cohen mit starren Blick zu Boden, »für deinen jüngsten Sohn hast du keine gefunden.«
Noch bevor er es ausgesprochen hatte, spürte Cohen des Königs strengen Blick auf sich.
Er drehte sich um und verbarg damit vor seinem Vater den Kummer, der in seinen Augen lag. Hinter ihm befand sich ein Buntglasfenster, aus dem er hinauszusehen versuchte. Doch die schönen Gärten der Burg wurden durch das rote Karo, aus dem er hinausblickte, nur zu etwas, das ihn wieder an den Krieg erinnerte.
Warum färbte sich alles rot wie Blut, egal, wohin er ging?
Lag es an ihm, oder an der Zeit, in der er lebte?
»Dein Bruder wählte sein Schicksal selbst, Cohen«, sagte der König und beugte sich wieder über seine Arbeit. Er musste viele Bittsteller abwehren, noch bevor sie vor den Thron treten konnten, sonst würde er vermutlich niemals den Thronsaal verlassen. Zu viele Menschen kamen her und knieten vor ihm, um ihn um seine Gunst anzuflehen.
Cohen blickte hinaus und dachte daran, dass er seinen Bruder nicht einmal anständig begraben hatten dürfen, oder verbrennen. Keines der beiden in Nohva zugelassen Bräuche wurde einem Sünder zugeschrieben. Sevkins Überreste waren grausamer Weise den Hunden zum Fraß vorgeworfen worden, die Cohen seitjeher nicht mehr ansehen konnte.
»Ich hätte mit ihm hängen sollen«, flüsterte Cohen voll seelischem Schmerz.
König Rahff donnert die Faust so unerwartet fest auf seinen massiven Holztisch, das Cohen zusammenschrak und sich verwundert nach ihm umblickte.
»Jetzt genügt es aber, Sohn!«, warnte der König. »Denkst du wirklich, es hätte mir nicht das Herz gebrochen, ihn hängen zu sehen? Glaubst du das wirklich?«
Cohen schüttelte den Kopf. Er versuchte angestrengt, nicht zu weinen, denn er wollte vor seinem Vater nicht schwach erscheinen. Obwohl er von Geburt an nahe am Wasser gebaut war – wie man so schön umgangssprachlich Heulsusen bezeichnete – achtete er stets darauf, wenigstens nicht in der Öffentlichkeit seine Schwäche zu zeigen.
Rahff hatte keine Tränen in den Augen, als er wütend erklärte: »Cohen, dein Bruder hat sich selbst in diese Lage gebracht. Ich konnte nichts tun, um ihm zu helfen. Sevkin war naiv genug, zu glauben, er könnte tun, was er wollte. Ohne Konsequenz. Aber er wurde eben erwischt.«
»Du hättest die beiden Stadtwachen der Lüge bezichtigen können!«, herrschte Cohen seinen Vater wütend an. Zum Glück waren sie allein im Raum, sonst hätte er sich für seine Unverschämtheit von seinem Vater eine ordentliche Standpauke anhören können.
Doch sie waren allein, also blieb Rahff ganz ruhig, als er erwiderte: »Die beiden Männer von der Stadtwache haben schließlich nur das getan, wozu sie ausgebildet wurden. Sie meldeten ein Verbrechen, Cohen. Das weißt du. Ich wollte meinen Sohn nicht hängen sehen, das weißt du ebenfalls, aber mir waren die Hände gebunden. Dein Bruder hat ein Verbrechen in den Augen unserer Kirche begannen. Dafür hat er die gerechte Strafe erhalten.«
Cohens Lippe zitterte, als er erstickt fragte: »Glaubst du das denn wirklich?«
Gerechte Strafe? Für was? Was hatte Sevkin denn so Schlimmes getan in den Augen der Gläubigen? Cohen war gläubig – war es gewesen – und für ihn war das, was Sevkin getan hatte, nichts im Vergleich zudem, was er und seine Männer die letzten Jahre auf dem Schlachtfeld verbrochen hatten. Sevkin hatte zumindest nie jemanden getötet.
»Nein«, gab Rahff zu. Er legte seine Schreibfeder sorgsam nieder und rieb sich die Stirn, als habe er Kopfschmerzen. Dann erhob er sich und ging auf Cohen zu. »Hör mir zu, Cohen. Du weißt, dass ich nichts tun konnte. Schavellen hat es erfahren und auf die Hinrichtung gedrängt. Hätte ich meinen Sohn verschont, nur auf Grund dessen, weil er mein Sohn war, hätte Lord Schavellen die Bevölkerung gegen uns aufgebracht. Und was wir jetzt am wenigsten brauchen können, wären noch mehr Menschen, die sich bekämpfen. Der Bürgerkrieg muss enden, Cohen, und nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Es tut mir weh, dass mein Sohn dafür starb, aber Sevkin wäre auch gestorben, hätte ich mich geweigert, seine offensichtliche Schuld anzuerkennen. Das weißt du. Sie hätten uns alle gehängt. Das hätte dein Bruder nicht gewollt.«
Cohen verstand es ja, doch er wollte es nicht wahrhaben. Sein Bruder war gehängt worden, und niemand konnte ihn je wieder zurückbringen. Er war tot. Unwiederbringlich tot.
Cohen machte dieser Gedanke wahnsinnig vor Kummer.
Sie verloren Männer auf dem Schlachtfeld, und jetzt auch noch zu Hause. Er erkannte den Sinn dahinter einfach nicht. Wieso meinten es die Götter so übel mit ihm?
Der König blieb vor Cohen stehen und legte ihm mit einem Seufzen beide Hände in den Nacken. Sie waren kalt, trotz, dass die Hitze im Raum stand, wie in einer gutbetriebenen Küche.
»Cohen, das Fundament meiner Herrschaft besteht aus dem Bündnis mit Schavellen. Und er ist mit dem Kirchenoberhaupt nun mal stark verbunden. Wir müssen uns der Kirche beugen, auch, wenn sie uns alles nimmt, was wir lieben«, erklärte der König traurig. Er beugte sich zu Cohen und flüsterte, als seien seine nächsten Worte ein Geheimnis, dass er nur mit seinem Sohn teilen wollte: »König zu sein heißt, die eigenen Bedürfnisse zu vergessen, zum Wohle seines Volkes. Mein Vater hat es begonnen – und ich muss es jetzt ausbaden, wie es so schön heißt. Ein wenig Einfluss habe ich, aber stell dir vor, wie Nohva wäre, würde auch mein Wort nicht mehr zählen. Stell dir Nohva mit Schavellen als König vor.«
Nohva sähe aus wie Dargard, wusste Cohen, wenn Rahff nicht mehr da wäre.
Einst war Dargard, zu Zeiten des Airynn Königs, die kulturreichste Hauptstadt gewesen. Dort war jedes Volk vertreten gewesen, bis Schavellen Dargard übernahm. Seitdem waren dort immer wieder »Säuberungen« der Stadtviertel vorgenommen worden. In Dargard lebten jetzt nur noch Menschen von edlem Blut. Die wenigen verbliebenen Luzianer, die noch lebten, schlugen sich außerhalb der Stadt in halb zerstörten Dörfern durch. In Dargard war kein Platz für Mischlinge, Bastarde, Anderlinge oder Bettler. Das wirkte sich natürlich auch auf die Adeligen aus. Denn ohne Bauern gab es auch keine Ressourcen. Dargard lebte davon, Vorräte von anderen Ländereien zu kaufen. Das konnte vielleicht bei einer Stadt gut gehen, aber nicht bei einem ganzen Land. Nicht auf Dauer.
Cohen schüttelte verdrossen den Kopf und machte sich von seinem Vater los. Er schritt durch den relativ schmucklosen Raum, der für einen König nicht angemessen genug schien. Es gab mehr Praktisches als Prunkvolles in den Gemächern des Königs, der sich nichts aus Reichtum machte. Rahff wollte nur eines: regieren. Und das tat er, so gut er konnte, auch mit Erfolg.
»Wir müssen die Schavellens loswerden«, sagte Cohen, überrascht von seinen eigenen harten Worten. »Sie hintergehen dich und versuchen mittlerweile nicht einmal, es heimlichzutun.«
Der König setzte sich wieder in seinen rotgepolsterten Stuhl. »Vielleicht müssen wir das gar nicht. Es genügt manchmal auch, abzuwarten.«
Der unterschwellige Ton in der Stimme seines Vaters, ließ Cohen aufmerken. »Wie ist das gemeint?«
König Rahff grinste listig. »Meine Vögelchen zwitscherten etwas von geplanten Angriffen der Rebellen auf Schavellens Ländereien. Ich sage nicht, wir sollten unsere Verbündeten im Stich lassen, aber … wir haben es eben einfach nicht gewusst.«
Cohen überdachte dies einen Augenblick, schüttelte aber den Kopf. »Die Rebellen sind nicht zahlreich genug, um Schavellen wirklich zu überrennen.«
»Das nicht, aber sie lenken ihn derweil davon ab, seine dreckigen Pfoten nach der Krone auszustrecken.«
Doch für wie lange? Nohva war geteilt, und das war nicht gut. Sie waren schwach und konnten sich nicht mehr gegen Angriffe von außen verteidigen. Zwei Nationen bereiteten Cohen besonders große Sorgen. Zum einen Carapuhr und Großkönig Melecay, dem sein Ruf als unbarmherziger Heerführer vorauseilte, und zum anderen das Kaiserreich.
Elkanasai war dabei, alle anderen Kontinente zu unterwerfen, und der Kaiser würde vor Nohva gewiss keinen Halt machen.
Es war genauso, wie es aussah. Es stand der größte Krieg bevor, den Bleyquinnt je erlebt hatte. Und keiner würde davon verschont bleiben.
Cohen blieb mit den Händen hinter dem Rücken vor dem großen Kamin stehen und betrachtete mit gemischten Gefühlen das Portrait seines Großvaters, das darüber hing.
Er hatte den Mann gekannt, jedoch nicht sehr lange. Und was er von ihm gekannt hatte, fürchtete er noch heute. König Rahff der Erste war ein strenger Vater und Großvater gewesen, der Cohens Mutter verachtet hatte. Vermutlich, weil sie Cohen stets von ihm fernhalten wollte, bis sie schließlich verstarb.
Sein Vater bemerkte seinen Blick und seufzte verhalten. »Du bist deinem Großvater wie aus dem Gesicht geschnitten.«
»Welch Glück, dass ich wenigstens die Augen meiner Mutter habe.« Und ihren Charakter, wie sein eigener Vater stets stolz verkündete.
Im Augenwinkel konnte Cohen erkennen, dass Rahff schmerzerfüllt das Gesicht verzog, als Cohen seine Mutter zur Sprache brachte. Und genauso fühlte Cohen auch, wenn er an Sevkin dachte, der ihm für immer genommen worden war.
Er fühlte nur noch die Endgültigkeit des Todes, ohne einen Hoffnungsschimmer am Ende eines finsteren Tunnels. In ihm war nur noch der düstere Abgrund der Trauer. Sein Herz schlug noch, aber es war bereits mit Sevkin gestorben. An jenem Tag, als er seinen kleinen Bruder vom Galgen losgeschnitten und den leblosen Körper wie ein Neugeborenes in seinen Armen gewiegt hatte, als der Regen auf sein Haupt und seine Schultern prasselte und verschleierte, dass er weinte, da war er mit Sevkin gestorben. Cohen wusste gar nicht, wer er ohne Sevkin wirklich war. Und er empfand keinen Willen, es herauszufinden.
Um sich von diesen Themen abzulenken – vor allem, um zu vergessen, wie viele er bereits verloren hatte; Mutter, Brüder, Freunde, Kameraden – drehte er seinem Vater das Gesicht zu und sagte eindringlich zu diesem: »Wenn der Krieg länger anhält, werden wir uns nicht sehr lange halten können, Vater.«
Rahff nickte wissend. »Zu diesem Schluss kam ich schon, bevor Schavellens Truppen ungefragt in die Wüste einmarschierten.«
Die Goldis hatten Schavellen bis in die Tiefen Wälder zurückgeschlagen. Sie waren zäher, als die Menschen aus den Ebenen je angenommen hatten. Zäh, und äußerst rachsüchtig.
»Wir müssen eine Wahl treffen.« Und mit wir meinte er den König. »Wir können nicht beide Seiten bekämpfen, wir müssen mit einem von beiden ein Bündnis schließen. Entweder wir geben den Rebellen, was sie verlangen, oder dem Wüstenvolk.«
»Es geht lange nicht mehr um Gold«, warf Rahff ein. »Das Volk der Sandhügel ist erbost, weil ihre Güter – ihr Gold – für Götter verwendet werden soll, an deren Existenz sie nicht einmal glauben. Zudem haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, uns zu bekehren. Glaub mir, ich habe versucht, den Lord von Gino zu Friedensgesprächen zu drängen, doch er wollte nur zustimmen, wenn wir unseren – in seinen Worten – falschen Göttern entsagen.«
Cohen hatte schon lange die Befürchtung, dass der gesamte Krieg letztlich eine einzige Glaubensfrage sein würde.
»Gut, dann reden wir mit den Rebellen!«
»Unmöglich«, verneinte Rahff konsequent. »Sie hinterfragen das ganze Grundgerüst unseres Glaubens, Cohen. Der Adel würde dem nie zustimmen.«
»Die Rebellen sagen, sie glauben nicht, dass es der Wille der Götter sei, andere zu unterdrücken, nie haben sie behauptet, es gäbe die Götter nicht«, erwiderte Cohen und zuckte mit den Schultern. »Was macht es schon, ihnen ein Stück entgegenzukommen, wenn wir dadurch einen Feind weniger hätten?«
»Du weißt, mir steht nicht der Sinn danach, Frauen und Bastarde zu schikanieren, oder andere Völker in die Leibeigenschaft zu zwingen.« Rahff sah ihn streng an. »Aber versuch du doch mal, Schavellen und seinen Verbündetet zu erläutern, dass sie mit einer Schar bewaffneter Bastarde Frieden schließen sollen. Für Schavellen zählt nur Stand und Reinheit des Blutes. Er will sie alle tot sehen.«
»Aber Schavellen regiert nicht!«
»Er stellt uns jedoch die größten Heere zur Verfügung«, donnerte Rahff wütend. »Bei all deinen Göttern, Cohen, denk nach, bevor du mit mir sprichst! Und halt mich nicht für dumm, Sohn. Ich hätte mit den Rebellen schon vor Jahren Frieden geschlossen, wenn es möglich gewesen wäre. Aber dann würde der Adel mich stürzen.«
Es war doch immer wieder erstaunlich, wie wenig Einfluss ein König haben konnte, erkannte Cohen nicht zum ersten Mal. Doch es war nicht Rahffs Schuld, dass ihm so oft die Hände gebunden waren. Cohens Großvater hatte seine Herrschaft damit begonnen, indem er sich mit anderen Verrätern zusammenschloss, denen man nicht trauen konnte. Cohens Vater hatte wirklich keine große Wahl, wenn er König bleiben wollte. Sein Bündnis mit den anderen Verrätern war das einzige, das ihn vor dem Zorn der Völker schützen konnte.
Aber lange würden sie nicht die Oberhand auf den Schlachtfeldern halten, wenn sich der Krieg nur noch etwas länger hinzog. Zu allem Überfluss schwirrten nämlich immer mehr Dämonen umher, die für alle Seiten eine Gefahr darstellten.
Die Welt lag im Chaos, und für Cohen war das Ende ihres Zeitalters bereits abzusehen.
Er schüttelte nur noch den Kopf und ließ das Thema fallen. Er war weder König, noch Prinz, noch irgendein bedeutender Berater. Er war nur ein Soldat. Ein verdammt guter Reiter, den der König in die Schlacht schicken konnte. Aber ohne Mitspracherecht.
Mehr war er nicht, also würde er sich auch nicht über mehr Gedanken machen.
Er versuchte es zumindest.
»Was ist mit unseren Gefangenen?«, fragte Cohen schließlich, ohne echte Neugierde.
Rahff starrte bedrückt vor sich hin. Er atmete tief durch, ehe er antwortete: »Ich habe lange mit Lord Schavellen darüber diskutiert. Aber letztlich hat er eben doch recht. Sie müssen sterben. Die Gefahr ist einfach zu groß. Es tut mir fast leid um sie.«
»Reden sie endlich?«
»Nein, keiner der beiden.« Rahff lehnte sich frustriert zurück. »Entweder er hat wirklich sein Gedächtnis verloren, oder er ist verdammt zäh. Und was den anderen betrifft … ich schätze, er weiß wirklich nichts. Er ist nur ein Dieb.«
Ein Dieb, der nicht wusste, wer er wirklich war. Cohen stimmte das fast ein wenig traurig. Er nickte jedoch nur noch und wollte Rahff schließlich alleine lassen.
»Bevor du zu deiner Familie gehst«, hielt Rahff ihn noch einmal auf. Er sagte das so, dass Cohen sich mit großen Befürchtungen zu seinem Vater umdrehte. »Du … solltest vielleicht in den Kerker gehen.«
»Weshalb?«, fragte Cohen voller Unbehagen.
»Du weißt, warum«, sagte Rahff mit strengem Unterton. Er beugte sich wieder über seine Briefe und wies seinen Bastard an: »Bring ihn zum Singen, Cohen. Wenn du das nicht vermagst, glaube ich ihm, dass er seine Erinnerung verloren hat. Dann gewähre ich ihm den schnellen Tod durch Enthauptung.«
Cohen erkannte nicht zum ersten Mal, dass es ein Fluch war, der einzige zu sein, dem der König vertraute. Er hasste es, zu foltern, aber noch einmal würde er keinen Befehl verweigern. Zumal der Mann, zudem er jetzt ging, der Erzfeind seiner Familie war.
Denn er hatte einst Cohens Großvater ermordet.
***
Es war grauenhaft, ihnen beim Sterben zuzusehen. Und doch war es fast unmöglich, den Blick abzuwenden.
»Was wetten wir, dass der linke Bettler zuerst verreckt?«
Eagle wandte schockiert den Kopf und starrte den Vergessenen an.
Sein Freund war zu ihm an die Gitterstäbe gekrochen und setzte sich nun dicht neben Eagle. Sein Körper war warm, wärmer als Eagles, der in diesem feuchten Keller fast umkam vor Kälte.
»Was ist?« Der Vergessene hob mit kühlem Blick seine dunklen Augenbrauen. »Ach komm, wie sollen wir uns sonst die Zeit hier vertreiben?«
»Ich wette nicht auf so etwas!«, protestierte Eagle leise.
Er wandte den Blick wieder auf die beiden Bettler, die am anderen Ende der Zelle nebeneinandersaßen und bei jedem verstreichenden Augenblick blasser wurden. Beide hatten die Augen geschlossen, ihre langen, grauen Zotteln umrandeten ihre eingefallenen ruhenden Gesichter. Sie wirkten jünger als ihr ergrautes Haar glauben ließ, vermutlich hatte das harte Leben auf der Straße ihnen die Farbe aus dem Haar gestohlen. Der linke ließ den Kopf seitlich hängen, doch er atmete ruhig und warmer Sabber floss aus seinem Mundwinkel, der andere, der rechte Mann, hatte den Kopf in den Nacken gelegt und atmete stockend, er zuckte gelegentlich und wimmerte leise.
Eagle rückte etwas näher an den Vergessenen heran und flüsterte: »Aber, mal angenommen, ich würde auf den rechten setzen – was hättest du denn zu bieten?«
Der Vergessene verzog einen Mundwinkel leicht nach oben, sodass es fast wie ein Schmunzeln wirkte. »Du hast die Wahl zwischen einem verschimmelten Stück Brot und einer toten, halbaufgegessenen Ratte.«
Eagle runzelte die Stirn. »Hast du die Ratte halbaufgegessen?«
»Würde es das besser machen?«
»Vielleicht«, scherzte Eagle. Dann fiel ihm etwas auf und er sah seinen Freund schockiert an. »Hast du etwa Brot vor mir versteckt?«
»Nein, die Ratte hat es reingeschleppt, bevor sie verreckte.«
Eagle wusste sofort: »Vergiftet.«
Der Vergessene nickte zustimmend. »Aber he, wenn dich die Krankheit befällt, kannst du dir damit selbst ein schnelles Ende bereiten.«
Eagle überdachte das und sah wieder hinüber zu den beiden Bettlern. Der Speichel aus dem Mund des linken Mannes färbte sich hellrot. Der Bettler zuckte noch einmal, dann kippte sein Kopf noch etwas weiter vornüber und er hörte zu atmen auf.
»Tja«, seufzte Eagle, »schätze, du kannst deine Ratte und dein vergiftetes Brot behalten.«
»Ich habe gewonnen, du schuldest mir was.«
»Lass mich raten, du willst den letzten Schluck Wasser«, schmunzelte Eagle.
Bei dem Wort »Wasser«, das er unbedachterweise etwas zu sorglos ausgesprochen hatte, fuhr der Kopf eines Mitgefangenem zu ihm herum. Die Gier in den Augen des Mannes schlug Eagle unverwandt entgegen.
Er versuchte, es zu ignorieren.
Sie hatten vor einigen Tagen Brot und Wasser gereicht bekommen, doch das neigte sich nun auch wieder dem Ende zu.
»Kein Wasser. Ich will, dass du mich befreist.«
Eagle sah dem Vergessenen in die Augen. Die grüne Farbe darin schien in dem dunklen Zellenraum geradezu zu leuchten. Es war faszinierend. Oft sah Eagle ihn an und dachte nur, dass in seinem Freund ein seltsames Feuer loderte, das ihn am Leben erhielt. Fast so, als habe er noch etwas zu erledigen und durfte noch nicht sterben. Doch keiner von ihnen beiden wusste, was ihn am Leben hielt.
Der Vergessene lachte scherzhaft auf und zeigte mit einem drohenden Finger auf Eagles Nasenspitze. »Vor Wettschulden kann man sich nicht drücken, denk dran.«
Eagle umschlang seine angezogenen Knie mit den von Folter gezeichneten Armen und wandte den Blick von seinem Freund ab.
Was als Scherz begann, endete in düsteren Gedanken. »Ich wünschte, ich könnte uns befreien.«
Die schwere Hand des Vergessenen landete in Eagles Nacken, doch das spürte Eagle wegen seiner seltenen Krankheit kaum. Die Schuppen auf seinem Rücken – grün und matt, ähnlich wie bei einer Wüstenechse – verhinderten, dass er die Wärme des anderen Mannes spüren konnte.
Der Vergessene, der die Schuppen auf Eagles Rücken bereits kannte und sich nicht dadurch gestört fühlte, strich darüber und beruhigte Eagle: »Es war nur ein alberner Scherz, Eagle.«
»Ich weiß«, seufzte Eagle und holte tief Luft. »Ich wünschte nur, ich könnte irgendetwas für dich tun – oder für mich.«
»Weißt du …«, begann der Vergessene voller Bedauern, » … ich weiß nicht, ob ich Angst davor habe, hingerichtet zu werden, ich wüsste vorher einfach nur gern, wer ich eigentlich bin – und ob ich es verdiene.«
Eagle schüttelte den Kopf und drehte seinem Freund wieder das Gesicht zu. Es war pure Folter durch Gitterstäbe von dem einzigen Mann getrennt zu sein, der Eagle davon abhielt, hier drinnen den Verstand zu verlieren. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen ehrlichen Grund gibt, dich zum Tode zu verurteilen.«
Einmal hatte Eagle danach gefragt, welche Fragen die Folterer dem Vergessenen stellten. Und sein Freund hatte ihm erklärt, dass sie ihn fragten, ob er noch Verbündete hatte und wo sich diese befanden. Aber das wusste der Vergessene natürlich nicht, und die Fragen ließen kaum darauf schließen, wer er war.
Der Vergessene lächelte traurig. »Woher willst du das wissen? Vielleicht bin ich ja ein Mörder.«
Eagle legte den Kopf schief. »Du? Wohl kaum. Du erschlägst nicht einmal die Ratten.«
»Womit denn auch?«
»Ich mach das mit der bloßen Faust, wenn sie mich angreifen.«
»Du bist ja auch widerlich«, konterte der Vergessene, »und mich hat noch keine Ratte angegriffen.«
»Sie mögen dich, weil du dein Brot mit ihnen teilst.«
Der Vergessene senkte den Blick. »Na ja, abgesehen von dir sind sie meine einzigen Freunde hier drinnen.«
Das stimmte Eagle noch trauriger. Er schloss die Augen und lehnte die Stirn an die Gitterstäbe.
Er hörte, wie der Vergessene leise durchatmete und es ihm dann gleichtat, sodass es wirkte, als legten sie die Köpfe aneinander.
Sie schwiegen eine Weile und Eagle wurde dabei müde. Selten fand er Schlaf, obwohl er in dieser Zelle nichts anderes zu tun hatte. Aber sein Verstand war zu aufgewühlt, als das er zur Ruhe kommen könnte. Nur in der unmittelbaren Nähe seines Freundes fühlte er sich manchmal sicher genug, um kurz einzudösen. Aber auch nicht für lange.
In Erinnerung daran, wie nah sie sich mittlerweile standen – und das nur durch die Strapazen der Gefangenschaft – flüsterte Eagle in ihr Schweigen hinein: »Ich habe keinen Vater, habe ich dir das erzählt?«
»Nur eine Mutter, die dich nicht die Welt sehen ließ«, erinnerte sich der Vergessene. »Ja, ich weiß.«
Eagle hielt die Augen geschlossen, als er zugab: »Seit ich denken kann, wollte ich mich auf die Suche nach ihm begeben, aber Mutter hat mir nie etwas über ihn erzählt.«
»Du weißt wenigstens, dass du eine Mutter hast.«
Eagle bemerkte, welch grauenhaften Fehler er gemacht hatte.
Da begann Eagle doch tatsächlich, sich darüber zu beklagen, dass er keinen Vater hatte – er war damit gewiss kein Einzelfall –, während der Vergessene nicht einmal wusste, welchen Namen er trug.
Doch sein Freund schien nicht wütend, nur traurig.
»Das ist das Schlimmste daran, weißt du?«, hauchte der Vergessene, sein Blick richtete sich auf das Gitter in der Fensteröffnung, Abendluft und das Licht des Sonnenuntergangs drang durch die Stäbe in die Zellen. »Nicht zu wissen, wie man heißt, ist eine Sache, aber sich zu fragen, ob da draußen jemand nach dir sucht, macht es noch mal schlimmer.«
Eagle wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er schlang die Arme noch enger um sich, und erinnerte sich an seine liebevolle Mutter, die immer versucht hatte, ihn zu behüten. Sie war sicher krank vor Sorge um ihn – und diesmal sogar mit recht.
»Ich meine, ich muss mich die ganze Zeit fragen, ob ich Familie habe«, klagte der Vergessene, Angst schwang in seiner Stimme mit. »Warten meine Eltern auf mich? Habe ich Freunde? Brüder oder Schwester? Woher komme ich, von wo stamme ich her? Wer bin ich? Ich weiß es nicht! Das macht mich wahnsinnig. Habe ich eine Frau? Habe ich eventuell Kinder? Muss ich für jemanden sorgen? Habe ich … alle im Stich gelassen? Denn so fühlt es sich an.«
Eagle dachte darüber nach und verfluchte sich selbst, weil er keine Worte fand, um seinen Freund zu trösten. Aber was hätten Worte hier auch schon ausrichten können. Nichts, was Eagle tat oder sagte, würde dem Vergessenen seine Erinnerungen wiedergeben.
»Ich wünschte, ich wüsste, wer ich bin, bevor sie mich töten«, flüsterte der Vergessene niedergeschlagen.
Eagle überdachte dies einen kleinen Moment lang und kam schließlich zu dem Schluss, dass es nur eines gab, was er dazu sagen konnte: »Du hast ganz sicher keine Familie.«
»Nein?«, fragte der Vergessene amüsiert. Er kannte Eagle bereits.
»Sieh dich doch an!« Eagle drehte ihm das Gesicht zu und ihre Blicke trafen sich zwischen zwei Gitterstäben. »Du bist so hässlich.«
Der Vergessene brauchte einen Moment, bis er zu lachen begann.
Egale stimmte mit ein. »Im Ernst! Du bist so hässlich, keine Frau würde dich wollen, und schon gar keine Kinder mit dir machen!«
Das Lachen des Vergessenen wurde leichter. Er nickte. »Ah ja, stimmt.«
»Und deine Eltern müssen dich direkt nach der Geburt verstoßen haben. Ich hätte es getan, wenn du mein Sohn wärst.«
Eagles Freund lachte so laut und losgelöst, das Eagle vor Freude darüber, den anderen erfolgreich aufgemuntert zu haben, sogleich mit in das Gelächter einstieg. Die anderen Gefangenen durchbohrten sie mit feindseligen Blicken.
»Eagle«, seufzte der Vergessene und wischte sie eine Lachträne aus dem Augenwinkel, »in einem solchen Moment können wir froh sein, dass uns Gitterstäbe voneinander trennen.«
Eagle grinste wissend. »Ach ja?«
»Mhm. Sonst müsste ich dir jetzt eine verpassen.«
»Dann hätten wenigsten Mal die anderen was zu wetten. Wer von uns beiden Idioten den Kampf gewinnt.«
Sie lächelten sich noch an, als das Schicksal erneut über sie zusammenschlug.
Gerade erst hatte Eagle seinen Freund aufgemuntert, als die schweren Schritte der gepanzerten Ritter durch die Kerkergänge hallten.
Der Vergessene und Eagle drehten voller Grauen die Köpfe nach ihnen um, als sie vor den Zellen auftauchten. Ihre Rüstungen glänzten silbern im warmen Licht des Sonnenuntergangs, das durch das Gitterfenster fiel.
»Nein!«, protestierte Eagle schon, noch bevor sie die Zelle aufschlossen.
»An die Wand, Gefangener!«, knurrte einer der Männer. Ihre Gesichter waren allesamt hinter Helmen verborgen, um sie noch unnahbarer aussehen zu lassen. Nicht wie Menschen, mehr wie Monster, gegen die kein normaler Mann antreten konnte.
Der Vergessene schüttelte nur wirr den Kopf, er hatte genug Folterungen hinter sich, um eine rationale Angst davor entwickelt zu haben. Eagle langte durch die Gitterstäbe, an denen sich sein Freund eisern klammerte, und packte seine Arme, um ihn festzuhalten.
»Nein!«, wiederholte Eagle entschlossen, als die Ritter eintraten. Sie zogen schwere Knüppel hervor, an denen Dornen angebracht waren. »Schert euch weg! Er weiß doch nichts!«
Sie prügelten einfach zu dritt auf den ohnehin geschwächten Mann ein. Eagle bekam auch einiges an den Armen ab, aber er versuchte weiterhin, seinen Freund vor den Schlägen zu schützen, immerhin den Kopf konnte er vor Schlägen bewahren.
Die Ritter hörten trotz der Schreie, die nun auch von den anderen Mitgefangenen laut wurden – zumindest von denen, die noch genug Kraft in den Lungen hatten – nicht damit auf, auf den Vergessenen einzuprügeln, der schon zusammengekrümmt und wimmernd am Boden lag. Einer der Ritter ließ nur kurz von ihm ab, um seine Fußfesseln zu lösen.
Sie wollte ihn wegzerren, aber Eagle hielt ihn fest.
»Lasst ihn los! Ihr verfluchten Schweinehunde! Lasst ihn los!«, rief Eagle im Chor mit den anderen Gefangenen, die – egal wie sehr sie ihre Leidensgenossen verachteten – zu ihnen hielten, wenn die Wachen kamen.
Die Ritter schlugen gezielt auf Eagles Arme ein, bis er letztlich gezwungen war, seinen Freund loszulassen.
Der Vergessene wurde aus seiner Reichweite gezerrt.
Eagle brachte sich auf die Beine, er schlug, trat und rüttelte an den Gitterstäben, während er den Rittern und seinem halbbewusstlosen Freund nachsah.
»Lasst ihn in Ruhe!«, brüllte er voller Zorn und rüttelte weiter an den Stäben, von der Decke rieselte loser Geröllstaub auf ihn nieder. »Lasst ihn in Ruhe, er weiß doch nichts! Er weiß nichts!«
Doch es half nichts, sie brachten ihn fort. Eagle brüllte trotzdem weiter, bis er bemerkte, dass er bestohlen wurde. »Lasst ihn in Ruhe, ihr – He, verzieh dich da!« Eagle trat nach dem Gauner, der seinen Wasserbecher aus der Ecke entwendete. Doch es war zu spät. Der junge Mann, der wie eine gewöhnliche Straßenratte – so wurden die Waisenjungen genannt, die in den Straßen aufwuchsen – aussah, hatte die Beute bereits an sich genommen und huschte schnell zurück in seine Ecke.
Eagle hatte sein Wasser verloren, doch der Junge bekam es auch nicht, denn sobald er den Becher an die Lippen setzte, stürzten sich auch alle anderen auf ihn und versuchten, ihm den Becher abzunehmen. Der letzte Schluck Wasser wurde verschüttet und keiner bekam etwas ab.
Eagle drehte dem Tumult in der Zelle den Rücken zu, jetzt schlugen sie sich gegenseitig die Köpfe ein, und da wollte er sich lieber raushalten. Sein Wasser war ohnehin verloren.
Er lehnte den Kopf gegen die Gitterstäbe und blickte in die leere Zelle seines Freundes. Er seufzte und schloss die Augen.
Jetzt hatte er nicht einmal mehr einen Schluck Wasser, den der Vergessene nach der Folterung sicher gut gebrauchen konnte.
Eagle fluchte leiste und trat gegen die Stäbe, bevor er sich wieder auf seinen Hintern fallen ließ. Er wünschte, er hätte Zauberkräfte, so wie seine Mutter, dann hätte er es vielleicht vermocht, seinem Freund zu helfen. Aber er kam dann wohl doch mehr nach seinem Vater, den er nicht kannte.