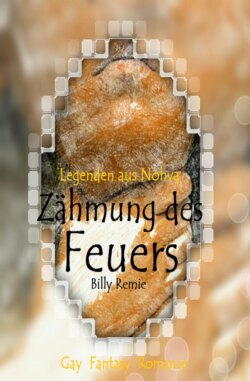Читать книгу Zähmung des Feuers - Billy Remie - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеDer viele Wein am Vorabend hatte für einen äußerst kurzen Schlaf gesorgt. Schon in den frühen Morgenstunden ritt Cohen auf Galias Rücken durch den von Sonnenlicht durchfluteten Wald. Die Baumkronen zeigten bereits die ersten Sprossen. Cohen konnte die kleinen Vogelarten dabei beobachten, wie sie ihre Nester in den knochenartigen Ästen bauten, die gen hellblauen, wolkenlosen Himmel griffen.
Selbst hier, wo er sich bemühte, nur der Melodie der Singvögel zu lauschen, durchbrach die Sorge um die Zukunft seine Gedanken. Letzte Nacht hatte er vielleicht, oder vielleicht auch nicht, ein Kind gezeugt. Noch ein Kind, das im Krieg aufwachsen musste. Vielleicht würde er nie erfahren, ob Sigha überhaupt schwanger war, wenn die Rebellen oder die Goldis – im schlimmsten Fall sogar beide – die Angriffe auf die Länder der frommen Lords wieder aufnahmen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Cohen und seine Männer wieder ausrücken mussten.
Und zu allem Überfluss hatte Arrav in der letzten Nacht etwas angedeutet, dass Cohen sehr verstörte.
Er hatte das Gefühl, für seine Männer die Verantwortung zu tragen, so wie er sie für seine Kinder trug, aber wie sollte er sie beschützen, wenn sie so freizügig rausposaunten, dass sie die ein oder andere Todsünde im Kopf hatten.
Cohen konnte letztlich nur hoffen, dass Arrav klug genug war, um vorsichtig vorzugehen oder um am besten gleich die Finger davon zu lassen. Aber Cohen ahnte bereits, dass es einfach bestimmte Dinge gab, die man nicht ignorieren konnte.
Verlangen war eines davon.
Mit müde hängendem Kopf trottete Galia über den moosbedeckten Boden, die Tiefen Wälder grenzten an dieses Waldstück, das in der Nähe der Burgmauer entlangführte. Cohen kam gerne hier her, weil es hier so still war. Außerdem beobachtete er mit Sorge den Verfall der Mauer auf dieser Seite. Ruinen, die an den Kerker grenzten, waren direkt hinter der rissigen Mauer, weshalb die Instandsetzung dieses Abschnitts immer wieder aufgeschoben wurde. Einst hatte es hier auch eine Tür gegeben, die jedoch auf Befehl seines Vaters hin zugemauert worden war. Trotzdem, sie mussten sich bald diesem Problem stellen und die Mauer wieder standfester gestalten, denn die Festung sollte weiterhin uneinnehmbar bleiben.
Cohen ritt bergab und überließ es Galia, die Geschwindigkeit zu bestimmen. Das angenehme Schaukeln in seinem schwarzen Ledersattel machte Cohen wieder schläfrig. Er fühlte sich, als habe er nur für einen Moment im Bett gelegen, bevor der Wein wieder aus seinem Körper hinauswollte und er gezwungen war, wieder aufzustehen. Mit starken Kopfschmerzen hatte er am Tisch gesessen und zum Frühstück eine Schale warme Milch getrunken, während er sich zusammenreißen musste, wegen seines schlechten Zustandes seine miese Laune nicht an Ilsa und Marks auszulassen, die aufgedreht um ihn herumgesprungen waren und mit ihm spielen wollten.
Sigha hatte sich ein Herz gefasst und ihn erlöst, indem sie die Kinder mit auf den Markt nahm. Daraufhin hatte Cohen das Haus verlassen, um mit seiner anderen »Lady« einen Ausritt zu machen.
Er beugte sich vor und vergrub die Finger in Galias flauschigem Fell. Sie war ein stämmiges Pferd, mit breitem Rücken und kräftigen Beinen, ihr Hals war eher kurz aber dafür sehr muskulös. Ihre Mähne und ihr Schweif waren dunkel, ihr Fell hellbraun. Sie war eine Schönheit und absolut stur. Schon als Fohlen musste sie immer ihren eigenen Kopf durchsetzen. Der Züchter hatte gesagt, sie sei nicht zu gebrauchen, aber Cohen hatte darauf bestanden, sie zu behalten. Statt eines Hengstfohlens hatte er Galia ausgesucht und eigens zugeritten. Erst war sie nur sein »zu Hause Pferd« gewesen, aber nachdem er fünf vollblütige Hengste im Krieg verloren hatte, gab es keinen weiteren Nachschub, erst im nächsten Jahr wieder. Deshalb war sie nun die erste Kriegsstute in der ganzen Armee, und sie war das beste Pferd unter all den anderen.
Cohen ritt weiter und bemerkte nach wenigen Augenblicken einen funkelten Gegenstand abseits des Trampelpfades. Ein Sonnenstrahl traf genau darauf, das Licht spiegelte sich darin. Er zog die Zügel herum und lenkte die unwillige Galia vom Trampelpfad ab, ein Stück in die Tiefen Wälder hinein.
Cohen stieg ab und ging in die Hocke. Etwas Silbernes lugte unter einem Moosbüschel hervor. Er zog einen Dolch und grub es aus.
Es war ein weiterer Dolch, sehr alt, die Klinge war verrostet. Behutsam entfernte Cohen den Dreck von der Klinge. Er entdeckte unterhalb des Hefts zwei eingravierte Buchstaben. »D.M.«
Er wusste nicht, was es zu bedeuten hatte, vermutlich waren es nur irgendwelche Initialen. Angesichts des Zustandes, in dem sich das Messer befand, schloss er, dass der Dolch schon einige Jahre der Witterung ausgeliefert gewesen sein musste. Cohen steckte ihn trotzdem ein, und zwar in den Stiefelschaft, vielleicht könnte der Schmied den Dolch wieder kampffähig machen. Dann führte er Galia weiter, bis er zu seiner Lieblingslichtung kam.
Von dort aus hatte er einen idealen Blick von unten auf die Schwarzfelsburg, die wie ein Berg zwischen anderen Bergspitzen emporragte. Die Wiesen vor den Mauern waren grün, es war kein Schnee vom Winter mehr zu entdecken, und die Sonne strahlte auf den schwarzen Stein der Burg. Es war ein atemberaubender Anblick.
So etwas hatte sein Volk zustande gebracht, und das machte ihn ein wenig stolz. Die Schwarzfelsburg galt auch heute noch als das größte und sicherste Bauwerk der Menschen.
»Ich wusste, ich würde dich hier finden«, sagte jemand von hinten.
Cohen, der mit der Schulter an einem Baum lehnte und die Arme vor der Brust verschränkt hatte, drehte sich um.
Es war Solran. Der große, ältere Mann trug sein längeres, ergrautes Haar zu einem lockeren Zopf, statt seiner Rüstung hatte er unter seinem schwarzen Umhang, der hinter ihm her wehte, nur Lederhosen, Reitstiefel und ein sauberes Leinenhemd an – genau wie Cohen.
»Wer schickt dich?«, fragte Cohen mit einem Schmunzeln. »Sigha oder der König?«
»Der König.« Solran band seinen dunkelbraunen Hengst an einem dünnen Baumstamm fest und trat schließlich neben Cohen. »Er sagte, ich soll dich suchen. Die Hinrichtungen werden bald beginnen.«
Cohen nickte. Gemeinsam blickten sie zur Burg hinauf, wo bald ein großes Spektakel stattfinden würde. Beide fragten sich, wieso die Leute sich so etwas freiwillig ansahen.
»Der König sprach heute Morgen im Vertrauen zu mir«, begann Solran, nachdem er eine Weile geschwiegen hatte. »Er glaubt, du wirst es lieber von mir hören wollen …«
»Ich ging zur Armee, weil ich ihn stolz machen wollte«, schnitt Cohen ihm das Wort ab. Sein Blick reichte über die Wiesen, die dunkelgrün in der Morgensonne leuchteten. »Ich wollte ihm beweisen, dass ich genauso gut bin wie er.«
Er ahnte bereits, was Solran ihm gleich sagen würde, und es gefiel ihm ganz und gar nicht.
Solran beobachtete ihn aufmerksam. »Er hat nie daran gezweifelt.«
Cohen nickte, denn das wusste er. Trotzdem hatte er immer das Gefühl gehabt, beweisen zu müssen, dass er König Rahffs Sohn war.
»Ich wollte auch Sevkin stolz machen«, gestand er schließlich und blickte Solran an. Die Sonne zeigte den grauen Bartschatten auf den hohlen Wangen seines Kameraden.
Solran nickte, er wandte den Blick in die Weite. »Du wolltest die gleiche Anerkennung, die ihnen zuteilwurde.«
Cohen sah hinauf zur Burg und spürte dann Solrans Augen wieder auf sich.
»Die ganze Zeit, hast du dich angestrengt, und versucht, so zu sein, wie Sevkin und Rahff es von dir erwartet haben.«
Dazu musste nichts mehr gesagt werden.
»Und jetzt«, erkannte Solran, »nach Sevkins Tod und Rahffs Unfähigkeit, dagegen etwas zu unternehmen, da fragst du dich, wer du tief im Inneren eigentlich wirklich bist.«
Es war immer wieder erstaunlich, dass Solran in Cohen lesen konnte wie in einem offenen Buch. Solran war einst Hauptmann in der Gebirgsarmee gewesen, er hatte König Rahff als treuer Berater zur Seite gestanden, bis rausgekommen war, dass er nur ein Bastard war. Daraufhin war er Cohen unterstellt worden. Solran pflegte jedoch noch immer ein freundschaftliches Verhältnis zu Rahff, und ein väterliches Verhältnis zu Cohen. Er gehörte quasi zur Familie.
»Ich glaube«, begann Solran zögerlich und sah Cohen mitfühlend an, »dass man manchmal vom Weg abkommen muss, um die richtige Richtung zu finden.«
Cohen wandte ihm das Gesicht zu, Kummer zeichnete sich wie so oft auf seiner Miene ab. »Was denkst du, sollte ich tun?«
»Wenn du mich als Berater zur Rate ziehst …«, Solran holte tief Luft, » … dann sage ich, hör auf deinen Vater und tu einfach, was er verlangt.«
Cohen runzelte neugierig die Stirn. »Und was rätst du mir als mein Freund?«
Solran konnte ihn nicht ansehen, als er den Kopf schüttelte. »Folge deinem Herz, sagt dein Freund. Es weist dir den richtigen Weg.«
Das Problem war, das Cohens Herz seit Sevkins Tod kaum noch etwas ausspuckte als Rachegelüste.
Cohen starrte die Landschaft an, die sich in all ihrer Freiheit vor ihnen erstreckte, als er schließlich verlangte: »Sprich es aus, damit ich eine Entscheidung treffen kann.«
Solran schwieg lange, ehe er den Mut aufbrachte, es zu sagen: »König Rahff wird dich zu seinem Erben ernennen.«
Cohen schloss gequält die Augen. Damit machte Rahff ihn zur Zielscheibe von Lord Schavellens Intrigen. Außerdem wollte er diese Verantwortung nicht übernehmen.
»Es ist keine Entscheidung, die du zu treffen hast«, sprach Solran auf ihn ein. »Ich finde, du solltest es ohne Wiederworte annehmen, wir – deine Freunde – werden dich schon vor deinen Feinden schützen. Die einzige Wahl, die dir bleibt, wäre die Flucht.«
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber Cohen glaubte nicht, dass er dazu fähig war, sein Land und seine Familie zu verraten.
»Nimm es einfach hin, Cohen«, bat Solran ihn und legte ihm die Hand brüderlich auf die Schulter. »Wenn du den Krieg beenden willst, hast keine andere Wahl, als es anzunehmen.«
Cohen sah Solran in die Augen, die Mitgefühl aussprachen. Dann blickte er gen Himmel und musste sich unweigerlich fragen: »Ist das der Wille der Götter?«
Er hätte nie geglaubt, dass sie ihm noch am gleichen Tag eine Antwort darauf geben würden.
***
Die ganze Nacht schon versuchte er, das Schloss zu knacken. Und seit die Sonne durch die Gitterfenster drang, wurden seine Versuche immer verzweifelter.
Der Vergessene spürte unterdessen Eagles verwirrte Blicke im Nacken.
»Ich weiß zwar nicht, was du damit zu bezwecken versuchst, aber nachdem ich dir nun schon die ganze Nacht zugesehen habe, muss ich dir leider mitteilen, dass es zwecklos ist.«
Der Vergessene ließ seufzend die Schultern hängen und drehte sich zu Eagle um, der an seinem gewohnten Platz saß und die Stirn gegen die Stäbe lehnte.
Er ging zu ihm und setzte sich daneben.
»Ich dachte, hiermit würde ich das Schloss aufbekommen«, erklärte der Vergessene und hielt den Goldanhänger hoch, den er von des Königs Bastard geliehen bekommen hatte.
Es war völlig umsonst gewesen, das Ding war nutzlos.
Eagle lächelte matt. »Es ist jetzt ohnehin zu spät.«
Das entsprach einer geradezu ernüchternden Wahrheit. Die Zellen waren beinahe leer, weil die Gefangenen von den Wachen geholt und oben im Burghof hingerichtet wurden. Eagle und der Vergessene konnten der Menge zuhören, die erst die Verurteilten ausbuhten und schließlich jubelten, wenn sie hingen oder ihre Köpfe rollten.
Es war eine Massenhinrichtung, mehrere hundert Kriegsgefangene, Diebe und Mörder fanden am heutigen Tage den Tod.
Und Eagle und der Vergessene konnten nur darauf warten, dass sie an der Reihe waren.
Entmutigt ließ der Vergessene Kopf und Schultern hängen.
Eagle streckte die Hand zur Zelle herein und legte sie Trost spendend – oder danach suchend – auf seine Schulter.
Er hätte einfach nur zu gerne seinen eigenen Namen erfahren, bevor er sterben musste.
Es war ihm ohnehin schleierhaft, warum sein Körper sich weigerte, echte, an Panik grenzende, Furcht zu empfinden. Vielleicht begriff er noch nicht so ganz, was es bedeutete, hingerichtet zu werden. Er befürchtete, auf dem Weg zum Henker noch mehr als genug in Panik zu geraten. Dann, wenn ihm der Tod unmittelbar vor Augen geführt wurde.
Noch immer hatte er keine Ahnung, wer er war und woher er stammte, aber ihm ging das Gesicht des Bastards des Königs nicht mehr aus dem Sinn. Immer und immer wieder sah er die einprägsamen Züge vor sich, die ihm seltsam bekannt vorkamen.
Das Kinn war etwas länger und nach vorne geneigt, die vollen Lippen besaßen einen geradezu verführerischen, sinnlichen Schwung, die etwas hohlwirkenden Wangen waren von einem dunkelbraunen Bartschatten bedeckt gewesen, die Wangenknochen darüber lagen hoch und waren zusätzlich zu der breiten Stirn die männlichsten Züge. Die Augen lagen etwas tiefer im Gesicht, sodass die gerade Stupsnase nicht gänzlich unterging. Das dunkelbraune Haar, das etwas verstrubbelt vom Kopf abgestanden hatte, ließ ihn insgesamt genau als das wirken, was er war: ein Soldat, ein Bastard, kein Adeliger.
Aber diese Augen … Oh diese skeptisch dreinblickenden, immer argwöhnischen und klugen Augen, die von dunklen, langen Wimpern umrandet waren, besaßen einen Glanz, ein mysteriöses Funkeln, das einem nicht mehr aus dem Kopf ging.
Er kannte ihn.
Der Vergessene war sich noch nie so sicher gewesen, nicht seit er seine Erinnerung verloren hatte. Er kannte diesen Bastard. Aber so sehr er auch versuchte, sich an ihn zu erinnern, immer wieder blockierte eine unsichtbare Wand in seinem Kopf die Erinnerung.
Doch es war nicht allein das Gefühl, dass sie sich kannten, was ihn seit ihrer Begegnung durchgehend an den Bastard denken ließ. Es war die Güte, mit der er einem Todgeweihten begegnet war.
Nein, nicht nur einem Todgeweihten, sondern auch einem Feind. Wenn der Bastard nicht log – und er bezweifelte doch stark, dass diese Augen lügen konnten – dann hatte der Vergessene den Großvater des Bastards getötet. Doch als er die Möglichkeit hatte, sich dafür an ihm zu rächen, hatte er es nicht getan. Im Gegenteil, er hatte den Vergessenen von der Folter erlöst und ihm auch noch das Gesicht gewaschen.
Noch jetzt spürte der Vergessene die wohltuenden Berührungen auf Wangen und Stirn, er konnte sich in jenem Moment kein Seufzen verkneifen, das in Anbetracht der Situation etwas zu entspannt wirkte.
Er war seinem Feind gestern schutzlos ausgeliefert worden, und laut den Worten des Bastards, hätte er wohl jede Folter verdient, doch statt seine Lage auszunutzen, hatte der Bastard ihm sogar etwas Gutes getan. Ihm in seiner größten Not einen kleinen Trost gespendet.
Warum, wenn sie doch Feinde waren?
Auch diese Art von Güte kam ihm bekannt vor. Ein brennender Schmerz umhüllte sein Herz, doch sein Kopf wollte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, wann und bei wem er schon einmal solche Güte kennen gelernt hatte.
Frustriert ließ er den Kopf hängen und griff sich an die immer schmerzende Stirn.
»Woran denkst du?« Eagles Frage war das hoffnungslose Flüstern eines Mannes, der wusste, dass er bald sterben musste.
Grimmig starrte der Vergessene vor sich, gedankenverloren spielte er mit dem goldenen Fuchsanhänger in seinen Fingern. In ihm keimte der Gedanke auf, dass er hier nicht sterben wollte. Nicht einmal nur, weil er dem Tod entgehen wollte. Nein. Etwas in ihm regte sich, seit er den Bastard gesehen hatte, etwas, das zwar ein Teil von ihm war, aber doch nicht gänzlich zu ihm als Mann passte. Es war etwas Animalisches, etwas Uraltes, in ihm verankertes, das zum Leben erweckt wurde.
Er hatte noch etwas zu erledigen, dessen war er sich sicher. Doch er konnte beim besten Willen nicht erklären, woher er dieses plötzliche Wissen nahm.
Er schüttelte verdrossen den Kopf, weil er ja doch nichts an seiner Lage ändern konnte, und antwortete auf Eagles Frage: »An das Ende.«
Und dann kamen die Wachen, um sie zum Henker zu führen.
***
Die Sonne ragte oben am Himmel und strahlte auf die Hinrichtungen hinab. Cohen saß zusammen mit dem König, Lord Schavellen, Cocoun und Cocouns Frau – eine wunderschöne blonde Frau mit zierlichem Körperbau und freundlichem Gesicht, die besseres als diesen Sadisten verdiente – auf einem der Balkone der königlichen Burg.
Von hier oben aus hatten sie nicht nur einen guten Blick auf die Geschehnisse im Hof, auch sie waren für die Zuschauermenge – eine beachtliche Zahl war aus allerlei Dörfern hier erschienen um dem beizuwohnen – gut sichtbar und deutlich präsent.
Ebenso gelangweilt wie sein Vater, lehnte Cohen in seinem gepolsterten Stuhl und sah dabei zu, wie die Gefangenen gehängt oder geköpft wurden. Immer vier wurden zum Galgen gebracht, immer zwei zu den Henkern mit ihren großen Stahläxten. Cohen empfand keine Freude beim Zuschauen und fühlte sich keineswegs dadurch unterhalten, ganz anders die Menschenmenge, die jubelte, während andere sterben mussten.
Das Volk bewarf die Verurteilten mit faulem Obst, schubsten, schlugen und traten nach ihnen, wenn sie vom Kerker durch die Menge getrieben wurden, die Hände mit Seilen vor den Körpern zusammengebunden. Es zog sich endlos lange hin, und wäre es nicht seine Pflicht gewesen, hier zu sein, wäre er gegangen.
Doch zum einen wollte er den Kriegsgefangenen den nötigen Respekt erweisen, indem er ihren Tod betrachtete und annahm – Cohen empfand es als Schande, wenn er weggesehen und ihnen nicht die letzte Ehre erwiesen hätte –, und zum anderen spürte er deutlich Lord Schavellens und Cocouns verachtende Blicke auf sich ruhen. Cohens »Beförderung« war also im vollen Gange, der König musste bereits alle davon in Kenntnis gesetzt haben.
Cohen wusste nicht, ob er sich darüber freute. Ehrlich gesagt, war ihm danach, sich in sein Schwert zu stürzen.
Er sah hinab in die Menge und fand seine Männer weit hinten am offenem Hoftor, die mit ernsten Mienen die Hinrichtungen verfolgten. Er wusste, dass er als König die Macht hätte, ihnen ein besseres Leben zu schenken. Doch was war mit all den anderen? Es war gewiss nicht einfach, ein Herrscher zu sein, schon gar nicht, wenn man in Wirklichkeit nur ein Lakai fanatischer Kirchenangehörigen war, die nichts mit der eigentlichen Religion seines Volkes zu tun hatten. Immerhin predigten die alten Schriften von Frieden, Gnade und Vergebung. Doch die Anhänger der Kirche nutzten ihre Macht nur dazu, um ihre eigene Mordlust zu stillen. Lord Schavellen war einer davon.
Die Priester, die Cohen während seiner Ausbildung kennengelernt und lieben gelernt hatte, waren anders als die Männer, die angeblich die Gesetze ihrer Religion vertraten. Einige dieser Priester, die Cohen als junger Bursche gekannt hatte, waren sogar zu den Rebellen übergelaufen. Und das sagte doch schon alles aus.
Wie sollte Cohen mit all diesen intriganten Fanatikern umgehen, wenn nicht einmal sein kluger Vater es vermocht hatte, sich von ihren Ketten zu befreien. Und das alles verdankten sie der unüberlegten Hand seines Großvaters, der um jeden Preis die Krone hatte an sich reißen müssen. Hätte Rahff der Erste klüger gehandelt, hätte er nicht die Kirche als Fundament für seine Herrschaft ausgewählt und damit veranlasst, dass Fanatiker das gesamte Land ins Chaos führten. Aber Cohen hatte schon lange den Gedanken, dass es vielleicht genauso geplant gewesen war.
Cohens Vater schielte ihn von der Seite an und rang sich ein mitfühlendes Lächeln ab. Sicher wusste er, was seinem Sohn durch den Kopf ging, so wie immer. Es war erstaunlich, wie gut Rahff seinen Bastard kannte. Cohen hatte als Kind meist schon Ärger für Streiche bekommen, die er nur als Gedanken geformt hatte. So, als hörte sein Vater, was er dachte. Anfangs hatte er seinen Vater deshalb für eine Art Zauberer gehalten, doch heute wusste er, dass Rahff ihn einfach nur sehr gut durchschauen konnte.
Es gab jedoch ein Gutes daran, wenn Cohen tatsächlich den Thron erben sollte. Sigha und die Kinder hätten ein schöneres, angenehmeres Leben. Außerdem würde Marks, als Cohens Erstgeborener, Kronprinz werden. Was wiederrum bedeuten würde, dass die Krone an Raaks Erben gehen sollte. König Rahff wusste als einer der wenigen davon, dass Marks und Ilsa Raaks Kinder waren, was – so vermutete Cohen – zu seiner Entscheidung beigetragen hatte, Cohen zum Erben zu ernennen.
Doch noch war Rahff nicht zu alt und noch war er potent genug – soweit Cohen wusste – um mehr Söhne zu zeugen. Der König konnte sich eine weitere Frau nehmen – Raaks und Sevkins Mutter starb schon vor Jahren an einer Lungenkrankheit – und vielleicht noch einen Erben hervorbringen. Aber sollte er sterben und keinen weiteren männlichen Erben gezeugt haben, so würde dann wohl Cohen den Thron besteigen.
Welch seltsame Vorstellung.
Der König beschloss, seinen Sohn aufzumuntern, und lehnte sich vertraut zu ihm hinüber, um ihm mit rauer Stimme zuzuflüstern: »Von all meinen Frauen, liebte ich deine Mutter am meisten.«
Cohen zwang sich zu einem Lächeln. Wenn er an seine geliebte Mutter dachte, wurde er immer wehmütig.
»Und von all meinen Söhnen«, fügte der König gestehend an, »liebte ich dich am meisten.«
Cohen blickte seinem Vater zuerst überrascht in die Augen, aber als er die Aufrichtigkeit darin las, verzog er gerührt die Lippen.
Rahff lächelte aufmunternd. »Du warst dabei, als wir Nohva zu unserem Königreich machten, Cohen. Es ist nur gerecht, wenn ich es nach meinem Tod in deine Hände lege.«
Cohen erinnerte sich noch deutlich an den Tag, als er als kleiner Junge auf Rahffs Arm gesessen und in die untergehende Sonne geblickt hatte, vom Palast in Dargard aus, wo gerade erst ein abscheuliches Verbrechen begangen worden war.
»Ich rieche noch heute die Überreste der verbrannten Kirche«, sagte Cohen voller Grauen.
Rahff runzelte die Stirn, als verstünde er Cohen nur zu gut. Doch er sagte eindringlich zu seinem Sohn: »Vergiss nicht, was die Luzianer uns angetan haben. Was sie deiner Mutter angetan haben.«
Cohen sah seinem Vater fassungslos in die Augen. Natürlich würde er das nie vergessen, aber: »Und was tun wir den Wüstenbewohnern an, wenn wir ihre Tempel plündern und ihre unbewaffneten Priester abschlachten?«
Außerdem glaubte Cohen bis heute nicht, dass es ein Luzianer war, der seine Mutter umbrachte. Doch davon hatte Rahff nie etwas hören wollen. Er hatte Cohen strikt verboten, je wieder darüber zu sprechen. Vermutlich, weil er sich die Wahrheit nicht eingestehen wollte.
Vier weitere Gefangene wurden zu den Galgen geführt, und Cocoun, der rechts von Cohen saß, lenkte seine Aufmerksamkeit darauf.
Er stieß Cohen den Ellenbogen in die Seite und sagte höhnisch: »Sieh hin, Cohen! Das hat man auch mit deinem Bruder gemacht.«
Cohens Kopf flog mit einem hasserfüllten Blick zu ihm herum.
Doch Cocoun lächelte nur hinterhältig.
»Er hat gezappelt und gewürgt«, provozierte Cocoun ihn weiter. Er lachte, als er erkannte, dass seine Gemeinheiten die gewünschte Wirkung zeigten.
»War wirklich amüsant, wie er an dem Strick zappelte, ganz genauso wie ein Fisch an der Angel«, fuhr er fort.
Cohen kochte vor Wut, seine Hände umfassten die Stuhllehne, bis sie unter dem Druck seines Griffs zu knacksen begannen.
»Er hat sich eingepisst«, erzählte Cocoun schadenfroh. »Und als er hing, wurde er steif und spritzte ab. Das ist oft so, wusstest du das? Hat nichts mit Lust zu tun, ist nur eine gewöhnliche Nebenwirkung.«
Mit bebenden Nasenflügeln starrte Cohen Cocoun unverhohlen hasserfüllt an.
Cocoun lachte wieder, dann machte er mit der Hand eine Geste, als wickelte er sich ein Seil um den Hals, zog es zu und hing sich selbst daran auf. Er machte ein erstickendes Gesicht und streckte die Zunge raus.
Cohen sprang auf und wollte auf ihn losgehen – worauf Cocoun abgezielt hatte – als Rahff ihn mitten in der Bewegung wieder auf den Stuhl drückte.
»Eines Tages«, flüsterte Rahff Cohen ins Ohr, »wirst du über ihn triumphieren. Aber nur die Geduldigen werden auch belohnt. Bewahre die Haltung, Sohn!«
»Ja, Vater«, knurrte Cohen und versuchte, sich zurückzunehmen, was ihm nur gelang, indem er seine gesamte Willenskraft aufbrachte und den Blick von Cocoun abwandte.
Unten im Hof wurden zwei weitere Gefangene auf das Podium geführt, damit die Henker ihnen die Köpfe abschlagen konnten, währen die anderen vier Verurteilten noch mit dem Tod am Galgen kämpften.
Es war der Luzianer und der Dieb, die hintereinander hergingen.
Als Cohen sie erblickte, hoben sie fast zeitgleich die Köpfe und sahen ihm in die Augen, als hätte eine höhere Macht es ihnen befohlen.
Stirnrunzelnd betrachtete Cohen sie – ein grünes und ein blaues Augenpaar – während er in seinem Kopf wieder das Flüstern hören konnte.
Er wusste, beide hätten einen besseren Tod verdient, doch leider lag es nicht in seiner Macht, ihnen einen ehrenhaften Tod zu gewähren.
Seine Augen blieben an dem grünen Augenpaar hängen. Sie waren so aufmerksam, so klug und so ungebrochen, dass er gar nicht anders konnte als sie zu bewundern. Und je mehr sich sein Blick mit ihnen verhakte, je schneller raste sein Herz.
***
Noch vor wenigen Augenblicken, unten in den Zellen, hätte er nicht gedacht, dass er derartige Furcht und Scham empfinden konnte. Während er Eagle voraus von den in Eisenrüstungen steckenden Wachen durch die Menge geschupst wurde, buhten die Leute sie aus, bewarfen sie mit fauligen Tomaten und halben Salatköpfen, traten und bespuckten sie.
Selbst als der Bastard dem Vergessenen erzählte, er sei ein Feind der Krone und ein Königsmörder, hatte er in keiner Weise Schuld empfinden können. Doch jetzt, da er all den Hass spürte, der sich auf ihn richtete, fragte er sich, ob er vielleicht doch nur ein skrupelloser Mörder war, der all das verdiente.
Sie kamen an die Stufen des Holzpodiums, das anlässlich zu ihrer Ermordung errichtet worden war. Der Verlassene blieb wie angewurzelt stehen. Es war ihm plötzlich unmöglich, die letzten Schritte zu gehen.
Eagle, der von den Wachen geschubst wurde, krachte gegen seinen Rücken.
»Bei den verfluchten Göttern, ihr Bastarde!«, zischte Eagle wütend.
Hysterie stieg in dem Verlassenen auf, er musste lachen. »Du bist doch der Bastard.«
»Das weiß ich nicht«, erwiderte Eagle bedächtig – der seinen Humor selbst jetzt nicht verloren hatte –, »wir können nur mit Bestimmtheit sagen, dass mein Vater mich augenscheinlich nicht wollte.«
»Wahrscheinlich, weil du damals schon ein Klugscheißer warst«, erlaubte sich eine der Wachen zu ergänzen. Die andere Wache lachte mit ihm.
Eagle schmunzelte den Vergessenen an und zuckte mit den Schultern. Dann nahm sein Blick etwas Mitfühlendes an.
»Wir gehen gemeinsam, vergiss das nicht«, sagte Eagle schließlich ernst.
»Los jetzt!«, drängten die Wachen und stießen sie regelrecht die Stufen nach oben, sodass sie nacheinander stolpernd vor die Henker traten.
Es beruhigte den Verlassenen ungemein, dass er nicht alleine dort oben stand. Trotzdem schnürte es ihm die Kehle zu, als er den Blick über die Menge der Menschen schweifen ließ, die mit erhobenen Fäusten nach seinem Tod verlangten.
Sie wurden nebeneinander mit dem Rücken zu den Henkern hingestellt, die in schwarze Ledermonturen gehüllt waren. Es waren mehr Ochsen als Männer, groß und fettleibig, ihre Gesichter waren durch die schwarzen Kapuzen, die über ihre Köpfe gestülpt waren, nicht zu erkennen. Nur Löcher für die Augen ließen vermuten, dass sich Lebewesen darunter befanden. Beide hielten mannsgroße Äxte, die sogenannten Richtbeile, in den Händen, deren lange und massive Stiele am Ende mit Schneiden aus Eisen ausgestattet waren. Perfekt dazu geeignet, einem Mann mit einem Hieb den Kopf abzutrennen.
Der Vergessene starrte nicht weiter die Axt an, er richtete den Blick nach vorne, wie es ihm befohlen wurde, und starrte noch einmal hinauf zu den Balkonen, wo er den König und sein Gefolge erblickte.
Der König trug keine Krone, ihm war sein Titel nur an seiner Haltung und seinem hölzernen, mit roten Stoff gepolsterten Thron anzusehen. Neben ihm saß sein Bastard, der sich mit ebenso angespannter Miene wie der König nach vorne lehnte.
Der Verlassene verspürte für einen winzigen Moment das Bedürfnis, den Bastard anzuflehen, ihn zu verschonen. Doch ein Blick auf den König genügte, damit er den Mund hielt.
Etwas in ihm hasste diesen Mann, ohne dass er es sich erklären konnte. Seine Verachtung reichte so tief, dass er zu stolz war, um demütig um sein Leben zu flehen.
Er glaubte auch nicht, dass der König es ihm gewährt hätte. Jedoch sah er in den Augen des Königs Bastards ein so tiefes Bedauern, dass er sich beinahe sicher war, dass er diesen nur leise hätten bitten müssen, und er hätte ihn und Eagle zumindest wieder lebendig zurück in die Zellen sperren lassen.
Doch dazu würde es nicht mehr kommen.
Der Vergessene blickte schließlich hinab auf den Richtblock. Es war deutlich zu sehen, dass hier heute viele Köpfe gerollt waren. Blutlachen waren zwar mit Stroh weggewischt worden, doch die dunkelrote Flüssigkeit war tief in die Holzfasern gesickert.
Die Sonne, die auf ihn hinab strahlte, ließ erkennen, dass das Blut noch frisch war. Es stank in der Hitze.
Jetzt war ihm so speiübel, dass er nur mit Mühe ein Würgen unterdrücken konnte. Seine Beine zitterten, und sein Atem stockte.
Er sah zu Eagle, der die Augen schloss und leise fluchte, auch er zitterte, sogar am ganzen Leib. Seine Hose färbte sich im Schritt dunkel; und er fluchte noch mehr.
Sie wurden auf die Knie gestoßen, woraufhin die Menge verstummte.
Ein fettleibiger Mann mit schütteren, ergrauten Haar, der eine rotweiße Robe trug, auf deren Brust das Zeichen einer halben Sonne und eines halben Mondes gestickt war, betrat das Podium und begann damit, zuerst Eagles Vergehen vorzulesen.
Als er anfing, seine Liste runter zu rattern, sahen sich Eagle und der Vergessene vollkommen verwirrt an. Es war ohnehin seltsam, dass Eagle als einfacher Dieb nicht zum Galgen geführt wurde. Die Enthauptung wurde nur bei Kriegsgefangenen durchgeführt, nicht aber bei gewöhnlichen Dieben.
Laut dem Kirchenangehörigen soll Eagle ein Verräter der Krone sein, dem es verboten war, Nohva zu betreten – ganz wie bei dem Verlassenen – und der aufgrund dessen, dass er in den königlichen Ländereien aufgegriffen worden war, zum Tode durch das Richten mit blutiger Hand verurteilt wurde.
Dann kam der Vergessene an die Reihe. Er hoffte darauf, seinen Namen zu erfahren, aber dieser Wunsch blieb ihm verwehrt.
»Der hier kniende Mann ist ein Königsmörder«, verkündete der Vorleser, »der trotz Verbannung unbefugt zurück nach Nohva kehrte und deshalb auch – wie der junge Mann neben ihm – zum Tode durch das Richten der blutigen Hand verurteilt wird.«
Der Vergessene blickte noch einmal hinauf zum Balkon und sah den Bastard des Königs den Kopf schütteln, als wollte er ihm sein Bedauern kundtun. Seltsamerweise fand er in den Augen seines vermeidlichen Feindes Trost.
»Mögen die Götter im Himmelsreich über Euch richten«, endete der Priester und verließ – die Schriftrolle zusammenrollend – das Podium in großer Eile, als habe er Angst, Blut könnte das reine Weiß seiner Robe besudeln.
Eagle und der Vergessene wurden gezwungen, sich vorzubeugen und die Köpfe abzulegen, ihre Hände blieben vor ihren Körpern zusammengebunden.
Der Vergessene schloss die Augen, hielt es aber dann doch nicht aus, nur darauf zu warten, dass der Henker sein Richtbeil schwang. Er musste es sehen und öffnete die Augen. Und so blickte er plötzlich direkt in Eagles Gesicht. In jenem Moment leuchtete ein Strahl der Sonne direkt in Eagles Augen und ließen sie in voller Pracht erstrahlen. Augen, die der Vergessene kannte, in der finsteren Zelle aber kaum zu erkennen gewesen waren.
Augen wie Eis. Eisblaue Augen!
Dann geschah plötzlich alles in Zeitlupe. Der Vergessene erinnerte sich nicht, wo er diese Augen schon einmal gesehen hatte, aber sein Herz machte einen Satz und schlug dann schneller als zuvor. Eagle durfte unter keinen Umständen sterben!
Der Vergessene musste ihn retten!
Etwas Großes erwachte in ihm und regte sich …
Noch einmal lächelte Eagle, es wirkte verkrampft. »Wir sehen uns in der Nachwelt …«
Der Vergessene sah dabei zu, wie die Axt auf den Nacken seines Freundes zuraste, und wünschte sich noch, er könnte die Zeit anhalten. Doch die Schneide der Axt zerbrach an Eagles von Schuppen überzogener Haut, als der Hof plötzlich von einem grellen Licht erfüllt wurde…
***
Während sich alle anderen erschrocken wegdrehten und die Arme hochrissen, um ihre Augen vor dem grellen Lichtblitz zu schützen, saß Cohen einfach nur da und verstand nicht, was vor sich ging.
Auch er sah den Blitz, aber er tat ihm nicht in den Augen weh.
Was er aber durch das Licht sah, das für ihn wie Nebel wirkte, ließ ihn leichenblass werden.
Außerstande, zu begreifen, was vor seinen Augen geschah, musste er tatenlos dabei zusehen, wie sich ein Mann in eine unbändige, zerstörerische Kreatur verwandelte, die alles in ihrer Nähe in und Schutt und Asche zerlegte. Und das, obwohl sie sich gerade erst entfaltet und noch nicht damit begonnen hatte, Rache zu üben.
Als der Blitz die Augen der anderen Anwesenden geblendet hatte, waren erstaunte, etwas ängstliche Rufe zu hören gewesen. Aber als das Licht sich verzog und die Menschen wieder etwas sehen konnten, wurden furchtvolle Schreie laut, die im ganzen Gebirge zu hören waren.
Die Menge begann, in alle Himmelsrichtungen zu fliehen.
Cohen – so wie alle anderen auf dem Balkon – saß wie versteinert da, als der Drache sich entfaltete, seine ledernen Schwingen ausbreitete und einen kreischenden Laut ausstieß, dessen dunkler Wiederhall den Boden erbeben ließ.
Er hatte schon Drachen gesehen, aber in Büchern und auf Gemälden, und die hatten sich nicht von einem Mann in ein Tier verwandelt. Cohen blinzelte verwirrt, er wusste nicht, ob er an seinem Verstand zweifeln sollte.
Vermutlich zum ersten Mal in seinem Leben, saß Cocoun still und versteinert in seinem Stuhl und wagte nicht einmal zu atmen.
Cohen betrachtete den Drachen wie er einen Feind betrachtete, wie es jeder Soldat getan hätte. Diese Kreatur war mit Abstand das größte Geschöpf, das er je gesehen hatte. Er schätzte – wobei er zugeben musste, dass er nicht gut im Schätzen war – dass der Drache von der schuppigen Spitze seiner Nase bis hin zu der Spitze seines langen Schwanzes fast hundert Fuß lang war.
Der Drache drehte sich und fegte mit seinem Schwanz durch die Menge, dabei erwischte er die Henker. Der Dieb, an dessen Haut das Richtbeil zerbrochen war, lag noch verwirrt auf dem Boden und kam nur langsam zu sich.
Der Drache war noch einmal gute sechzig Fuß hoch, wenn er den Kopf hob, aber vom Boden bis zu seinem Rücken waren es nur etwa fünfundzwanzig Fuß.
Cohen beobachtete, wie die Kreatur sich drehte und hierhin und dorthin schnappte. Sie erwischte einige Wachen, schüttelte sie in ihrem riesigen Maul, aus dem schließlich mit Blut gemischter Speichel troff, und schleuderte die toten Körper in die Menge.
Noch mehr Schreie wurden laut.
Der König kam in Bewegung und sprang mit einem Ruck auf. Er rief seiner Leibgarde zu: »Bogenschützen! Auf die Wälle!«
Sofort eilten einige Männer los. Cohens eigene Männer versuchten unterdessen, die Leute in Sicherheit zu bringen, indem sie die in Panik geratene Menge aus dem Tor winkten.
Cohen betrachtete das Maul des Drachen, in dem sich Zähne, so dick wie ein männlicher Unterarm, befanden. Der Kopf des Drachen machte ihm am meisten Sorgen, obwohl der Hieb mit dem Schwanz auch nicht zu unterschätzen war. Jedoch besaß die Kreatur nicht nur scharfe Zähne, sondern auch gewaltige, geschwungene Hörner, wie die Bergwidder sie besaßen.
Der Drache rammte die vorderen Klauen in den Boden, das Podium unter ihm zerbrach, er streckte den Kopf gen Himmel, um erneut zu brüllen. Es klang nach Triumph.
Die Bogenschützen positionierten sich auf den Wehrgängen über dem Tor und schossen ihre Pfeile ab. Die Geschosse zerbrachen an den braunen Schuppen, die wie eine Panzerung wirkten.
Der Drache bekam nicht einmal einen Kratzer ab.
Der König und Cohen sahen sich fassungslos an. Was sollten sie jetzt tun?
Das Flüstern drang zurück in Cohens Ohr, dieses Mal war es nicht nur in seinem Kopf, er hörte die fremde Sprache deutlich über den Hof wehen; doch er schien der einzige zu sein, der sie hören konnte.
»Ikr vouno oekr psso woulikrfol.«
Ich werde euch alle vernichten.
Cohen beobachtete aus blinzelnden Augen, wie die königliche Leibgarde mit Schwertern und Schilden um den Drachen herum Stellung bezogen. Keine Klinge konnte die Schuppen durchbrechen.
Da kam Cohen ein Geistesblitz: »Es sind die Waffen.« Er wusste das, weil er gegen Dämonen gekämpft und versagt hatte. Einige unter ihnen waren gegen Eisen immun. Es verletzte sie, doch die Wunden heilten wieder. »Eisen kann nur Menschen töten.«
»Was?« Cocoun sah ihn verwirrt an.
Aber Cohen wandte sich nur zu seinem Vater um: »Es ist das Eisen! Es kann den Schuppenpanzer nicht durchdringen. Er ist kein Mensch, kein Tier!«
Die harte Miene seines Vaters verriet Cohen, dass er verstanden hatte.
Cohen wusste, dass es eine Waffe in der Burg gab, die nicht aus Eisen war. Es war das Schwert, das der Luzianer bei sich getragen hatte, bevor er in den Kerker geworfen worden war.
Cohen überlegte nicht länger, er sprang auf und rannte in die Burg zurück.
Die Besitztümer des Luzianers befanden sich in einer Truhe in den Gemächern des Königs. Cohen fand sie recht schnell, während draußen die Schreie noch lauter wurden und der Drache sich über die Menschenmenge hermachte.
Warum flog er nicht fort, fragte Cohen sich, während er die Truhe durchwühlte. Er könnte in die Freiheit entkommen. Aber es schien, als wartete der Drache auf etwas.
Aber worauf?
Cohen fand das Schwert unter der dicken Lederrüstung. Er betrachtete die Montur eine Weile, bis er draußen etwas hörte, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Der Drache brüllte, aber es hörte sich dieses Mal seltsam erstickt an.
Das Flüstern sagte: »Toeou.«
Feuer.
Und dann hörte er die qualvollen Schreie derer, die in das Feuer gekommen waren.
Cohen befühlte noch einmal das dicke Leder und rieb es zwischen den Fingern. Er hatte keine Rüstung am Leib, und ihm blieb keine Zeit, nach Hause zu laufen um sich seine eigene anzuziehen. Kurz entschlossen legte er alles an, was dem Luzianer gehörte.
Als er auf den Balkon trat, riefen der König und Lord Schavellen Befehle zu ihren Männern. Der halbe Hof war verbrannt, verkohlte Leichen lagen herum. Cohen stellte jedoch erstaunt fest, dass der Stein, aus dem die Burg bestand, dem Drachenfeuer standgehalten hatte.
Der Drache wütete noch immer, er stand über den Trümmern des Podiums und schien sie zu beschützen.
Aber natürlich!
Cohen begriff, dass der Drache den Dieb beschützte, der irgendwo unter den Trümmern liegen musste.
Cohen nahm Cocouns hübsche Frau an die Hand und zog sie aus dem Stuhl. Er winkte einer Leibwache und bat diese, die verängstigte Frau in einen sicheren Raum zu bringen.
Als er sich umdrehte, packte der König ihn an den Schultern. »Er darf nicht entkommen!«
Cohen nickte und machte sich los. Er blickte hinab auf den Drachen. Die Soldaten hatten von unten keine Chance. Ihm blieb nur eine Wahl. Er musste versuchen, auf den Rücken des Drachen zu springen.
Cohen zog das Drachenflügelschwert, das Heft wurde heiß, als wollte die Klinge sich gegen ihn wehren, aber er hielt sie tapfer fest. Er kletterte behände auf das Geländer und sprang mit gezogener Klinge auf den Rücken des Drachen.
Er landete auf einem ausgebreiten Flügen, die Klinge bohrte sich durch ihn hindurch und schnitt ihn auf, während Cohen hinabrutschte. Der Drache brüllte und schlug mehrmals mit den Schwingen, sodass Cohen mehr unbeabsichtigt als geplant am Ansatz des langen Schwanzes landete, die Klinge noch fest in der Hand. Er drehte sich um und hielt sich gerade rechtzeitig fest, als der Drache herumsprang. Das große Maul schnappte nach ihm.
»Nein!«, schrie Cohen erschrocken, als ihn die Zähne fast erwischten.
Noch einmal holte der Drache mit dem Kopf aus, um nach ihm zu schnappen, als Cohen erneut brüllte: »Nein! Stopp!«
Die Zähne hätten ihn dieses Mal erwischt, wenn der Drache nicht innegehalten hätte. Unmittelbar vor Cohens Gesicht – der den heißen, nach Schwefel riechenden Atem spüren konnte – klappte die Kreatur die Zähne wieder zusammen.
***
Eagle stieß die Trümmer von sich und kam hustend aus dem Schutthaufen hervor. Erst bemerkte er nur am Rande die große Kreatur, die über ihm ragte, denn zu allererst nutzte er das Chaos, um mit den Zähnen seine Fesseln zu lösten und seine Hände zu befreien.
Er schüttelte sein rotblondes Haar aus, das von Staub und Spänen bedeckt war, und sah nach, ob das Tagebuch noch immer unter seinem Arm klemmte. Es war erstaunlich, dass die Wachen nicht bemerkt hatten, dass er es wie einen Schatz hütete.
Er griff sich in den Nacken, nur um festzustellen, dass er hinterher kein Blut an den Fingern hatte. Wer hätte gedacht, dass seine Krankheit auch mal etwas Gutes zutage brachte? Ohne die Schuppen befände sich sein Kopf nun nicht mehr zwischen seinen Schultern, er verdankte es seiner grässlichen Haut also, noch am Leben zu sein.
Ein Brüllen erfüllte die Umgebung, das ihm in den Ohren wehtat.
Erst dann begriff er, dass er sich unmittelbar in der Nähe eines Drachen befand. Mit großen Augen drehte er sich um und blinzelte an dem Ungetüm hinauf, das mit seinen großen, krallenbesetzten Klauen erstaunlich geschickt um ihn herumtanzte, als wüsste es, dass er hier stand.
Eagle drehte sich aus einem Fluchtreflex heraus um und wollte davonrennen, als er sich plötzlich einer Wand bewaffnetet Soldaten gegenübersah.
»Oh, Mist!«, fluchte er.
Sie griffen den Drachen an, aber einige von ihnen erkannten ihn und wollten ihn natürlich davon abhalten, das Chaos zu nutzen, um zu fliehen.
Eagle überlegte nicht lange, er nutzte seine Kenntnisse, die ihm auf der Festung seiner Mutter beigebracht worden war, um sich zu verteidigen.
Ein Soldat sprang auf ihn zu und schlug mit dem erhobenen Schild nach ihm. Eagle hob die Arme zur Abwehr. Es tat weh und er taumelte zurück, konnte sich aber auf den Beinen halten. Der Soldat ließ die Deckung fallen, um mit der Klinge nach Eagle zu schlagen. Doch Eagle war außerordentlich schnell. Er sprang zur Seite, packte das Handgelenk des Soldaten, drehte es herum, bis die Klinge in dessen Richtung zeigte und er die Finger öffnete.
Egale nahm ihn die Klinge ab und stieß sie dem überraschten Soldaten in den Bauch, bevor dieser den Schild heben konnte. Eagle konnte vielleicht kein Tier jagen, aber er hatte Kenntnisse im Schwertkampf, wenn auch nur durch Duelle ohne Blutvergießen.
Sein unerwarteter Erfolg lockte andere Soldaten der Garde an.
Eagle verlor sein Lächeln, als er sie auf sich zukommen sah. »Ach kommt schon!«, fluchte er und sah gen Himmel. Er stand den Göttern nicht sehr nahe, und manchmal war ihr Humor wirklich mieser als seiner, aber er glaubte zumindest, dass es sie gab. Jedoch nur zur Sicherheit – wenn er starb und es gab sie wirklich, war er immerhin kein Ungläubiger. Wenn er starb und es gab sie nicht, dann war es ohnehin egal.
Er hob den Schild auf, da er jedoch noch nie mit einem Schild gekämpft hatte, gelang es seinen Angreifern, ihm den Schild wieder abzunehmen.
Eagle parierte die Schwerthiebe, die auf ihn niedergingen und wurde dabei immer weiter zurückgedrängt, er kam nicht dazu, erneut einen Soldaten zu verletzten. Sie waren zu gut. Der erste Soldat, den Eagle besiegt hatte, war wohl nur dem Anfängerglück zum Opfer gefallen.
Eagle nutzte seine einzige Chance. Er rollte sich unter den Drachen, der sich um Kreis drehte, weil er nach etwas schnappte, das Eagle nicht sehen konnte.
Die Angreifer folgten ihm siegesgewiss. Es war ihr Fehler.
Der Drache hielt für den Bruchteil eines Augenblicks inne. Dann drehte er sich unerwartet und fegte Eagles Angreifer mit dem Schwanz fort.
Eagle atmete fassungslos aus, als er die Männer der Garde an der Burgmauer zerschellen sah. Er glaubte nicht, dass sie die Wucht des Aufpralls überlebt hatten.
Welch Ungeheuer da über ihm ragte!
Aber ob es ihm gefiel oder nicht, der Drache war jedoch im Augenblick seine einzige Fluchtmöglichkeit. Zumal mehr Soldaten auf ihn zukamen.
Eagle rollte sich unter dem Bauch des Drachen hervor, er ließ das Schwert fallen und kam auf der anderen Seite zum Vorschein. Auch hier waren Wachen.
Der Drache schlug unerwartet mit den überdimensionalen Flügen und hob vom Boden ab. Der Windstoß fegte Staub und Dreck auf, er ließ außerdem die Soldaten zurücktaumeln.
Eagle hatte keine große Wahl, es gab nur den Weg nach oben …
***
Cohen gelang es, zu den Schultern des Drachen zu klettern, wobei er sich immer wieder festhalten musste, weil ihn die ruckartigen Bewegungen beinahe abwarfen. Er musste zum Kopf gelangen, um dort die Klinge durchzustoßen, er glaubte nicht, dass der Drache anders zu töten war.
Vorsichtig richtete er sich auf, um die Schuhsohlen auf die Schuppen zu stellen. Erstaunt bemerkte er, dass die trockenen Schuppen geradezu haftend wirkten, wenn er die Füße daraufstellte. So gelang es ihm, zum Halsansatz zu laufen.
Doch dann ging ein gewaltiger Ruck durch den massigen Körper der Kreatur. Die ledernen Schwingen schlugen nach unten und nutzten den Windstoß, um den Drachen in die Luft zu befördern. Der gewaltige Köper schwebte nun über dem Boden.
Cohen kam ins Straucheln und hielt sich an den Schuppen fest, beinahe wäre er hinuntergefallen.
»Tsioh ndkr mif, Tseogfouou«, lachte die schlangenartige Stimme schadenfroh.
Flieg doch mit, Flüsterer.
Cohen baumelte an der Seite des Drachen, der rechte Flügel, der sich schwer auf und ab bewegte, gab ihm notdürftig halt. Die Klinge in seiner Hand zog ihn hinab, während er sich an einer Schuppe festklammerte.
Ihm blieb keine andere Wahl, als die Klinge wieder in die Scheide zu stecken. Nachdem er das bewerkstelligt hatte, drehte er sich um, griff mit der anderen Hand nach einer weiteren Schuppe und stemmte die Füße gegen den Körper des Drachen, um sich rauf zu ziehen.
Oben angekommen, sah er es.
Fassungslos beobachtete er, wie der rothaarige Dieb neben dem Drachen stand und mit unschlüssiger Miene zu ihm hinaufsah.
Cohen brüllte noch: »Nein!« Aber da sprang der Dummkopf doch tatsächlich in die Luft und schnappte sich in seiner Naivität eine Spitze des schlagenden Flügels.
Cohen sah dem schreienden Mann mit offenem Mund nach, als er bei der Aufwärtsbewegung nach oben geschleudert wurde. Statt loszulassen, hielt sich der Dieb weiterhin am Flügel fest.
Eigentlich konnte es Cohen egal sein, aber sein Mund war schneller als dieser Gedanke.
»Lasst los!«, rief er dem Mann zu.
Cohen wusste nicht, ob er ihn verstanden hatte, aber als der Dieb erneut in die Luft geschleudert wurde, ließ er los.
Brüllend wirbelte der Körper durch die Luft und sauste auf Cohen zu, während der Drache unter ihm schließlich abhob. Der Dieb krachte gegen Cohen, der sich zur Seite gelehnt hatte, um ihm auszuweichen, aber es war zu spät. Sie rollten in einander verkeilt seitlich hinab.
Im allerletzten Augenblick bekam Cohen eine Schuppe zu fassen und rettete sich.
Sein Herz schlug ihm bis zum Hals.
Der Drache flog wie ein abgeschossener Pfeil senkrecht nach oben. Die Geräusche am Boden wurden immer leiser, bis bald nur mehr der reißende Windstrom zu hören war.
Ein gewaltiges Gewicht zog Cohen in die Tiefe. Als er an sich hinabsah, erblickte er die weit aufgerissenen Augen des Diebs, dessen Hand Cohen eisern umklammerte.
»Ihr … habt mich gerettet?«, brüllte der Dieb. Es klang nach einer Frage.
Natürlich hatte Cohen ihn gerettet. Er konnte nicht einfach einen Mann in die Tiefe stürzen lassen, wenn er fähig war, ihm das Leben zu retten. Es würde allem wiedersprechen, woran er glaubte. Sie waren nicht im Kampf mit einander, und außerdem … Gut, Cohen gab zu, dass er keine Ahnung hatte, warum er diesen Vollidioten gerettet hatte. Es war ihm in diesem Augenblick einfach richtig erschienen. Eine höhere Macht, wie er glaubte, musste ihn wieder einmal gelenkt haben. Der Dieb verdankte es allein den Göttern in ihrer unergründlichen Weisheit, dass er noch lebte.
Cohen biss die Zähne zusammen und zog den Dieb zu sich hoch. Dieser klammerte sich, sobald sie auf Augenhöhe waren, an Cohen fest, und Cohen kletterte wieder hinauf, wo er sich hinter den Halsansatz des Drachen setzte und den zitternden Dieb des Diebes an sich drückte.
»Oh Götter …«, stöhnte der blasse Mann.
Cohen legte ihm von hinten einen Arm um. »Bloß nicht runter sehen.«
»Danke, hatte ich nicht vor.«
Cohen hingegen tat es. Und es war atemberaubend.
So weit war vor ihm noch nie ein Mensch dem Boden fern gewesen. Die Wälder, die Flüsse, die Wiesen, die Dächer der Bauernhäuser, das Vieh auf den Weiden, alles wirkte so winzig von hier oben. Der Krieg, alle Sorgen, alle Intrigen, nicht einmal der Wille seines Vaters reichten bis hier hinauf. Dort in der Luft spürte Cohen zum ersten Mal in seinem Leben, was Freiheit bedeutete.
Es hätte die schönste Erfahrung seines Lebens sein können, wäre er nicht beunruhigt gewesen, weil der Drache mit außerordentlicher Geschwindigkeit auf die südöstliche Wildnis zuraste; ein Gebiet das Cohen nicht kannte und das Gerüchten zu folge eine der lebensfeindlichsten Umgebungen Nohvas war.
Der Flug dauerte vermutlich um einiges länger, als er ihm vorkam, aber hier oben bedeutete Entfernung nichts. Nichts Irdisches hatte bei dieser Höhe irgendeine Bedeutung.
Sie drei waren frei. Feinde untereinander, aber dem Himmel so nah, waren sie frei von Hass.
Mit einem Mal riss das stetige Flüstern ab, das Cohen nur selten entziffern konnte, und er spürte, wie der Drache in der Luft ins Strudeln kam, so als sei er ohnmächtig geworden.
»Was …?«, entfloh es dem Dieb angstvoll.
Cohen schüttelte nur noch den Kopf, dann stürzte der Drache langsam ab und krachte in einen Berg.
***
Der Vergessene rollte sich auf den Rücken und stöhnte unter Schmerzen. Er sah nichts, er hörte nichts, er konnte nichts wahrnehmen; außer dem Schmerz in seinem Leib.
Er glaubte für einen Moment, das Singen von Vögeln zu hören und die Wärme der Sonne auf dem Gesicht zu spüren, aber das hätte auch nur Einbildung sein können.
Er wusste nicht, was geschehen war, er wusste jetzt nicht einmal mehr, dass er in einem Kerker gehaust hatte. Er wusste auch nicht, in welchem Zeitalter er sich befand.
Für den Bruchteil eines winzigen Augenblicks erinnerte er sich an ein längst vergangenes Leben. Und er hatte in seinem schmerzvernebelten Bewusstsein nur einen Gedanken. »Zazar«, hauchte er beinahe flehend. Eine Träne rollte ihm aus den zusammengepetzten Augen und lief seine schmutzige Wange hinab. »Zazar«, wiederholte er noch einmal, bevor die endlose Schwärze ihn einhüllte.