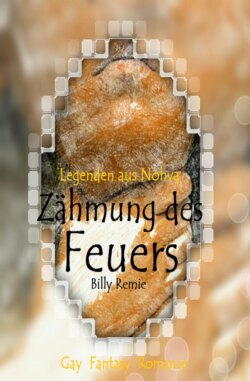Читать книгу Zähmung des Feuers - Billy Remie - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеBevor er in den Kerker hinabstieg, blieb Cohen noch einmal stehen und ließ seinen Blick über den Hof schweifen. Er beobachtete das geschäftige Treiben des einfachen Volkes und erinnerte sich mit Wehmut daran, wie er als kleiner Junge mit seiner Mutter zu dem großen Brunnen gegangen war, um einen Eimer Wasser zu holen, der den ganzen Tag bis zum nächsten Mittag reichen musste.
Sie tranken davon, sie kochten das Essen damit und am Morgen wuschen sie sich mit dem restlichen Wasser und spülten das Geschirr darin ab.
Es kam ihm vor, als sei es eine Ewigkeit her, wie ein anderes Leben.
Er vermisste seine Mutter, jeden Tag. Cohen war noch sehr jung gewesen, als sie verstarb und er schließlich von seinem Vater aufgenommen wurde. Bis dorthin war ihm Rahff eher wie ein Onkel vorgekommen, der alle paar Tage mal vorbeischaute und Geschenke mitbrachte. Nach dem Tod seiner Mutter hatte Cohen zu seinem Vater ein enges Verhältnis aufgebaut, sehr schnell sogar. Und nichts könnte daran etwas ändern. Cohen liebte seinen Vater, trotz, dass er Sevkins Hinrichtung nicht hatte verhindern können.
Aber nicht nur die Liebe und die Loyalität zu seinem Vater hatte Cohen dazu gebracht, in die Armee einzutreten. Von Beginn an hatte er seinen Vater stolz machen wollen, doch er hatte sich letztlich deshalb der schweren Ausbildung zum Soldaten unterzogen, weil er sein Heimatland liebte und seinen Glauben bewahren wollte.
Welcher Mann die Schönheit Nohvas betrachtete und nichts dabei empfinden konnte, musste innerlich tot sein oder kein Herz besitzen. Hier, im südlichen Gebirge, auf der Schwarzfelsburg, war es in den Abendstunden, dann, wenn die Sonne unterging und ihr warmes Licht einem roten Inferno am Himmel glich, besonders schön. Selbst der Schlamm, der vom Regen aus den Felspalten vom Gebirge in die Burg gespült wurde, konnte dem Anblick am Abend nicht abträglich sein. Und der Frühlingswind brachte den Duft wärmerer Tage mit sich. Vögel zwitscherten, die Pferde, die Ziegen, die Schafe und die Kühe scharrten in den Ställen schon mit den Hufen – bald wurden sie hinaus auf die dunkelgrünen, saftigen Wiesen getrieben.
Cohen liebte es. Liebte seine Heimat. Die Burg, die Berge, wo der Krieg noch fern war.
Doch er musste sich mit Kummer fragen, was aus seiner Heimat noch werden sollte. Er war dort gewesen, auf den Schlachtfeldern, zu Beginn des Bürgerkriegs. Er wusste, was Krieg bedeutete, und konnte dem kaum etwas Gutes abgewinnen. Gleichwohl ihm bewusst war, dass man manchmal keine andere Wahl hatte als für das zu kämpfen, das man liebte.
Und genau das tat Cohen. Er kämpfte für Nohva. Er hatte immer für Nohva gekämpft. Nicht für die Kirche, obwohl er es lange so gesehen hatte. Aber hier und jetzt, im Schein der untergehenden Sonne, die den schwarzen Burgfried anstrahlte, zu dem er aufblickte, wusste er, dass sein Kampfeswille aus dem Wunsch hervorging, Nohva nicht untergehen zu sehen.
Davor hatte er die meiste Furcht. Was würde geschehen, sollten die Goldis den Krieg gewinnen? Wer sich jetzt schon darüber beklagte, dass zu viele Minderheiten unterdrückt wurden, der würde sich wundern, was das Wüstenvolk für Gesetze vertrat. In Nohva hatten Bastarde und Frauen noch nie viel zu sagen gehabt, aber in den Wüstenregionen des Kontinents wurden sie sogar noch schlechter behandelt als die Ratten in den Straßen.
Was die Rebellen anging … Cohen konnte nicht verstehen, wie diese Männer und Frauen töten konnten, um das Töten zu verhindern. Das ergab keinen Sinn.
So wie es jetzt war, war es gewiss nicht perfekt, und er als Bastard des Königs hatte vermutlich leicht reden, aber ob Wüstenvolk oder Rebellen, keine der beiden Seiten hatte den richtigen Weg gewählt. Sie hatten nur dafür gesorgt, dass Nohva schwach für Angreifer von außen war. Und was Cohen noch mehr fürchtete als die Elkanasai oder Großkönig Melecay, war die Dämonenplage, die sich unaufhaltsam von den Violetten Küsten über die Wälder hin ausbreitete.
Noch waren nur wenige Dörfer betroffen, doch es gab niemanden, der es aufhalten könnte. Nicht, nachdem die Luzianer ihrer Macht beraubt worden waren.
Niemand teilte Cohens Sorge darüber, nur sein Vater versprach, sich darüber Gedanken zu machen. Doch die letzte bekannte Dämonenplage lag mehrere Jahrtausende in der Zeit zurück, kein Mann und keine Frau glaubte daran, dass die Dämonen erneut eine so große Gefahr darstellen könnten. Aber wie so oft wogen sie sich in Sicherheit, wo große Gefahr lauerte.
Deshalb hielt Cohen an seiner Religion fest, selbst als Bastard und Sünder. Denn er war einst einem Dämon begegnet, der ihm die Zukunft vorhergesagt hatte. Und bisher hatte er mit allem Recht behalten, was er prophezeite.
Noch heute waren Cohens Erinnerung an dieses schicksalhafte Erlebnis so deutlich, als wäre es erst wenige Augenblicke her. Er konnte noch fühlen, wie der schwere Körper seines Bruders in seinen Armen lag und langsam jegliche Wärme aus ihm wich. Blut aus Raaks Bauchwunde, die Cohen ihm hatte zufügen müssen, weil ihm nicht mehr zu helfen gewesen war – nur mit dem unwiederbringlichen Tod – sickerte durch die Rüstung und hatte Cohens Brustpanzer besudelt. Tränen waren Cohen über die mit Dreck beschmutzten Wangen gelaufen, während er im Schlamm auf einem kalt werdenden Schlachtfeld gekniet und um seinen Kronprinzen und Bruder getrauert hatte. Und dann, völlig unerwartet, hatte der Dämon, der Besitz von Raaks ergriffen hatte, sich ein letztes Mal aufgebäumt und den sterbenden Körper verwendet, um Cohen mit einer rauen, kratzigen Stimme, die direkt aus der Unterwelt zu kommen schien, noch etwas zu sagen.
»Verrat und Tod haften dir an und verfolgen dich dein Leben lang«, hatte der Dämon Cohen aus Raaks toten Augen zu gehaucht. »Deine Mutter starb, noch bevor du dich das erste Mal verlieben konntest. Du wurdest zu einem berühmten Reiter, aber deine treuen Rösser lenkst du in den Krieg und ihren Tod. Dein einziger Freund wurde zu deinem Feind. Er tat dir Grauenhaftes an, doch dein Schweigen über seine Tat schützt ihn. Krieg umgibt dich und Tod ist dein Geschäft. Du hast Trost vor deiner Einsamkeit in den Armen einer Freundin gefunden, die jedoch keine Liebe für dich empfindet. Du hast Kinder, die nicht deine eigenen sind. Du bist verliebt, aber deine Liebe wird ersticken. Du wirst noch einsamer sein und vom Weg abkommen. Die Götter werden dich verlassen, weil du den Glauben verlierst.«
All das war bereits eingetroffen, und Cohen versuchte, letzteres abzuwenden, indem er sich eisern an seinen Glauben an die Götter klammerte.
Doch der Dämon hatte noch mehr zu sagen gehabt. Er hatte Cohen mit Raaks kalten, toten Fingern an seinem Umhang gepackt und zu sich herabgezogen, um leise aber eindringlich fortzufahren: »Ich sehe, dass du viel Leid verursachen wirst, aber ich sehe auch Heilung. Du findest einen wahren Freund, der zunächst an dir zweifelt. Du wirst geliebt werden. Und du wirst jemanden verraten, der dich liebt. Ein Mörder wird dein Herz rauben – und es brechen. Du wirst Unheil anrichten – und Rettung bringen. Du wirst einst der berühmteste Reiter der Geschichte werden, Bastard des Königs, aber du wirst nicht auf einem Pferd reiten. Du wirst fallen gelassen – und aufgefangen werden.« Der Dämon machte eine Pause und grinste mit Raaks erblassten Lippen in Cohens aschfahles Gesicht, der es nicht einmal wagte, zu atmen. Schließlich schloss der Dämon seinen Vortrag mit den Worten: »Und du wirst die Eifersucht eines mächtigen Feindes wecken. Die Angst um deine Liebe wird dich blind vor der Finsternis machen. Du wirst dem Obersten Fürsten der Unterwelt in die Augen sehen, ihn aber nicht erkennen. Ich sehe es in deiner Zukunft, er wird kommen. Mein Meister wird kommen.«
Mein Meister wird kommen …
Cohen schüttelte den Kopf, um den Alptraum zu vergessen, den er vor vier Jahren erlebt hatte, und wandte sich von dem Treiben im Hof ab, um in den Kerker zu gehen. Er glaubte nicht an das, was der Dämon sagte – er wollte nicht daran glauben – denn dieses düstere Wesen war nur darauf aus gewesen, Cohen in tiefe Furcht zu versetzen. Er – als Mann, der seine Heimat liebte – konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen, als dem Feind seiner Heimat in die Augen zu sehen, und ihn nicht zu erkennen. Das musste der Dämon gespürt und mit Cohens Ängsten gespielt haben.
Dafür waren diese Biester ja bekannt.
Was ihn aber noch mehr in Sorge brachte als die Dinge, die dieses Wesen gesagt hatte, war die Tatsache, dass der Dämon nicht versucht hatte, Besitz von ihm zu ergreifen. Als Raaks Körper sich noch einmal unter Krämpfen aufgebäumt hatte, da hatte Cohen geglaubt zu spüren, wie eine fremde und dunkle Macht an die äußere Wand seines Bewusstseins kratzte, aber nicht hindurchgedrungen war. Erst dann hatte der Dämon zu ihm gesprochen. Es war fast, als hätte der Dämon etwas in Cohen gesehen, dass ihn zurückschrecken ließ. Fast so, als wollten die Dämonen, dass er seinen Weg weiterführte.
Noch einmal schüttelte Cohen den Kopf, um seine Furcht niederzukämpfen. Er wollte nicht mehr darüber nachdenken, er hatte genug andere Sorgen. Außerdem spürte er bereits das allzu bekannte Brennen in seinem Bauch.
Er hatte schon als kleiner Junge unter starken Magenkrämpfen gelitten, vor allem, wenn ihm viel durch den Kopf ging. Furcht und Nervosität führten nicht selten dazu, dass Cohen unter größter Eile zum Abort eilen musste. Diese »Eigenschaft« war für einen Soldaten nicht gerade vorteilhaft, aber über die Jahre hinweg hatte er sich damit arrangiert. In der Schlacht bemerkte er die Krämpfe meist gar nicht, nur vor einem Kampf musste er oft mit seinem eigenen Körper um Kontrolle fechten.
Während seiner Ausbildung hatte er einen Lehrer aus der königlichen Garde kennenlernen dürfen, der so streng gewesen war, dass er Cohen in solchen »Notfällen« nicht zum Abort hatte gehen lassen, weshalb es oft zu peinlichen Zwischenfällen gekommen war. Aber Cohen hatte sich nie unterkriegen lassen und hatte sich durch die strenge und harte Ausbildung gekämpft, weshalb man ihm nun mit etwas mehr Respekt begegnete – obwohl er lange Zeit das Gespött der gesamten Burg gewesen war.
All das lag hinter ihm, weit hinter ihm, viele der Menschen, die ihn noch als Jungen gekannt hatten, erinnerten sich vermutlich gar nicht mehr daran. Aber es gab Männer, die konnten die Vergangenheit nicht vergessen, so sehr sie es auch versuchten, und dazu gehörte Cohen. Äußerlich wirkte er immer wie ein grimmiger und strenger Befehlshaber, seine Blicke waren kühl und unnahbar, was die Leute davon abhielt, ihm mit Freundlichkeit zu begegnen, doch das war reiner Selbstschutz. Oft genug hatten Menschen über ihn gelacht, ob offen oder hinter vorgehaltener Hand, weshalb er sie lieber alle auf Abstand hielt. Wenn sie von ihm dachten, er wäre ein reizbarer und stets missmutiger Zeitgenosse, dann war ihm das nur Recht. Alles war besser, als wenn sie wüssten, wie unsicher er eigentlich im Umgang mit anderen Menschen war. Die meisten würden es nur ausnutzen, oder im schlimmsten Fall von ihm denken, er sei kein echter Mann, was ihn zum Zielobjekt intriganter Höflinge gemacht hätte. Vor allem vor Männern wir Cocoun und dessen Vater musste sich Cohen in Acht nehmen. Diese waren nämlich nicht nur sicher im Umgang mit anderen Menschen, sie lebten davon, andere mit Arglist zu hintergehen, zu manipulieren und ihren Charme so auszunutzen, dass alle anderen nach ihren Wünschen und Vorstellungen handelten.
Cohen sagte stets von sich selbst, er besitze keinen Charme, weshalb er auch nicht wusste, wie er anderen Menschen begegnen konnte ohne sie oder sich selbst bloß zu stellen. Sevkin hatte immer liebevoll erwiderte: »Dein Charme sind dein Aussehen und deine tiefgründigen Augen, die jedes Herz im Stillen erobern. Halte einfach deinen Mund, lächle und nicke, dann liegt dir die Welt zu Füßen.«
Sevkin war Cohens genaues Gegenstück gewesen. Sevkin war aufgeschlossen, charmant, humor- und liebevoll. Er konnte mit nur einem einzigen Lächeln und einem schlichten »Wie geht es Euch?« seinem Gegenüber geradezu verzaubern. Gegen Sevkins einmalige Art, die Leute von sich zu überzeugen, kam niemand an. Vermutlich hatte Sevkin deshalb sterben müssen. Weil er es auf seine erstaunlich gewiefte und auch kecke Art bewältigt hätte, alle Feinde des Königshauses mit einem Lächeln zu Befürwortern zu machen. Nur die Familie Schavellen war nicht dem Zauber des jungen Prinzen erlegen gewesen.
Cohen glaubte bis heute, dass Cocoun und dessen Vater eine Falle gestellt haben, in die Sevkin naiver Weise reingefallen war.
Eines Tages, so hatte Cohen geschworen, würden die Verantwortlichen dafür bezahlen. Und wenn die Götter nichts unternahmen, würde er es selbst tun. Er täte nicht nur sich selbst und seinem Vater, sondern auch Nohva einen Gefallen. Und wenn dafür auch er hängen sollte, so war es ihm gleich.
Es gibt, gab und wird nie einen traurigeren Ort als ein vom Krieg zerstörtes und ausgeplündertes Dorf geben, dessen Überreste brannten, während die geschändeten Leichen der einstmaligen Bewohner im aufgeweichten Boden langsam erkalteten. Doch Cohen bemerkte immer wieder erstaunt, wie nah das Grauen im königlichen Kerker dem Grauen an einem vom Krieg gezeichneten Ort kam.
Nicht nur, dass es dunkel, kalt und feucht hier war, sobald man die erste Treppe nach unten genommen hatte, es roch wie in den Abwasserkanälen unterhalb der Burg. Und die Geräusche trugen ihren Teil zu der trostlosen Atmosphäre bei. Wimmern, Weinen und Klageschreie glitten über die kahlen, grauen Gesteinswände, von denen Feuchtigkeit in Rinnsalen hinabrann und sich zu Pfützen auf dem ebenso kahlen, kalten Gesteinsboden sammelte.
Cohen musste an einigen Zellen vorübergehen, die so überfüllt waren, dass er es nicht vermochte, die Männer darin zu zählen. In dreckigen Lumpen, nicht mehr als vergilbte Leinensäcke mit Löchern für Kopf und Arme, die den Gefangenen kaum bis zu den Knien reichten, saßen sie auf dem Boden, der nur notbedürftig mit altem, verschimmelten Stroh bedeckt war. Die Eimer für ihre Ausscheidungen liefen über, sodass sie gezwungen waren, sich in irgendeine Ecke zu erleichtern. Etwas frische Luft drang durch winzige Öffnungen, die mit massiven Stahlstäben vergittert waren und viel zu hoch hingen, als dass es den Gefangenen möglich gewesen wäre, hinauszublicken. Hätten sie es gekonnt, hätten sie lediglich die Rückseite der Kuhställe betrachten können, deren Gestank hereingeweht wurde, wenn der Wind von Norden kam.
Wie jedes Mal, wenn er hier vorbeikam, versuchte Cohen, den Blick strickt zu Boden zu richten und das Elend hier nicht zu betrachten. Er durfte nicht vergessen, dass viele dieser Gefangenen ganz zu Recht hier waren. Es gab skrupellose Mörder unter ihnen, Diebe und Desserteure. Doch Cohen hatte vor allem Mitleid mit den vielen Kriegsgefangenen, die hier auf ihr Schicksal warteten. Unter anderen Umständen hätte er einer von ihnen sein können, oder zumindest in derselben Lage wie sie sein können, hätten seine Feinde ihn überwältigt. Es war doch nur reiner Zufall, dass er bisher immer einen Augenblick schneller gewesen war als seine Gegner. Ohne die Gnade der Götter – wie er annahm – könnte er bereits tot oder ebenso gefangen sein. Zum Teil verdankte er den Umstand, dass er wohlauf und frei war, auch seinen Männern. Er sagte es ihnen leider viel zu selten, weil er eben selten die richtigen Worte fand.
Cohen ging eilig an den Zellen vorbei.
Hier unten hörte er zum ersten Mal dieses seltsame Flüstern wieder, das ihn als Kind sehr oft in Träumen heimgesucht hatte. Es waren keine Worte, die er verstehen konnte. Eine ihm fremde Sprache, die mit einer Stimme gesprochen wurde, die er mit einer Schlange vergleichen würde, die sprechen gelernt hatte. Sie wisperte in einer verführerischen Tonlage zu ihm, lockte ihn.
Sein Herz raste. Es fürchtete sich, ebenso wie es neugierig war.
Sein gesunder Menschenverstand sagte ihm, vorsichtig zu sein und die Stimme auszuschließen, doch seine Beine trugen ihn weiter, immer tiefer in die Eingeweide des Kerkers und der Stimme entgegen. Das Flüstern drang in seinen Verstand ein, es kam nicht von außen. Erst war es nur leise, doch je tiefer er in den Kerker ging, je deutlicher wurde es.
Cohen schob es darauf, dass er seit Sevkins Hinrichtung nicht mehr richtig bei sich war. Er brauchte Schlaf. Umgehend.
Er ging weiter und ignorierte, dass Männer sich hinter den Gittern die Seelen aus dem Leib kotzten. Er hatte schon gehört, dass hier unten eine schlimme Krankheit herrschte, weshalb die Wachen nicht mehr herkommen wollten. Ihn kümmerte das nicht, selbst wenn er krank wurde, so hatte er das Privileg, von den königlichen Heiler auf der Burg Gebrauch zu machen. Außerdem glaubte er nicht daran, dass die Götter ihm eine Krankheit auferlegen würden, die ihn eine Woche lang ans Bett band, denn das würde ja bedeuten, er hätte für eine ganze Woche Frieden und Ruhe – was die Götter ihm nicht gönnen würden.
An der Tür zu einer kleineren, abgesonderten Folterkammer waren draußen zwei gepanzerte Ritter positioniert, die auf ihn warteten. Cohen hatte die Schreie hinter der morschen Holztür bereits durch den gesamten Kerker vernommen. Der gefolterte Mann dahinter hatte noch immer eine kräftige Stimme, animalisch, fast völlig unmenschlich, ein Knurren war herauszuhören, ebenso tierisches Fauchen, bei dem er erst nicht sicher war, ob es tatsächlich von einem Zweibeiner ausgestoßen worden war.
Doch trotz der Lebenskraft in den Lauten hörte Cohen auch, dass die Stimme allmählich brüchig wurde. Matt. Als würde die Kraft aus dem Körper schwinden, zwar nur langsam, aber doch deutlich hörbar. Er hörte auch Angst heraus, doch diese wurde, je größer der Schmerz war, von Zorn überschattet.
Die Ritter schenkten Cohen ein respektvolles Nicken, mehr konnte und würde er von ihnen auch nie verlangen. Sie sprachen ihn mit »Herr« an, was schon mehr war, als seine Leidensgenossen – die anderen Bastarde – erwarten konnten.
Cohen erwiderte das Nicken.
So nah an der Tür, wurde das Flüstern in seinem Kopf so laut, dass es fast die Schreie dahinter übertönte. Noch immer war ihm die Sprache fremd, aber aus einem plötzlichen Wissen heraus, wie ein tief sitzender Instinkt, der sich ihm aus tiefsten Inneren aufdrängte, glaubte er nun, den Sinn zu verstehen.
»Udmm lporou.«
Komm näher.
Ihm wurde die Tür geöffnet. Er blinzelte seine Verwirrung fort.
Was er dahinter sah, ließ ihn angstvoll schlucken. Ein Mann, groß und muskulös – obwohl er über Monate lang gehungert hatte und gefoltert wurde – lag mit dem Rücken auf einer Streckbank. Er war nackt und Schweiß überzog seine ausgeprägten Muskeln und Sehnen, die durch die Folter angespannt waren und deutlich hervortraten. Die Augen des Gefangenen waren weit aufgerissen, sie zeugten von unbändiger Furcht, ebenso von einem zornigen Feuer, vor dem sich Cohen mehr fürchtete als vor den ganzen Folterinstrumenten, die an den Wänden hingen und auf Tischen bereitlagen, damit er sie an diesem ihm ausgelieferten Mann anwenden konnte.
Die Streckbank war eine von König Rahffs bevorzugtesten Foltermethoden. Sie ähnelte in ihrer Form einem langen Tisch, auf dem der Gefolterte sich auf den Rücken legte, Arme über den Kopf, und die Fußknöchel zusammen. Die Arme hingen an einer Art »Stock«, der wiederum mittels Seil an einer Kurbel befestigt war, während die Füße mit schweren Ketten am anderen Ende der Streckband mit dem Boden verbunden blieben. Der Folterer musste nur die Kurbel betätigen und schon wurde der Gefangene – wie der Name des Geräts bereits verriet – gestreckt. Oder besser gesagt, er wurde langgezogen, bis die Knochen knackten.
Cohen stand einige Zeit einfach da und sah zu, ohne in der Lage zu sein, auf sich aufmerksam zu machen. Das Flüstern wurde immer übermächtiger, und er vermochte kaum, es wieder zu vertreiben. Es bereitete ihm Sorgen, dass er es überhaupt hörte.
Was stimmte nicht mit ihm?
»Ikr voigg, ne upllgf mikr rdorol.«
Ich weiß, du kannst mich hören.
Cohen schüttelte den Kopf, um die Worte zu vertreiben.
»Sprichst du jetzt endlich, du jämmerlicher Bastard?«, fragte der Folterer höhnisch.
Cohen mochte ihn auf Anhieb nicht.
Der Gefangene brüllte, sodass Speichelfäden aus seinen rissigen, blutigen Lippen spritzten: »ICH WIEß NICHT, WAS IHR VON MIR WOLLT!«
»Wie du willst.« Der Folterer betätigte die Kurbel.
Entsetzliche Schreie wurden laut, und Cohen musste alle Willenskraft aufbringen, um sich nicht die Ohren zuzuhalten. Das Flüstern wurde zu einem tierischen Aufschrei, dass ihm fast den Schädel zerplatzen ließ.
Die Augen des Gefangenen traten beängstigend heraus, eine Ader platzte und färbte das Weiße in seinem linken Auge rot. Er biss die Zähne zusammen – und da konnte Cohen zum ersten Mal in seinem Leben das furchteinflößende Gebiss eines reinen Luzianers erblicken.
Es hatte Gemälde und Zeichnungen gegeben, die Luzianer mit gebleckten Gebiss zeigten, doch diese hatten bei Weitem nicht so lange und imposante Fänge gehabt wie dieses Exemplar.
Ein reinblutiger Luzianer. Vermutlich der letzte reine Luzianer. Das reinste Blut seines Volkes floss durch seine Adern. Cohen konnte nicht verhindern, dass er so etwas wie Ehrfurcht verspürte.
Cohen schnürte es bei dem Anblick dennoch die Kehle zu und er fasste sich unwillkürlich an den Hals. Ihm war unbehaglich zumute, teils aus Angst, teils, weil er unter seiner Haut ein Kitzeln verspürte, dass ihm unbekannt war.
»Ne gceougf mikr.«
Du spürst mich.
Sein Leben lang wurde ihm beigebracht, die Luzianer zu fürchten, und er verstand nun mehr denn je, weshalb. Aber wie ein Kind empfand er vor dem Unbekannten, eines fast ausgestorbenen Volkes, mehr Neugierde als Furcht.
»Sprich, und du wirst erlöst!«, rief der Folterer über das schmerzerfüllte und wütende Knurren des Luzianers hinweg. »Hast du noch Verbündete? Lebende Verbündete?«
Der Luzianer ließ eine Vielzahl an Flüchen verlauten, die Cohen in dieser Zusammenstellung noch nie vernommen hatte, und die sich größtenteils gegen die Mutter des Folterers richteten.
»F‘dofo«, befahl das Flüstern.
Töte.
Sei doch endlich still, flehte Cohen bei sich.
»Wo befinden sich deine Anhänger, Verräter?«, fragte der Folterer und kurbelte frohen Mutes weiter, ohne auf eine Antwort zu warten.
»ICH WIEß ES NICHT!«, brüllte der Gefangene, und zum ersten Mal war Verzweiflung heraus zu hören. »Ich weiß es nicht, bitte, ich weiß es doch nicht!« Tränen liefen dem Luzianer über die Wangen, als er unter der Folter einknickte. »Bitte, ich weiß nicht einmal, wer ich bin. Tötet mich einfach …«, erschöpft atmete er aus, » … tötet mich doch einfach.«
Pures Entsetzen machte sich in Cohen breit, als er die flehenden Worte hörte. Eine leise Stimme wurde in ihm wach, die ihm zuflüsterte, dass dieser Mann niemals so etwas gesagt hätte – das er niemals aufgegeben hätte – wenn er wirklich er selbst gewesen wäre.
So viel wusste Cohen bereits aus zahlreichen Gerüchten.
»Genug«, beendete Cohen die Qual des Gefangenen, und bedeutete dem Folterer, die Kurbel loszulassen. Sein Befehl wurde befolgt.
»Ourdouo mikr, Tseogfouou.«
Erhöre mich, Flüsterer.
»Herr, wenn Ihr wünscht, stehe ich Euch bei der Befragung zur Seite«, bat der Folterer, als er bemerkte, dass er abgelöst werden sollte. »Ich kenne diesen Burschen bereits, es wird mir ein Vergnügen sein, Euch seine Schwachpunkte zu zeigen.«
Das widerliche Grinsen in dem Gesicht des Folterers würde Cohen nie vergessen. Es war ihm schleierhaft, wie ein Mann Spaß daran finden konnte, einem anderen Mann Schmerz zuzufügen, wenn dieser sich nicht einmal wehren konnte.
Nur Feiglinge haben Spaß an Folter, so lautete Cohens Meinung dazu.
Der Folterer war ein kleiner Mann mit strohblonden, fettigen Strähnen, die unter seiner braunen Kopfbedeckung hervorlugten. Wenn er grinste, konnte Cohen seine schwarzen, halb abgefaulten Zähne erkennen. Sein Mundgeruch schlug jede Schmeißfliege in die Flucht. Er war dreckig, nicht nur seine einfache Lederbekleidung, sondern auch seine Hände und sein Gesicht, als habe er seit Wochen kein Wasser gesehen.
Cohen versuchte, nicht allzu angewidert drein zu blicken, als er streng ablehnte: »Nein, ich mache das selbst. Geht jetzt und nehmt die königliche Garde mit.«
Er brauchte keine Zuhörer.
Der Folterer blinzelte verdutzt. »Aber, Herr …«
»Habt Ihr nicht gehört?«, herrschte Cohen den Folterer an. »Verschwindet. Das war ein Befehl!«
Sofort kam Bewegung in den sadistischen Schweinehund. Er eilte nach draußen und nahm die Ritter mit.
Cohen legte seinen Umhang ab und warf ihn neben die Folterinstrumente auf einen Tisch. Als sich ihre Schritte entfernten, fühlte er sich weniger überwacht.
Es war kalt in diesem Raum, trotz, dass es kein Fenster gab. Licht spendeten nur vier Fackeln, die an den Wänden links und rechts von ihm angebracht waren. Cohen warf einen Blick auf den Gefangenen, der die Augen fest zusammenpetzte, und dessen schmale Lippen sich bewegten, ohne Worte zu sprechen.
Er war … bildschön.
Nein, wirklich, Cohen fand keine andere, passende Umschreibung für diesen Körper. Selbst gefoltert, und trotz zahlreicher alter Narben, war dieser Körper, der auf der Folterbank ausgestreckt dalag, bildschön. Auf seine raue, männliche Art wahrhaftig schön.
Dunkles Haar, ewig junge Gesichtszüge, die leicht scharfkantig wirkten, dichte Wimpern, gerade Nase, schmale Lippen, die jedoch einen herrlichen Schwung beschrieben. Die Brust war breit, glänzte im Schein der Fackeln feucht von Blut und Schweiß. Zu den Hüften hin wurde der Körper schmäler. Die Schenkel waren wieder breiter und stramm. Das Gehänge … auch schlaff ein Traum, das umhüllt von dunklem Schamhaar in Cohens Augen wirkte wie ein mit begehrenswerten Juwelen gefülltes Vogelnest.
Cohen riss den Blick von diesem Körper, ehe seine Musterung noch genauer wurde.
Das wenige Licht der züngelnden Flammen reichte aus, um einen ersten Eindruck der Instrumente zu bekommen. Allesamt waren schmutzig und rostig. Zahlreiche Folterrungen waren damit schon verübt worden – einige davon waren sicher tödlich geendet. Ohne die Folterwerkzeuge berührt zu haben – oder sich eines für den Anfang auszusuchen – ging Cohen zur Streckbank und betätigte die Kurbel. Es überraschte beide Männer, dass er sie soweit lockerte, dass der Luzianer ohne Schmerzen daliegen konnte.
Erstaunt öffneten sich die Augen des Gefangen und suchten den Raum ab, um zu erkennen, was vor sich ging. Vielleicht bemerkte er tatsächlich erst in diesem Augenblick, dass der Folterer ausgewechselt worden war. Cohen ging um seinen Kopf herum, damit er ihn sehen konnte und vielleicht die Verzweiflung vergaß, die für die Tränen auf seinem eingefallenen, scharfkantigen Gesicht verantwortlich war.
Als der Luzianer Cohen erblickte, geschah etwas völlig Unerwartetes. Seine Augen weiteten sich, als habe er einen Geist gesehen.
»Ich kenne dich!«, rief der Gefangene aus und bäumte sich auf, weil er in seiner Aufregung wohl vergessen hatte, dass er noch immer gefesselt war. Er schrie auf, als er seine geschundenen Gliedmaßen beanspruchte. Schmerz trieb ihm den Schweiß auf den göttergleichen Körper.
Cohen wandte sich ab, vor allem, um sich selbst wieder zu fangen, und ging hinüber zu einer Schüssel mit Wasser. Es war kaltes und schmutziges Wasser, in dem ein ebenso dreckiger und bereits mehrfach benutzter Fetzen Stoff schwamm. So gut es ihm gelang, wrang Cohen den Lappen aus und kehrte zur Streckbank zurück. Er zog einen Hocker heran und setzte sich darauf.
Der Gefangene hielt die Augen noch geschlossen und flüsterte wirres Zeug vor sich hin, das Cohen nicht verstand. Es klang überwiegend nach: »Wer bin ich …? Wer bin ich …? Wer bin ich …? Was habe ich getan …? Was habe ich getan …? Wer bist du …? Wer … wer bist du …?« Die Folter musste ihn wahnsinnig gemacht haben, er hatte den Verstand eingebüßt.
Als Cohen mit dem feuchten Lappen begann, dem völlig verstörten Luzianer das Gesicht abzureiben – warum tat er das überhaupt? Er musste endlich mit der Folter beginnen! – öffnete dieser wieder die Augen.
Nun sprach er deutlicher, wenn auch sehr erschöpft und am Ende aller Kräfte, ob körperlich oder geistig: »Ich … kenne dein Gesicht.«
»Viu uollol nikr.«
Wir kennen dich.
Cohen hielt für einen Augenblick lang inne und war wie gefangen von dem eindringlichen Blick aus diesen stechend grünen Augen. Dort in diesen tiefen Abgründen loderte immer noch ein Feuer, das ihm mehr Sorgen bereiten sollte, als sonst irgendein Feind. Denn er wusste, dass dieser Mann allen Grund hatte, Cohens Familie bis zum letzten Erben für das büßen zu lassen, was sie ihm angetan hatten.
»Ich kenne dich!« Die Stimme des Luzianers wurde wieder kräftiger. »Bitte!« Er befahl es mehr, als das er flehte. »Du musst es mir sagen! Sag es mir! Wer bist du? Wer … wer bin ich? Wir kennen uns! Ich kenne dich! Aber woher? Wer bist du? Was habe ich getan? Warum bin ich hier?« Die Worte überschlugen sich fast, der Gefangene musste tief Luft holen, bevor er alles noch einmal verzweifelter wiederholte.
Cohen starrte ihn nur an, den Lappen immer noch erhoben, bereit zum Einsatz.
»Bitte«, drängte der Gefangene. »Bitte … sag es mir … sag ... es mir. Du musst es mir sagen. Bitte. Sag es mir!« Tränen schimmerten in seinen Augen, die voller Hoffnung zu Cohens erstarrtem Gesicht hinaufblickten. Hätte er gekonnt, hätte der Luzianer ohne jeden Zweifel Cohen am Brustharnisch gepackt und gerüttelt.
»Bitte«, seine Lippen zitterten, als die Worte über sie waberten, wie das leise Plätschern eines Baches über einen Steinhang. »Sag es mir, bitte, sag mir nur, woher wir uns kennen. Bitte … sag mir, wer ich bin …«
Cohen spürte, wie er langsam den Kopf schüttelte. Er riss sich zusammen, blinzelte und gab sich selbst einen Ruck, um zu sich zu kommen.
Er räusperte sich und sagte ruhig und endschuldigend: »Wir sind uns nie zuvor begegnet.«
Nun war es der Luzianer, der wie erstarrt war. Er blinzelte und betrachtete weiter Cohens Gesicht. Seine Lippen wurden zu einer dünnen Linie, Zorn kehrte in seine markanten Gesichtszüge zurück.
»Ich kenne dein Gesicht«, wiederholte der Gefangene, als sei er wütend deshalb, »nur deine Augen sind mir gänzlich fremd.«
»Ikr uollo noilol Hoigf.«
Ich kenne deinen Geist.
Cohen nickte langsam und richtete sich etwas auf, um Abstand vom Gesicht des Gefangenen zu bekommen, denn ihm wurde nur allzu sehr bewusst, dass er dessen Atem hatte spüren können. »Ihr habt wirklich Eure Erinnerung verloren?«
Der Luzianer, so blass und fahl wie eine Leiche, starrte Cohen noch einen Moment lang unverwandt an, als versuchte er weiterhin das Rätsel zu lösen, woher sie sich kannten, obwohl sie sich tatsächlich noch nie begegnet waren.
Schließlich wurde er bitter ernst und erriet ganz richtig: »Du bist hier, um mich noch mehr zu foltern – schlimmer zu foltern.« Sein Blick fiel auf Cohens Hand, in der noch der feuchte Lappen hing, mit dem er Schweiß und Tränen aus dem Gesicht des Luzianers gewischt hatte.
Plötzlich erschien Cohen der Lappen sonderbar schwer, als wöge er mit einem Mal hunderte Zentner.
Der Gefangene blickte Cohen trotzig wieder in die Augen. »Wieso foltert ihr mich? Was habe ich getan?«
Es war ja wohl kein Verbrechen, einem Todgeweihten wenigstens zu erklären, warum er im Kerker saß und auf seine Hinrichtung wartete. Oder? Gleichwohl Cohen bewusst war, dass es zu seiner Folter beitrug, wenn der Luzianer nicht wusste, weshalb er hier war, beschloss Cohen, es ihm zu sagen.
Nun waren es Cohens Lippen, die missbilligend schmal wurden, als er erklärte: »Du bist hier, weil du ein Verräter der Krone bist.«
»Seoho!«
Lüge.
Eine tiefe Falte zeichnete sich zwischen den Augen des Luzianers ab. Er blickte Cohen neugierig an, als er wissen wollte: »Wieso bin ich ein Verräter der Krone?«
»Du hast den König ermordet.«
»Likrf nol vprol Udolih!«
Nicht den wahren König!
Daraufhin blieb es eine ganze Weile lang still, und das Schweigen dehnte sich aus. Cohen konnte währenddessen beobachten, wie sich die Gedanken im Kopf des Gefangenen überschlugen. Seine Augen sahen zur Decke und bewegten sich, als würden sie in großer Eile einen Brief überfliegen.
Schließlich sah der Gefangene Cohen wieder an und fragte: »Wieso habe ich den König ermordet?«
Cohen bemerkte nicht, wie sein Gesicht einen bedauerlichen Ausdruck annahm, der den Gefangenen verwirrte. Er würde darauf nicht antworten, weil seine Antwort darauf »Weil mein König, deinen König ermordete« gelautet hätte.
»Er war mein Großvater«, sagte Cohen nur dazu.
»Oh.« Der Gefangene wirkte weder betroffen, noch schien er etwas zu bedauern – wie sollte er auch, er erinnerte sich ja nicht. »Verstehe. Deshalb bist du jetzt hier. Um Rache zu nehmen.«
Weder verneinte Cohen dies, noch bestätigte er es. »Ich bin hier, weil der König es befahl.«
»Verstehe.« Der Gefangene behielt nun ununterbrochen Cohens Augen im Blick. »Aber ich erinnere mich, dass mein Zellennachbar erzählte, der derzeitige König regiert schon seit mehr als zwanzig Jahren. Wie lange ist die Ermordung deines Großvaters schon her?«
Cohen senkte den Blick. Statt sich lange mit Antworten aufzuhalten, beschloss er, ohne unnötige Verzögerung, das zu erzählen, worauf der Gefangene aus war: »Wegen deiner Verbrechen wurdest du und deine Anhänger aus Nohva verbannt. Solltest du zurückkehren, erwartete euch der Tod.«
»Und hier bin ich«, es klang fast so, als verstünde er nun einiges mehr. Doch er sah Cohen verwirrt an und fragte neugierig: »Aber, wenn ich ein Verräter der Krone bin und gerade so dem Tod entkommen war, indem der König mich verbannte, statt hinrichtete, warum bin ich dann so dumm, zurückzukommen?«
Das bist du nicht. Wieder trat in Cohens Gesicht großes Bedauern. Dieser Luzianer war – trotz des Verlusts seiner Erinnerungen – ein überaus kluger Mann. Eine Schande, dass er so unehrenhaft sterben musste.
»Du hättest es verdient, in einem Kampf zu sterben«, platze Cohen heraus, eine Entschuldigung klang in seiner Stimme mit.
Der Luzianer blickte ihn überrascht an.
Cohen stand auf und kehrte ihm den Rücken zu, um sich zu fangen. Er musste sich in Erinnerung rufen, dass dieser Luzianer ein Feind seiner Familie war und – wenn er seine Erinnerungen noch hätte – nichts mehr wollen würde, als Cohens Tod. Trotzdem war Cohen jemand, der einen anderen Mann auch dann respektieren konnte, wenn dieser sein Feind war. Darum ging es doch im Krieg. Dass wir nicht vergaßen, dass auch unsere Feinde lebende, fühlende Wesen waren. Der Luzianer hatte für seinen König gekämpft und getötet, ebenso wie Cohen es für seinen tat. Sie waren in diesem Sinne gleich, nur standen sie auf verschiedenen Seiten.
»Nimm das Messer.« Der Gefangene deutete Cohens Grübeln falsch, weil Cohen vor den Folterwerkzeugen stand. »Das kleine, rostige. Das tut am meisten weh.«
Cohen drehte sich zu ihm um und blickte voller Unverständnis auf ihn hinab. »Warum solltest du mir sagen, wie ich dir am besten Schmerz zufügen kann?«
»Deshalb bist du doch hier.« Die grünen Augen blitzten herausfordernd zu Cohen auf, es lag eine animalische Anziehungskraft in ihnen, die weit über das Natürliche hinausging. »Um mich zu foltern. Um dich zu rächen.«
Cohen starrte ihn mit offenen Lippen und einer tiefen Falte zwischen den braunen Augenbrauen an. Er konnte nichts dazu sagen.
»Wenn ich der bin, der deinen Großvater getötet hat, habe ich es wohl verdient, von dir gefoltert zu werden, hm?«
Es war nicht auszumachen, ob der Gefangene seine Worte ehrlich meinte oder ob Wut in seiner Stimme gelegen hatte.
Cohen blinzelte auf ihn hinab.
»Ihr verschweigt etwas, Prinz!« Der Gefangene zog verächtlich die Lippen hoch. »Und haltet mich nicht für dumm. Wenn der König, den ich tötete, Euer Großvater war, und der König, der derzeit die Krone trägt, Euer Vater ist, seid Ihr der Erbe.«
»Nein«, Cohen schüttelte entschieden den Kopf, »ich bin kein Prinz, ich bin nur ein Bastard.«
»Auch ein Bastard ist ein Sohn. Oder etwa nicht?«
»Ich bin kein Prinz.«
»Umso besser. Folter ist nicht gerade ein geeigneter Zeitvertreib für einen Prinzen, oder?«
Die Provokation in der Stimme des Luzianers ließ Cohen deutlich erkennen, welcher Mann hinter den Augen steckte, die trotz des Erinnerungsverlusts zu dem Krieger gehörten, über den so einige Gerüchte im Umlauf waren.
»Foltere mich!« Die Herausforderung klang fast nach einer Verführung. »Du wirst sehen, Bastard des Königs, dass es dir keine Genugtuung bringt.«
Cohen ging hinüber zu der Wasserschale und nahm sie mit zum Hocker, auf den er sich setzte. Ebenso herausfordernd fragte er den Luzianer: »Und wenn ich es nicht tue?«
»Du enttäuschst mich.«
»Du wirst nicht hier an deinen Verletzungen sterben«, Cohen sah den Mut aus den Augen des anderen Mannes schwinden. »Du wirst vor den Augen des Königs und seinen Verbündeten sterben, unter den Jubelrufen deiner Gegner.«
Der Luzianer mahlte mit den Kiefern, doch dann erwiderte er ruhig: »Ich höre deine Worte, doch ich sehe keine Leidenschaft in deinem Gesicht.«
»G`cuikr je nom Fiou, Tseogfouou, g`cuikr je miu.«
Sprich zu dem Tier, Flüsterer, sprich zu mir.
Cohen richtete sich wieder etwas auf, das Flüstern ignorierend.
Der Gefangene lächelte schief, es wirkte verschmitzt. »Du hast keine Freude daran, mich sterben zu sehen, Bastard. Und weißt du auch, woher ich das weiß?«
Cohen stellte die Schale auf dem Boden ab und benetzte den Lappen neu.
Als er nicht antwortete, sprach der Luzianer einfach weiter: »Weil du, wenn du Freude daran hättest, schon längst damit begonnen hättest, mich zu Tode zu quälen.«
Warum hast du ihn nicht einfach gefoltert, Cohen? Das musste er sich wirklich fragen. Aber was brachte es schon, einen Mann zu foltern, der tatsächlich nichts wusste. Es war pure Zeitverschwendung. Und würde ihm nur unnötig Alpträume bescheren.
Cohen sprach nicht weiter mit ihm, er wollte sich nicht provozieren lassen, obwohl es so verlockend war, sich mit dem Feind zu streiten und ihn für alles büßen zu lassen, was Cohen in den letzten Wochen wiederfahren war. Aber auch das machte letztlich wenig Sinn, denn die Folterung dieses Mannes würde Cohen Sevkin auch nicht wieder zurückbringen.
Nichts und niemand vermochte das.
»Ikr gceouo noilol Wousegf.«
Ich spüre deinen Verlust.
»Wann?«
Cohen runzelte die Stirn, er ließ sich viel Zeit damit, den Lappen auszuwringen, damit er dem intensiven Blick dieser grünen Augen nicht begegnen musste. »Wann was?«
»Die Hinrichtung. Wann ist sie?«
Wenn Cohen seinem Vater sagte, dass der Luzianer wirklich nichts wusste, dann war die Hinrichtung: »Morgen. Gegen Mittag.«
Der Luzianer drehte den Kopf, sodass er zur Decke blicken konnte. Es war nicht zu erraten, was ihm nun durch den Kopf ging.
Cohen sah ihn an und sagte: »Du wirst nicht der einzige sein.« Er wusste nicht, ob es das besser machte – vermutlich nicht – aber er wusste auch nicht, was er sonst sagen sollte.
Er hätte gar nicht anfangen dürfen, mit dem Gefangenen zu reden. Das war ein Anfängerfehler gewesen, den er seit Jahren nicht mehr begannen hatte. Vielleicht war er nach Sevkins Hinrichtung tatsächlich noch immer nicht ganz bei sich.
»Hm.« Mehr ließ der Gefangene nicht mehr von sich hören, und Cohen beschloss, ihn nicht aus seinen Gedanken zu holen.
Vorsichtig beugte er sich etwas über den anderen Mann und begann, ihm das Gesicht sorgfältiger zu waschen. Der Luzianer schloss nach Kurzem die Augen und schien zu erschöpft zu sein, um die gut gemeinte Geste seines Peinigers abzuwehren oder zu missbilligen.
Plötzlich drehte der Gefangene den Kopf und öffnete fragend die Augen. »Warum tust du das?«
Cohen zuckte mit den Achseln und faltete den Lappen zusammen, seine Haltung zeigte deutlich sein Unbehagen.
»Ich bin ein todgeweihter Mann«, sagte der Luzianer, und nun war ihm anzuhören, wie sehr ihn das in Trauer versetzte.
»Meine Mutter sprach einst zu mir, als ich noch ein Kind war«, begann Cohen und fuhr dem anderen gleich noch einmal mit dem Lappen über die Stirn, »dass ich, wenn ich einem anderen Wesen etwas Wohlwollendes tun kann – sei es noch so belanglos –, es auch tun soll.« Und er hatte im Krieg genug Schlechtes getan, er wollte nur einmal etwas Gutes für jemanden tun, der sterben musste. »Weil die Götter alles sehen. Und die wohl größte Sünde in den Augen der Götter ist es, einem anderen Lebewesen, ob Freund oder Feind, in der Not keine Hilfe zu leisten, oder in finsterer Zeit keinen Trost zu spenden.«
Der Gefangene betrachtete Cohen, während dieser sprach, neugierig. »Und wenn derjenige das gar nicht möchte?«
Cohen schüttelte den Kopf, er ließ ab von dem Gefangenen. »Der Versuch zählt.«
»Aha.« Der Luzianer musterte Cohens Gesicht herablassend. »Und du tust es, weil du es willst, oder weil es deine Götter von dir verlangen?«
»Udken sprach einst zu seinen Widersachern: Nur, weil wir Feinde sind, müssen wir nicht unmenschlich zueinander sein.«
»Nie von ihm gehört.«
»Ohne Erinnerung kennst du vermutlich keinen einzigen der Götter.«
Er schüttelte den Kopf. »Nicht einen.«
Das stimmte Cohen fast noch ein wenig trauriger als zuvor. Bei wem sollte der Luzianer Trost finden, wenn er nicht einmal die Götter kannte?
»Udken ist der Gott der Gnade, und Schutzpatron aller Bastarde«, erklärte Cohen. »Bete zu ihm, wenn du morgen vor dem Henker stehst.«
Cohen schob den Hocker zurück und stand auf, als dem Gefangenen etwas ins Auge fiel: »Wer schenkte einem Bastard so etwas Wertvolles?«
Cohen sah an sich hinab und erkannte den winzigen Anhänger, den er mit einem Band aus Ziegenleder um den Hals gehängt hatte. Es war ein Fuchskopf aus geweihtem Gold, gerademal so groß wie ein Fingernagel.
»Ich bekam ihn von der Kirche, nachdem Eid, den ich vor Udkens Schrein ablegte«, erläuterte Cohen. »Ich kämpfe und lebe für die Götter und unsere Kirche.«
Lange sah der Gefangene Cohen in die Augen, und Cohen vermochte nicht zu sagen, was der andere Mann dachte.
»Als dann, ich verabschiede mich.« Cohen wandte sich ab und legte sich seinen Umhang wieder um.
»Kann ich ihn haben?« Es war eine zögerliche, unsichere Frage.
Cohen drehte sich verwundert zu dem Gefangenen um.
»Nur … bis nach meinem Tod.« Er versuchte sich an einem Lächeln, aber seine Angst vertrieb es schnell wieder. »Vielleicht geleitet mich dein Schutzpatron in eine angenehmere Nachwelt.«
»Sofern es den Göttern gefällt«, fügte Cohen streng an. Mörder und Bastarde kamen nicht in das Himmelsreich … Und doch, war es nicht das, was Udken mit seinen Predigten auszusagen versucht hatte? Gnade auch für all jene, die sie nicht verdienten? Cohen verdiente sie ebenso wenig wie der Gefangene, nachdem er auf dem Schlachtfeld so viele Familienväter und Sohne getötet hatte.
Nach kurzem Zögern ging er zurück zur Streckbank, nahm den Anhänger ab und legte die Kette dem Luzianer um den Hals.
Dankbarkeit und Neugierde standen in dem Blick des Luzianers, als Cohen sich abwandte und eilig zur Tür ging.
»Hassen mich alle da draußen?«, fragte der Gefangene mit brüchiger Stimme.
Cohen, der die Hand schon auf der Tür hatte, atmete geräuschvoll aus. Er sah sich über die Schulter und erwiderte: »Ein paar nicht, nein.«
Dann ging er, unendlich froh darüber, dem Luzianer nie mehr wieder begegnen zu müssen, außer bei der Hinrichtung morgen, wo sie nicht miteinander sprechen würden.
»Leu nou Udoucou upll gfourol, nou Hoigf likrf.«
Nur der Körper kann sterben, der Geist nicht.
Das Flüstern verstummte und Cohen war unendlich erleichtert.
Ob die Gerüchte über den Gefangenen nun alle wahr waren oder nicht, würde ab Morgen keine Bedeutung mehr haben. Cohen war froh, diese Bedrohung loszuwerden, obgleich im bewusst war, dass eine Legende damit starb. Doch er trauerte nicht darum, dass die Geschichte dieses berüchtigten Luzianers morgen mit dessen Hinrichtung enden würde.
***
Als Cohen endlich den Kerker und das Flüstern hinter sich lassen konnte, stattete er zum letzten Mal an diesem Tag seinem Vater einen Besuch ab, um ihn darüber zu unterrichten, dass der Gefangene tatsächlich seine Erinnerung eingebüßt hatte – wie auch alle anderen, die durch das Portal zurückgekehrt waren – und dass die Hinrichtungen beginnen konnten. Sogleich machte König Rahff sich auf, um für den morgigen Tag alles in die Wege zu leiten. Und Cohen durfte endlich nach Hause zu seiner Frau.
Ohne Stand war es seiner Familie nicht gestattet, in der königlichen Burg zu leben, er hatte sich mit seinem Sold jedoch ein relativ robustes Haus innerhalb der Burgmauern leisten können – das war mehr, als seine Mutter ihm als Kind hatte bieten können.
Cohen sorgte gut für seine Frau und die beiden Kinder – Ilsa war fünf Jahre und Marks sechs Jahre alt – aber manchmal, wenn er vor dem winzigen Haus stand, das sich an andere, ähnliche Steingebäude reihte, fühlte er sich wie der letzte Versager. Er hatte nie eine Familie gewollt, doch die Götter haben es von ihm verlangt, nun musste er die Verantwortung für die drei Menschen tragen, die von ihm abhängig waren. Aber wie sollte er sie beschützen, wenn die Welt unaufhaltsam im Chaos versank. Wie sollte er, ein einziger Mann, seine Heimat vor dem Untergang bewahren? Er konnte nur hoffen, den Krieg so weit wie möglich von seiner Familie fern zu halten.
Als er eintrat, empfing ihn die warme Geborgenheit, die ein Mann nur zu Hause verspüren konnte. Es roch nach Fruchtauflauf und warmer Milch. Fleisch konnten sie sich selten leisten, aber sie taten ihr Bestes, um die Kinder satt zu bekommen. Im Kamin prasselte ein Feuer, daneben entdeckte Cohen seinen treuen Hund, der sich verbotener Weise auf dem gemütlichen Sessel zusammengerollt hatte, der dem Feuer am nächsten stand. Der morsche Holztisch, den Cohen einst einem alten Bekannten – einem Tavernen Betreiber – für ein Dutzend Silbertaler abgekauft hatte, stand ungedeckt und verlassen in der Mitte des Raums, viele Kerben waren in der Platte hinterlassen worden. Ein Summen erklang aus der Küche, die hinter dem ungedeckten Tisch lag. Es war warm und dunkel in den winzigen Räumen, weil draußen bereits die Sonne untergegangen war.
Als Cohen die Holztür hinter sich schloss und die abkühlende Abendluft aussperrte, lockte das Geräusch den Familienhund von seinem gepolsterten Sessel.
»Rollo, mein Freund!« Cohen lächelte auf den verzottelten, grauen Rüden herab, den er vor einigen Jahren für die Kinder mitgebracht hatte, und beugte sich vor, um ihn zu streicheln. Rollo reichte ihm bis zu den Knien, er hatte Schlappohren, ein graues, gekräuseltes Fell und eine schwarze Nase mit einem hellbraunen Punkt. Cohen hatte ihn als Welpen in einem abgebrannten Dorf vorgefunden und beschlossen, ihn mit nach Hause zu nehmen. Die Kinder hatten was davon, ebenso wie der Hund. Es war ein Gewinn für alle Seiten gewesen. Nur Sigha, seine Frau, hatte nicht immer Spaß an Rollo gehabt, dem nicht nur ein Stuhlbein, sondern gleich vier zum Opfer gefallen waren. Außerdem zerriss er mit Vorliebe Kissen, besprang die Beine von Besuchern, verrichtete seine Notdurft in der Küche und stahl alles Essbare aus den Vorratsschränken. Aber egal wie oft sie schimpfte, Cohen wusste, dass Sigha den Hund nur dann wieder hergegeben hätte, wenn jemand ihre Kinder mit gezogener Klinge bedrohen würde.
Der Krach an der Haustür lockte auch die anderen Bewohner aus ihren Ecken.
»Onkel Cohen! Onkel Cohen!«, riefen seine Kinder voller Begeisterung, als sie mit ihren kleinen Füßchen die schmale, steile Treppe hinunterrannten.
Marks warf sich zuerst in Cohens Arme, der sich etwas hinab beugte und mit einem breiten Grinsen seinen Neffen empfing. Er umarmte ihn fest, breitete aber den anderen Arm aus, um auch Ilsa in Empfang zu nehmen. Als sich ihre Arme um seinen Hals schlossen, drückte er beide an sich und hob sie hoch.
»Ach, wie habe ich euch vermisst, ihr kleinen Monster!«, neckte er sie und ließ es sich nicht nehmen, sie länger an sich zu drücken, als sie es wollten.
Schließlich setzte er sie wieder mit den Füßen auf den Boden ab und ging vor ihnen auf die Knie, um sie genau betrachten zu können. Marks war bereits jetzt ein großer und strammer Bursche, er würde ein imposanter Mann werden, genau wie sein Vater, mit dunklem Haar und blauen Augen. Ilsa war eher klein, wie ihre Mutter, mit Pauspäckchen und lockigem, haselnussbraunem Haar; die grünen Augen hatte sie von ihrer Mutter.
Es gab Zeiten, da wünschte er, sie wären die Frucht seiner Lenden. Cohen liebte Kinder, sehr sogar, auch wenn er bei fremden Kinder nie wusste, wie er mit ihnen umgehen sollte. Aber er hatte Ilsa und Marks aufgezogen. Ihren leiblichen Vater hatten sie gekannt, doch, weil sie ihn selten sahen und in der Öffentlichkeit nicht darüber sprechen durften, dass Cohen nicht ihr Vater war, war er für Ilsa und Marks ehe ein Fremder gewesen. Dieser Umstand war sehr traurig, aber nicht zu ändern. Für ihre Sicherheit war es wichtig, dass ihre wahre Abstammung geheim blieb.
»Hast du uns was mitgebracht?«, riefen sie wie aus einem Munde, ihre Kinderaugen strahlten vor Vorfreude.
Noch einmal Kind sein, seufzte Cohen, und nicht wissen, was Krieg war. Sie wussten, dass er gegen »schlimme Männer« in den Kampf zog, doch von der Grausamkeit über Tod und Gewalt hatten sie noch keinen blassen Schimmer; und Cohen wollte sie so lange wie möglich von der Wahrheit fernhalten.
»Natürlich habe ich euch etwas mitgebracht!« Er steckte die Hand in die Taschen seines Mantels und zog für die beiden jeweils einen mit edlen Schnitzereien verzierten Holzdolch heraus. Er hatte beide selbst geschnitzt, während er unterwegs gewesen war.
Ihre Münder öffnete sich erstaunt und ihre Augen funkelten voller Glück.
Cohen lächelte. Er hatte einmal versucht, Ilsa eine Puppe mitzubringen, die sie aber nicht wollte. Ilsa war, ganz wie ihre Mutter, keine Frau, die sich in eine Geschlechterrolle zwängen lassen wollte. Sie war im Herzen ebenso ein Krieger wie ihr großer Bruder einer war.
Es hatte Cohen Angst gemacht, dass Ilsa Interesse an Kampfkunst zeigte, aber er würde nie versuchen, es ihr auszureden. Eines Tages jedoch, so war ihm heute bereits bewusst, würde er eine unangenehme Unterhaltung mit ihr führen müssen. Cohen wollte ihr alles zu Füßen legen, aber er wusste auch, dass es gefährlich für sie werden konnte, wenn sie sich gegen die Sitten der Kirche wehrte. Eine Frau durfte nicht kämpfen, nicht mehr. Eine Frau durfte nur Kinder gebären und kochen, sie durfte auch Wein ausschenken, auf einem Bauernhof arbeiten und Waren auf dem Markt verkaufen, aber niemals ein eigenes Geschäft führen. Er wusste, vor allem als Vater einer charakterstarken Tochter, dass dies nicht gerecht war. Aber er konnte nicht ändern, dass die Welt war, wie sie war, er konnte nur dafür sorgen, dass Ilsa nie um ihr Leben fürchten musste. Mehr wollte er gar nicht.
»Du bist wieder da.«
Cohen blickte bei der lieblichen Stimme seiner Frau auf. Sigha stand im Türrahmen zur Küche. Sie trug ein einfaches Kleid aus blassblaugefärbten Leinen und eine schmutzige Schürze darüber, an der sie ihre zierlichen Finger abtrocknete. Ihr haselnussbraunes Haar trug sie hochgesteckt, eine Strähne hatte sich gelöst und hing in ihrem weichen, sehr weiblichen Gesicht. Ihre grünen Augen nahmen Cohen kritisch in Augenschein.
Cohen nickte nur stumm.
»Kinder. Ins Bett!«, befahl Sigha.
Ilsa und Marks drehten sich zu ihr um. »Aber, Mama …«
Sigha funkelte sie erbost an und zeigte mit einem gebieterischen Finger auf die Treppe. »Ich sagte: ins Bett mit euch.«
Sie ließen entmutigt die Köpfe hängen. »Ja, Mama …« Hinter einander trotteten sie die Stufen nach oben, die bei jedem Schritt knacksten, und sahen sich sehnsüchtig über die Schultern.
Cohen blickte ihnen entschuldigend nach, dann erhob er sich und legte den Mantel ab.
Sigha deutete auf seine Füße. »Stiefel aus! Oder du wischst morgen den Boden selbst, Kommandant.«
Seit ihrer frühsten Jugend hatte Sigha es sich zur Aufgabe gemacht, Cohen Befehle zu erteilen, und nur, weil er eine Handvoll Männer befehligte, würde Sigha gewiss nicht zulassen, dass er in ihrem Haus die Hosen anhatte.
Schmunzelnd kam Cohen ihrem Befehl nach, er liebte sie für ihre herrische Art, sie meinte es ja auch nie böse.
Er folgte ihr in die Küche und war sofort skeptisch, als er den dort gedeckten Tisch erblickte.
»Setz dich, ich habe für dich gekocht«, erläuterte Sigha mit einem verschlagenen Schmunzeln.
»Willst du mich vergiften?«, scherzte Cohen und nahm Platz.
Es war äußerst ungewöhnlich, dass Sigha die Kinder wegschickte und ihn bediente. Sigha bevorzugte es, mehr gute Mutter als pflichtbewusste Hausfrau zu sein. Außerdem, so hatte Cohen schon oft bemerkt, wäre sie auf dem Schlachtfeld als Befehlshaberin besser aufgehoben gewesen als in der Küche. Doch heute benahm sie sich wie die liebreizende Ehefrau, die sie nie hatte sein wollen und die sie für ihn auch nicht hatte sein brauchen.
Sie wollte, dass er sich wohl fühlte, sie schenkte ihm ein süßes Lächeln – und da wusste er mit Gewissheit, dass sie etwas von ihm wollte.
Während er aß und versuchte, den langen Tag abzuschütteln, umsorgte sie ihn mit geradezu übertriebener, mütterlicher Wärme, die ihm zwar wohltat, ihn jedoch noch mehr das Gefühl gab, dass sie etwas plante.
Nach dem Essen – und reichlich Wein, den Sigha ihm immer wieder nachschenkte – wusch Cohen sich den Schmutz des Tages ab, mit Wasser aus einer Schale, das Sigha nur für ihn warm gemacht hatte. Danach ließ er sich, nur in Unterhosen, auf die kalte Matratze nieder. Im Schlafzimmer brannte nur eine Kerze, der Raum an sich war schmucklos, solchen Luxus konnten sie sich nicht leisten, obwohl Sigha ihr Bestes tat, um aus dem Haus ein Heim zu machen. Weder Cohen noch Sigha machten sich etwas aus Reichtum, aber, wenn man Kinder hatte, fragte man sich unweigerlich ständig, ob das, was man bieten konnte, denn auch genügte. Natürlich wurden Ilsa und Marks geliebt, aber von Liebe allein wurden sie auch nicht satt. Außerdem war Cohen viel zu oft nicht anwesend, um sich wirklich zu kümmern. Er war Sigha wirklich froh, dass sie ihm deshalb keine Vorwürfe machte. Als sie den Bund eingegangen waren, hatten sie sich geschworen, es aus reinem Selbstschutz zutun und nichts von dem anderen zu erwarten, außer Stillschweigen darüber zu wahren, dass sie eigentlich nur Freunde waren, die sich zwar liebten, aber eben nicht auf diese Weise liebten.
»Ich möchte noch ein Kind.«
Cohens Kopf flog herum. Sigha stand im Türrahmen, der dunkle Flur hinter ihr wirkte wie eine schwarze Wand. Sie hatte die Schürze abgelegt und das Haar geöffnet.
»Was?« Cohen sah sie verständnislos an. Wie sollte er denn das verstehen?
Sigha blickte sich über die Schulter und horchte in den Flur hinein. Erst als sie sicher war, dass die Kinder schliefen, trat sie ein und schloss leise die Tür.
Für einen Moment kam sich Cohen eingesperrt vor.
»Ich sagte, ich möchte noch ein Kind«, wiederholte sie schließlich voller Entschlossenheit. »Ich möchte dir ein Kind schenken.«
Cohen wich jegliche Farbe aus dem Gesicht. »Ich soll dir ein Kind machen?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Du bist doch mein Mann, oder?«
»Du liebst mich nicht.«
»Menschen bekommen ständig Kinder mit anderen Menschen, die sie nicht lieben, Cohen«, sie ging hinüber zu einem undichten Fenster und versuchte, die Holzläden fest zu binden, die im leichten Abendwind klapperten. »So etwas nennt man Ehe, Dummkopf.«
Es war traurig, dass sie recht hatte.
»Was ist mit … Raaks?«, fragte er leise und einfühlsam, weil er wusste, dass die Erwähnung seines Bruders sie zutiefst schmerzte.
Sigha blickte gegen die Holzläden, als könnte sie durch sie hindurch auf die Straße darunter blicken. Er vermochte nicht zu sagen, was ihr nun durch den hübschen, sturen Kopf ging.
Nach einer Weile erwiderte sie: »Mein Geliebter ist bereits seit vier Jahren tot, Cohen. Ich lebe aber noch. Und ich möchte es mit neuem Leben füllen. Es muss weitergehen«, sie drehte sich um und sah ihn eindringlich an, »und bei dir auch.«
Raaks und Sigha hatten sich in einander verliebt als sie alle noch sehr jung gewesen waren, doch da Sighas Familie einfache Bauern gewesen waren, war es Raaks als Kronprinzen nicht erlaubt, sie zur Frau zu nehmen. Für Raaks wurde eine Ehe arrangiert, er heiratete eine Tochter aus dem Adel. Doch es wurden schnell Gerüchte über eine Geliebte bekannt, die angeblich schwanger wurde: Sigha.
Sigha war Cohens beste Freundin, seit er sie als Kind auf dem Mark getroffen hatte. Sie und ihre Mutter hatten immer Gemüse verkauft, das Cohens Mutter mit Vorliebe zum Kochen verwendet hatte.
Er hatte nicht gezögert, sie zu heiraten und Raaks Kinder als seine aufzuziehen, damit sie nicht in Gefahr gerieten. Insofern waren sie tatsächliche seine Familie, wenn auch nicht so, wie es der äußere Schein Glauben machte.
Aber was sie nun von ihm verlangte, hätte er sich nie träumen lassen.
Cohen ließ den Kopf hängen.
»Ich weiß, du hast andere Sorgen als mich.« Sigha setzte sich neben ihn und streichelte ihm mit ihren schlanken Fingern den Nacken. »Aber vergiss nicht, dass du immer die Wahl hast, einen anderen Weg einzuschlagen.«
»Ich halte dich nicht auf, wenn du zu den Rebellen gehen willst«, flüsterte Cohen. »Aber um deine Kinder zu schützen, muss ich dir sagen, dass es euer Tod sein wird.«
»Ich werde nicht gehen, Dummkopf! Aber warum bist du deinem Vater weiterhin so treu? Er ist nicht einmal mehr in der Lage, seine eigenen Söhne vor seinen Hintermännern zu bewahren, und du wirst ihr nächstes Ziel sein. Du solltest etwas unternehmen!«
»Und was?«, zischte er sie an. Es tat ihm sofort leid, als sie ihn schockiert ansah.
Er blinzelte und schüttelte traurig den Kopf. »Verzeih. Es ist nicht deine Schuld.«
Aber sie war ihm nicht böse, sie wusste, dass er nicht hitzköpfig war. Nur der Umstand, dass er eine schlimme Zeit durchlebte, sorgte dafür, dass er unausstehlich wurde. Cohen schämte sich, weil sie es abbekam.
»Das mit Sevkin tut mir leid«, hauchte sie ihm zu. Sigha hatte sich nach der Hinrichtung um Cohen gekümmert, der Wochenlang nicht aus dem Bett aufgestanden war.
»Es ist nicht mehr zu ändern.« Cohen starrte grimmig vor sich hin. Eines Tages, schwor er sich, würde er seinen Bruder rächen.
Sigha nahm seine Hand in ihre und blickte ihm mitfühlend in die Augen. »Cohen, vergiss bitte eines nicht: Sevkin hat genau gewusst, was er tat und wie gefährlich es für ihn war. Du darfst nicht darüber hinwegsehen, dass er damit vor allem dein Herz brach. Du darfst auch wütend auf die Toten sein.«
Cohen wollte protestieren, aber das Mitgefühl seiner wunderschönen Frau trieb ihm nur Tränen des Kummers in die Augen.
Sigha hob ihren Arm und kämmte mit den Fingern durchs Cohen kurzes, braunes Haar. »Schenk mir noch ein Kind, Cohen.«
Ruckartig entzog sich Cohen der Berührung seiner Frau und stand auf. »Wie kommst du nur auf eine solche Idee, Sigha?«
Als er sich zu ihr umwandte, blickte sie nur umso entschlossener zu ihm auf.
»Ich war bei den Hexen«, erklärte sie.
Und da wurde ihm alles schlagartig bewusst.
Er stöhnte und wandte sich das Gesicht reibend von ihr ab. »Du solltest doch nicht mehr zu diesen Weibern gehen!«
Der Hexenzirkel hauste im Wald nahe bei der Burg, viele Bauersfrauen gingen zu ihnen und brachten ihnen Vorräte als Opfergaben mit, um etwas über ihre Zukunft zu erfahren. Und jede Frau, die dabei erwischt wurde, wurde zum Tode verurteilt. Denn Hexerei war verboten.
»Sigha, das ist gefährlich!« Cohen sah seine Frau wieder an. »Wenn die Wachen dich dabei erwischen …«
»Zeige ich ihnen meinen blanken Hintern«, scherzte sie und grinste frech.
Cohen schüttelte verdrossen den Kopf. »Ich kann dich nicht vor allem schützen.«
»Das sollst du ja auch nicht. Du sollst mir nur deinen Samen schenken.«
Cohen runzelte missgelaunt die Stirn und blickte zu Boden. Hatte sie nicht genug damit zu tun, zwei Mäuler zu stopfen, musste noch ein dritter Magen hungern?
»Sie sagten es mir«, flüsterte Sigha, ihr Mut sank allmählich, »die Hexen. Sie sagten, es wäre von größter Wichtigkeit, dass ich dein Kind gebäre. Für dich, ebenso wie für mich. Und die Götter werden mich dafür mit großem Respekt und Ansehen belohnen.«
Cohen schnaubte. »Ich dachte, daraus machst du dir nichts.«
»Was glaubst du, wer zuerst stirbt, sollte der Krieg uns hier einholen?« Sigha blickte ihn wissend an. »Die Bauern und die Armen. Die Menschen des Adels leben am längsten.«
Betroffen, aber außerstande um etwas zu sagen, starrte Cohen auf sie hinab. Sie hatte recht und er fühlte sich schuldig, weil er ihr nie mehr bieten konnte als dieses alte, morsche Haus.
Sigha erhob sich und leckte sich nervös die Lippen. Sie trat auf ihn zu, ihre Röcke wippten um ihre schmalen Knöchel, sie schwebte geradezu. Anmutig. Stolz.
»Du hast viel Wein getrunken«, sagte sie und legte ihm beide Hände in den Nacken um ihn zu sich heran zu ziehen. »Ich weiß, es wird für uns beide seltsam sein, bei einem so engen Freund zu liegen, aber ich glaube fest daran, dass nur Gutes dabei hervorgehen wird. Schenk mir ein Kind!«
Cohen hob die Arme und rieb sich das Gesicht. Er wollte nicht, dass sie seine Tränen in den Augen sah. Er wusste ja nicht einmal, ob er körperlich im Stande war, ihr das zu geben, wonach es ihr in dieser Nacht verlangte.
»Wünschst du dir keinen Sohn?« Sie lächelte, als er die Hände fallen ließ. »Du könntest tatsächlich einen Nachkommen zeugen.«
Cohen wünschte sich – wie jeder Mann in seinem Alter – sogar sehr einen Sohn. Oder eine Tochter. Völlig egal. Am besten beides. Er hätte vor einigen Jahren viel dafür gegeben, hatte den Gedanken aber wieder verworfen. Zwar war seine Ehe mit Sigha nur zum Schein, dennoch hatte er nicht gewollt, dass sie damit leben musste, dass ihr Mann Kinder mit einer anderen Frau bekam. Sie wäre dem fiesen Gespött der Nachbarn ausgeliefert gewesen.
Jetzt bot sie es ihm an, aber zu einem völlig ungünstigen Zeitpunkt. Er schüttelte den Kopf, er war nicht sicher, ob er wirklich konnte …
»Bitte. Tu mir diesen Gefallen«, bat sie und schmiegte sich mit ihren weichen Rundungen an seinen harten Körper. Es war ungerecht, weil sie wusste, dass er ihr unmöglich eine Bitte abschlagen konnte.
»Versuchen wir es. Nur dieses eine Mal«, bat sie ihn inständig. »Legen wir das Schicksal in die Hand der Götter, für die du kämpfst. Mögen sie entscheiden, ob du es wert bist, ein Kind zu erhalten.«
Und Cohen ließ sich zum Bett zerren …