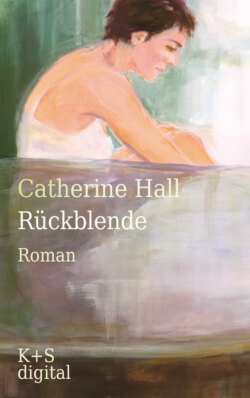Читать книгу Rückblende - Catherine Hall - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Neun
ОглавлениеAls ich anfangs in diese Sache einstieg, liebte ich den Gedanken, frei zu sein, aber die Kehrseite der Freiheit ist Einsamkeit. Es für dich aufzuschreiben, zu versuchen, es in Worte zu fassen, war wichtig. Ich wollte, dass du erfährst, was sich wirklich ereignet hat, was sich abseits der Fotos in den Zeitungen zutrug, die Dinge, die ich nicht mit meiner Kamera eingefangen habe, die Geschichten hinter den Aufnahmen.
Ich liebte es auch, deine Geschichten zu bekommen, besonders die E-Mails – viel mehr als die raschen Anrufe mit einem geliehenen Satellitentelefon, die sporadischen SMS, wenn ich Empfang hatte. In meinem Posteingang etwas von dir vorzufinden war die Versicherung, dass es da draußen noch etwas anderes gab, jenseits des Wahnsinns, etwas Normales und Menschliches und Vernünftiges.
Das war mit das Schlimmste an der Trennung – dich nicht dazuhaben, während ich versuchte, in meinem Kopf alles klarzukriegen. Das ist das, was ich jetzt tun muss, Suze. Ich muss dir erzählen, was los ist, so wie früher, ich muss dir erklären, was in Kabul passiert ist. Ich erwarte keine Antwort, ich weiß, dass es dafür zu spät ist, aber du bist immer noch die Einzige, die es vielleicht verstehen kann.
Erinnerst du dich an meine erste Reise nach Afghanistan, damals im Jahr 2001? Es war wenige Wochen nach 9/11, als wir zusammen auf dem Sofa saßen und entsetzt auf den Fernseher starrten, während die Twin Towers zusammenbrachen. Die Amerikaner waren im Begriff, Kabul zu bombardieren, und ich wollte unbedingt darüber berichten. Ich packte meine Koffer, gab dir einen Abschiedskuss und reiste ab.
Ich habe dir nie viel von dieser Reise erzählt. Du warst zu wütend auf mich – erst, weil ich wegging, und dann, weil ich so lange wegblieb. Ich sah die Bilder, die du gemalt hattest, während ich fort war, die Wut in ihnen, den Schmerz und die Einsamkeit. Das war, als du mit jemand anderem geschlafen hast, deine erste Affäre, und das war das, worum es in unseren Gesprächen in den Wochen danach ging, und nicht darum, wo ich gewesen war.
Mit dieser Reise fing alles an schiefzulaufen, die Geschichte zwischen dir und mir. Und damit muss ich anfangen.
Ich wusste, dass ich niemals direkt in Kabul würde einreisen dürfen, also nahm ich den Umweg über Moskau und Tadschikistan, dann mit einem Hubschrauber nach Khoja Bahauddin, dem Sitz der Nord-Allianz, einer trostlosen afghanischen Wüstenstadt mit schlammfarbenen Häusern, die nahtlos aus dem Boden ragen und deren Wände allesamt aus der gleichen tristen Erde geformt sind, Kamele und Esel, die Brennholz transportieren – kein Strom, keine Kanalisation, kein fließendes Wasser, keine gepflasterten Straßen. Ich suchte mir einen Fahrer und einen Dolmetscher. Mein Freund Tim, ein Reporter von der Washington Post, besorgte uns eine Mitfahrgelegenheit, und gemeinsam fuhren wir in einem alten russischen Jeep durch den Hindukusch, über reißende Flüsse, staubige Gebirgsausläufer, Wüstenebenen, vorbei an Soldaten, die zum Gebet knieten, die Krümmung ihrer Rücken glich der Form der Berge hinter ihnen. Wir kamen durch Dörfer, deren Bewohnerinnen und Bewohner in der klirrenden Kälte barfuß gingen, und übernachteten in verdreckten Pensionen, wo wir fettiges Ziegenfleisch und Naan-Brot aßen und uns dann in alles einwickelten, was wir fanden, um so gut es ging zu schlafen. Die Landschaft war außergewöhnlich: Riesige Felswände ragten über uns auf, durchzogen von Sturzbächen, die weit unter uns außer Sichtweite aufplatschten.
Es dauerte eine Woche, bis wir die Shomali-Ebene erreichten, Niemandsland, eine Pufferzone zwischen der Nord-Allianz und den Taliban – ein trostloser, windiger Ort, getupft mit Häusern, die von Einschusslöchern durchsiebt waren, zerstörten Panzern und ausgebrannten Jeeps. Leichen lagen in verrenkter Haltung im Staub, die Beine verdreht, die Köpfe in den Nacken geworfen. Plastiksandalen lagen verstreut auf der Straße, neben Kleidungsstücken und dunklen Blutspritzern.
Wir erreichten die Kuppe eines Hügels, und plötzlich lag Kabul unter uns, eine riesige Ansammlung von niedrigen Häusern, hier und da unterbrochen von Wohnblöcken im sowjetischen Stil. Der Anblick war großartig: eine Stadt, umgeben von einem Ring aus Bergen und dahinter noch mehr Berge mit weißen Spitzen. Die Sonne verschwand am Horizont und tauchte die Berge in ein sanftes rosa Glühen. Lichter gingen an, das erste Anzeichen von Elektrizität, das ich seit meiner Ankunft sah, kleine Glühwürmchen, die die Hänge tupften.
Ich fragte mich, was wir wohl vorfinden würden, wenn wir in der Stadt ankamen. Das Bild von Kabul, das ich im Kopf hatte, war aus Berichten in den Nachrichten und einer Handvoll verblichener Fotos zusammengesetzt. Edith hatte Kabul 1968 besucht, auf einer langen, abenteuerlichen Reise in einem Land Rover von London nach Kalkutta. Auf ihren Fotos fuhren Frauen in Kleidern Bus und Kinder rutschten auf Spielplätzen knallbunte Rutschen hinunter. Die Berichterstattung aus der Zeit, als die Taliban an der Macht waren, sah völlig anders aus: Frauen, reduziert auf stumme blaue Gestalten; das geheime Filmmaterial von der öffentlichen Hinrichtung einer dieser Frauen im Fußballstadion von Kabul: auf der Ladefläche eines LKW herbeigebracht und gezwungen, sich hinzuknien, dann in den Kopf geschossen, während ihre sieben Kinder zusahen und weinten.
Jetzt lag die Stadt in Trümmern. Wir fuhren an einem Häuserblock nach dem anderen vorbei, an Häusern ohne Dächer oder Wände, Löcher klafften, wo einst Fenster gewesen waren. Die Fassaden waren mit Einschusslöchern übersät, die Wände von Panzergeschossen aufgerissen. Balken und Träger ragten in absurden Winkeln hervor und hielten das Wenige, was noch übrig war, zusammen. Filigrane Balkone hingen, jetzt von Rissen durchzogen, an den Fassaden einst anmutiger Häuser. Überall Schutthaufen. Als es Abend wurde, erfüllte Rauch die Luft, als Familien kochten oder sich dicht um Feuerstellen kauerten, um warm zu bleiben.
»Es ist wie Dresden«, sagte Tim. »Oder Hiroshima. Scheiße, Jo, was haben wir getan?«
Mahmoud, unser Dolmetscher, hustete. »Das waren nicht die Amerikaner«, sagte er leise. »Das ist schon seit Jahren so. Es waren die Taliban, und vor ihnen war es der Bürgerkrieg, es waren die Mudschahedin. Es waren nicht die Fremden. Wir selbst haben uns das angetan.«
Das Intercontinental Hotel war ein weißes, ziemlich hässliches Gebäude oben auf einem Höhenzug in der Mitte der Stadt. Es war voller Journalistinnen und Journalisten, die um die Zimmer kämpften. Wir waren so schnell herbeigeströmt, wie es uns gelang, jemanden zu überreden, uns herzubringen – die einzige Spezies auf der Welt, die auf Krisenherde zu rennt, anstatt vor ihnen davonzulaufen. Ich hatte es geschafft, ein Bett in einem Zimmer mit Molly zu ergattern, einer CNN-Korrespondentin, mit der ich in Sierra Leone gewesen war. Wie üblich hatte sie eine Flasche Gin organisiert. Wir mischten ihn mit ein paar Dosen saurer Limonade und saßen in unsere Schlafsäcke eingemummelt da und tranken ihn aus angeschlagenen Gläsern.
»Was hat euch aufgehalten?«, fragte sie.
Es war erst drei Tage her, seit die Taliban gestürzt worden waren. Molly war eine der ersten JournalistInnen gewesen, die nach Kabul gekommen war, still und heimlich über die Grenze zu Pakistan.
»Es war total verrückt«, sagte sie. »Die Straße war voller Taliban, lange Schlangen dieser weißen Toyotas, die bin Laden bezahlt hat, alle mit Frauen und Kindern vollgestopft, und das Gepäck stapelte sich bis oben auf dem Kofferraum. Erinnerte mich an die Ausfallstraßen von New York am Labor Day.«
Alles, was ich wollte, war, mich mit ihr zu betrinken und zu quatschen, aber nach dem ersten Gin stand sie auf und ging zu dem Tisch in der Ecke hinüber, fuhr sich mit einem Lippenstift über den Mund und bürstete sich die Haare.
»Ich bin gleich auf Sendung«, sagte sie. »Vom Dach. Komm doch mit und schau zu, wenn du möchtest.«
Das Dach war voller KorrespondentInnen, Kameras und Satellitenschüsseln, angetrieben von einer Reihe Generatoren, einem für jeden Nachrichtensender. Ich arbeitete zum ersten Mal auf eigene Rechnung – ohne Vertrag, ohne Deadline, ohne Chef. Um überhaupt eine Chance im Konkurrenzkampf zu haben, musste ich jemanden finden, der mir half, und zwar schnell: einen Übersetzer, eine Ortskraft, jemanden, mit dem ich zusammenarbeiten konnte, jemanden, dem ich vertrauen konnte. Von dieser Person würde es abhängen, welche Art von Aufnahmen ich würde schießen können.
Früh am nächsten Morgen ignorierte ich die Angebote der Gruppe von Männern draußen vor den Toren des Hotels und nahm ein Taxi zum Basar. Die Stadt sah noch schlimmer aus als am Abend zuvor – das helle Sonnenlicht ließ alles noch desolater erscheinen. Kinder mit von der Mangelernährung orangefarbenen Haaren spielten in offenen Gossen; streunende Hunde suchten nach etwas zu fressen. Männer saßen am Straßenrand, vor sich Dinge ausgebreitet, die zum Verkauf standen: ein Haufen nicht zueinanderpassender Sandalen, Autoersatzteile, Metallschrott.
Ich beugte mich vor, um etwas genauer in Augenschein zu nehmen: eine Ansammlung von etwas, das wie menschliche Knochen aussah. Die Miene des Verkäufers ließ auf nichts Ungewöhnliches schließen – es hätte sich genauso gut um Gemüse oder Blumen handeln können.
Eine Stimme sagte leise auf Englisch: »Ja, das stimmt, das sind Wirbelknochen. Und sehen Sie, da ist auch ein Wadenbein.«
Ich drehte mich um und sah einen Mann, jung, in den Zwanzigern, sein Kinn war fleckig und mit Wattebauschfitzeln bedeckt.
Er bemerkte meinen Blick und lächelte. »Ich bin heute Morgen meinen Bart losgeworden«, sagte er. »Der Barbier war ein bisschen aus der Übung. Mein Name ist Faisal. Salam aleikum.«
»Aleikum asalam. Ich bin Jo.«
»Die Taliban haben uns den Handel mit vielen Dingen verboten. Knochen gehörten zu den wenigen Dingen, die nicht verboten waren.«
»Warum sollte jemand sie kaufen wollen?«
»Um sie an Fabriken in Pakistan zu schicken. Sie machen daraus Knöpfe und Seife.«
»Woher haben sie die?«
Er lachte. »Die Bomben brachten die Erde so heftig zum Beben, dass die Gräber ihre Knochen ausgespuckt haben. Man muss nicht tief graben, um sie zu finden. Gewöhnlich machen das Kinder. Ihre Hände sind klein, deshalb sind sie gut für den Job.«
Er bemerkte meinen Gesichtsausdruck. »Wissen Sie, die Leute haben keine große Wahl.«
»Und was ist mit Ihnen?«, fragte ich.
»Als die Taliban kamen, war ich auf der Universität und habe Medizin studiert. Ich wollte schon immer Arzt werden. Das ist mein Traum. Während sie hier waren, habe ich zu Hause weiterstudiert.«
»Und jetzt?«
»Ich warte darauf, dass die Universität wieder öffnet.«
»Ich bin hier, um Fotos zu machen«, sagte ich. »Ich suche jemanden, der mit mir zusammenarbeitet, der übersetzt, mich herumführt und mir sagt, wo man gut hingehen kann. Wären Sie daran interessiert?«
Er dachte einen Moment nach und nickte dann. »Ja«, sagte er. »Es wäre mir ein Vergnügen.«
Faisal führte mich durch enge Gassen, vorbei an verlassenen Grundstücken mit zerbrochenen, umgestürzten Blumentöpfen und Vogelkäfigen, die leer dahingen. Wir waren stundenlang unterwegs, es war, als würde er sich die Straßen seiner Stadt zurückerobern. Er wies mich auf Barbiere hin, die weiteren Kunden die Bärte abnahmen, auf Menschenmengen vor einem Kino, die auf die Nachmittagsvorstellung warteten, auf Horden von Jungen im Teenageralter, die Postkarten von Bollywood-Stars anstarrten, die zum Verkauf aushingen. Als wir eine Straße voller Obststände entlanggingen, blieb er plötzlich stehen.
»Hörst du das?«, fragte er.
Der schwache Klang von blechernem Pop driftete die Straße hinunter.
»Das macht mich sehr glücklich«, sagte er. »Seit fünf Jahren ist das die erste Musik, die ich höre.«
Auf dem Rückweg zum Intercontinental machte ich ein Foto von einem Mann, der sein Fahrrad schob, an dessen Lenker ein riesiges Bündel Luftballons gebunden war, die beim Überqueren der Schlaglöcher wippten. Sie leuchteten im Wintersonnenlicht, hoffnungsvolle Farbkleckse im Staub.
Kabul lag auf einer solchen Höhe, dass mir schon allein beim Gehen auf der Straße schwindelig wurde. Im Laufe der nächsten Wochen wurde es so kalt, dass das Atmen wehtat. Meine Nase lief ständig, meine Lippen waren spröde und rissig. Ich zog mit Molly und dem Rest der CNN-Crew nach Wazir Akbar Khan, einem Nobelviertel im Norden der Stadt. Ich hatte dringend aus dem Intercontinental rauswollen. Es waren zu viele von meiner Sorte dort, zu viele Journalistinnen und Fotografen und Kamerateams.
Es war – wie im Holiday Inn in Sarajevo oder die amerikanische Kolonie in Jerusalem – eine kleine Gemeinschaft geworden, voller Intrigen, Klatsch und Tratsch und Sex. Es war, wie es das immer ist, das Summen der Frontlinie, die aphrodisierende Wirkung der Gefahr und des Fernseins von zu Hause, von der Normalität, von allem, das man sich im wirklichen Leben vielleicht zweimal überlegen würde. Ich habe mich auf nichts eingelassen – das habe ich nie, trotz deiner Ängste und der Auseinandersetzungen, die wir darüber hatten. Selbst wenn ich es gewollt hätte – Kriegsberichterstattung ist eine ziemlich straighte Angelegenheit.
Aber lassen wir dieses Thema. Ich entwickelte eine Routine: Ich wanderte mit Faisal durch die Straßen und suchte nach Motiven. Anfangs fotografierte ich eine Menge Burkas und versuchte zu erfassen, was sie bedeuteten. Ästhetisch gesehen, wirkten sie wunderschön, das Blassblau gegen beigen Staub, aber mir war schnell unwohl dabei, sie auf eine Farbpalette zu reduzieren.
Als ich Faisal das erzählte, lachte er.
»Komm mit zu mir nach Hause. Ich habe fünf Schwestern. Frag sie.«
Faisals Schwestern waren ganz anders als die geisterhaften blauen Gestalten auf der Straße – wunderschön gekleidet in seidenen Salwar Kameezes, ihre Gesichter fachkundig geschminkt. Zunächst waren sie still, dann wurden sie mutiger und bombardierten mich mit Fragen, wobei Faisal übersetzte.
»Wo kommst du her?«
»Aus London.«
»Wie alt bist du?«
»Dreißig.«
»Bist du verheiratet?«
»Nein.«
Sie sahen mich mitleidig an und flüsterten untereinander. Ich fragte mich, was sie von mir dachten, mitgenommen von der wochenlangen Reise und nicht besonders sauber.
Nach einigen Minuten ging Sushila, die älteste Schwester, zu einer Kiste in der Ecke. Sie kramte einen Moment darin herum und holte dann eine kleine Tüte hervor.
»Die Taliban haben uns verboten, uns die Nägel zu lackieren«, sagte sie. »Also haben wir unseren Nagellack immer versteckt. Aber jetzt ist er erlaubt. Wenn wir dir die Nägel lackieren, hast du eine größere Chance, einen Mann zu finden.«
Du hättest über mein Gesicht gelacht, aber ich konnte das Angebot kaum ablehnen. Ich nickte und lächelte und versuchte, begeistert auszusehen. Sie schimpften mich aus, weil ich meine Hände nicht richtig pflege, und schnalzten missbilligend mit der Zunge, weil meine Nägel so kurz waren. Ihre Hände waren seidig glatt und ihre Nägel waren lang und leuchteten alle im selben Rotton.
Als sie fertig waren, leuchteten meine ebenso. Ich lächelte und nickte und bedankte mich herzlich bei ihnen.
Wir drängten uns um den alten Bukhari-Ofen, der einen gemütlichen Geruch nach brennendem Sägemehl verströmte.
»Erzählt ihr mir etwas über Burkas?«, fragte ich. »Ich möchte wissen, wie es ist, so etwas zu tragen.«
Sie holten sie von den Haken herunter. Ich war überrascht, wie sehr sie sich voneinander unterschieden. Ich hatte angenommen, sie wären alle gleich.
Als ich das sagte, lachten die Schwestern.
»Nein, nein«, erwiderte Sushila. »Manchmal ist der Stoff fein, manchmal grob, und für die Stickerei auf dem Oberteil gibt es viele verschiedene Muster. Schau mal, dies hier zeigt Blumen, aber diese hier ist ganz schlicht.«
»Aber sie sind immer blau, richtig?«, fragte ich.
»Nein«, sagte Leila, die zweite Schwester. »Manchmal sind sie auch weiß.«
»Aber nur, wenn man reich ist«, sagte Sushila. »Sie sind schwer sauberzuhalten, also muss man sich mehr als eine leisten können und jemanden haben, der sie wäscht.«
Sie überredeten mich dazu, eine Burka anzuprobieren, hoben sie mir behutsam über den Kopf und rückten sie zurecht, bis der obere Teil meinen Kopf perfekt umschloss. Sie zupften den Stoff um mich herum zurecht und traten dann zurück. Ich war mir sofort des Gewichts des Stoffes bewusst. Faisals Haus war bereits warm vom Bukhari, aber jetzt war mir regelrecht heiß, und ich konnte kaum noch atmen.
»Geh ein bisschen umher«, sagte Leila.
Langsam, tastend ging ich durch den Raum. Es war schwierig zu sehen, wo ich hinging, meine Sicht war auf das kleine Gitter beschränkt. Ich konnte nur geradeaus schauen, es sei denn, ich drehte den Kopf.
»Warte«, sagte Leila. »Hier ist der Spiegel.«
Ich starrte mich an, verwandelt in eine der blauen Gestalten, die ich langsam durch die Straßen hatte wandeln sehen.
Leila lachte. »Sie spürt es!«
»Was?«, fragte ich.
»Das, was wir alle gespürt haben, als wir zum ersten Mal eine Burka anhatten. Als ob du nicht wüsstest, wer du bist.«
Ich sah, wie die blaue Gestalt nickte. »Ja. So ist es«, sagte sie mit meiner Stimme. »Das weiß ich nicht.«