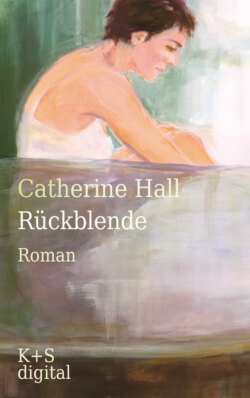Читать книгу Rückblende - Catherine Hall - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Elf
ОглавлениеEs ist Guy Fawkes Night, Suze. Ich habe mich nicht geändert. Die Vorhänge sind zugezogen, und ich trage Ohrstöpsel, um den Lärm auszublenden. Dieses Geblitze und Geknalle, das schreckliche Pfeifen, wenn das Feuerwerk losgeht, werden mich immer an Mörserattacken erinnern. Weißt du noch das Silvesterfeuerwerk auf dem Primrose Hill, als ich mich zu Boden warf und mir die Ohren zuhielt? Ich konnte nicht anders, es war eine reine Reflexhandlung.
Ich werde mich nicht noch einmal zur Närrin machen. Ich bleibe lieber daheim und fahre mit meiner Geschichte fort.
Afghanistan, Mai 2011. Zehn Jahre nach dieser ersten Reise. Ich würde mich nicht an die vorderste Front begeben. Das geht heute nicht mehr, es sei denn, man ist bei den Truppen eingebettet, um Fotos durch den Filter dessen, was die Armee erlaubt, zu machen. Das wollte ich nicht noch einmal mitmachen. Mich interessieren immer schon die Dinge, die ich nicht sehen soll, die Dinge, die sie lieber verborgen halten.
Ich würde in Kabul eingesperrt sein, aber das war mir recht. Zum ersten Mal handelte ich gegen meinen journalistischen Instinkt und hielt mich von der Hauptstory fern. Hätte ich mitten im Geschehen sein wollen, wäre ich mit allen anderen nach Ägypten, Libyen oder Syrien gereist, auf der Jagd nach der Story, um die News sofort nach den Geschehnissen zu haben. Afghanistan ist ein langer Krieg, ein müder Krieg, ein langwieriger Krieg, ein Krieg, der auf dreißig Jahre andere Kriege folgt. Osama bin Laden ist weg, und der Großteil der Presse auch. Die Welt hat sich weitergedreht, auch wenn die Truppen bleiben und die Taliban zurück sind, sich in Hochburgen sammeln, stärker werden, sich neu formieren und darauf warten, dass die Ausländer abziehen.
Das mit der freien Tätigkeit hatte beim ersten Mal nicht so richtig geklappt, wie du weißt. Ich war zu unerfahren, konnte nicht wirklich mithalten. Es kostet eine Menge, aus einem Krisengebiet zu berichten, und ich erkannte bald die Vorteile einer Lebensversicherung, von Satellitenkommunikation, von Unterstützung am anderen Ende des Telefons. Also kehrte ich zu einem richtigen Job zurück, zu Anrufen des Büroleiters, zu kurzfristigen Flügen an schreckliche Orte, um Fotos von all dem Entsetzlichen zu machen, das dort geschah, und sie meinem Redakteur zu schicken in der Hoffnung, dass niemand vor mir dort gewesen war.
Nach einem Jahrzehnt hatte ich genug. Es gab diesen einen Moment im Irak, als ich Fotos von Raketen am Nachthimmel machte und mir plötzlich klar wurde, dass ich dort nicht sein wollte. Die Welt brauchte nicht noch ein Bild von einem ausgebrannten Panzer in der Wüste. Zumindest nicht von mir. Ich wollte die Art, wie ich Dinge tat, ändern, wollte Kontrolle gewinnen, wollte selbst entscheiden, wohin ich ging und was ich tat. In der Vergangenheit, vor nicht allzu langer Zeit, als Elizabeth noch lebte, zogen die Männer auf die Schlachtfelder und kämpften es aus. So sauber und ordentlich ist es nicht mehr. Der Krieg ist das kleine Kind, das sich an die Hand seiner Mutter klammert, nachdem sie mit einer Machete enthauptet wurde. Der Krieg ist der Vater, der sein totes Kind niederlegt, damit es von einem Bulldozer begraben wird, ehe sich die Krankheit ausbreitet. Der Krieg, das sind Flüchtlingslager, Hungersnot, Cholera.
Es gibt mehr in Afghanistan als den Konflikt, aber dieser Konflikt ist mit allem anderen verbunden: mit den Kriegswitwen, die vor den Restaurants der Expats betteln, den kleinen Jungs, die arbeiten müssen, statt zur Schule zu gehen, und den Heroinabhängigen, die keinen anderen Ausweg sehen. Das sind die Dinge, die ich fotografieren wollte, Dinge, die nicht in die Nachrichten gelangen, Dinge, die nicht extrem genug sind, um es in die Zeitungen zu schaffen, aber elend genug für die Menschen, die sie leben müssen. Ich war nicht sicher, was ich in Kabul vorfinden würde, aber ich wusste, dass es Geschichten zu erzählen gab.
Ich nahm ein Flugzeug nach Dubai, dann ein weiteres nach Kabul, flog stundenlang über rotgezackte Berge, Schneegipfel und Schattentäler, hartes, geheimnisvolles Terrain, das mich an die Männer denken ließ, die sich dort über Jahrzehnte immer wieder versteckt haben, um ihren Feinden ein Schnippchen zu schlagen. Als die Berge in flache, unbarmherzige Ebenen übergingen, wusste ich, dass wir es fast geschafft hatten. Bald war die staubige Erde von den geraden Linien eines braunen Gitters durchzogen, gesprenkelt mit kleinen Flecken von Grün. Als das Flugzeug tiefer ging, sah ich Häuser in den Gitterquadraten, ein jedes zusammengekauert innerhalb der Mauern seines Grundstücks. Hangars, gestrichen in der Farbe des Sandes, jede Menge Militärflugzeuge und Hubschrauber, dann die Landebahn, der entscheidende Moment des Aufsetzens.
Da wären wir wieder, dachte ich und bedeckte mein Haar mit einem Schal.
Flughäfen in Kriegsgebieten sind irreführend, an ihnen haften sozusagen die letzten Reste von Normalität, sie sind ein Niemandsland zwischen den Kampfgebieten und dem Rest der Welt, wo die richtigen Papiere noch immer die richtigen Menschen an die richtigen Orte bringen. Ein Ort, an dem es Warteschlangen gibt und Regeln, ordentliche Sitzreihen, Werbung für Coca-Cola. Sobald man jedoch nach draußen tritt, ist man mit der Realität konfrontiert. Am Kabul International Airport war die Ankunftshalle menschenleer, bis auf ein paar grimmig dreinblickende private Sicherheitsleute, die auf einreisende Botschaftsangehörige warteten. Als ich nach draußen trat, den Rucksack auf dem Rücken, die Kamerataschen vorne umgehängt, schlug mir eine Welle gnadenloser trockener Hitze entgegen. Aus Angst vor Selbstmordattentätern lassen sie keine Autos in die Nähe des Flughafens, und so war es ein langer Weg über den Parkplatz bis zu den Taxis. Ich fühlte mich auf Schritt und Tritt beobachtet. Schließlich hatte ich es geschafft. Ich fand ein Taxi, sagte dem Fahrer, wo ich hinwollte und machte es mir bequem für die Fahrt in die Stadt.
Ich war auf große Veränderungen in Kabul gefasst, aber eine Sache war geblieben: der Geruch von Scheiße. Als ich das erste Mal hinkam, hatte ich gedacht, dass die Luft in derartiger Höhe frisch sein würde, aber das war sie damals nicht und sie ist es auch jetzt nicht. Als wir den Flughafen hinter uns ließen, sah ich die Gräben voller menschlicher Ausscheidungen, die in der Sonne trockneten und nur auf den Wind warteten, der den Gestank aufnimmt und durch die Stadt wirbelt.
Es war viel mehr los als 2001 – mehr Verkehr, mehr Menschen auf den Straßen. Die Stadt breitete sich in den Hügeln aus, Anhäufungen von Lehmziegelhäusern, die aussahen, als hätte man sie an die Berghänge geklatscht, neben gesichtslosen kantigen Gebäuden, umgeben von mit Stacheldraht versehenen Mauern: die Häuser der Warlords.
Es gab immer noch viele zerbombte Wände und Stahlträger, die aus dem gesprengten Beton ragten. Kinder spielten zwischen den Ruinen der verlassenen Wohnblocks. Aber es gab auch eine Menge Neubauten. Als wir die von Schlaglöchern übersäte Straße entlangholperten, kamen wir an endlosen Gebäuden aus Glas vorbei, die riesig und glänzend aufragten.
»Hochzeitshallen«, sagte der Fahrer.
Draußen vor ihnen befanden sich eine bizarre Ansammlung von Palmen und Pyramiden und eine Nachbildung des Eiffelturms, die hoch in den Himmel ragte. Auf den Dächern der Gebäude waren Neonschriftzüge in Dari und Englisch angebracht – ausgefallene Namen wie Sham-e Paris oder Kabul Dubai. Blumengeschmückte Stretch-Limousinen glitten heran und parkten vor ihnen. Es sah mehr nach Las Vegas aus als nach Kabul.
Die Dämmerung brach herein, Vogelschwärme zogen über den Himmel. Je dunkler es wurde, desto mehr Lichter gingen auf den Hügeln an, und Holzrauch erfüllte die Luft.
Das Taxi hielt vor der Pension, die Faisal für mich im Norden der Stadt gefunden hatte. In meinem Zimmer setzte ich mein Gepäck auf dem Boden ab und sah mich um. Es war alles ziemlich standardmäßig: ein Einzelbett, ein Schreibtisch, ein wackliger Kleiderschrank, alles aus billigem Holz. Ein Plastikeimer für die Wäsche. Schmuddelige weiße Wände, ein dünner blauer Teppich. Es gab, zumindest für den Moment, Internetzugang. Ich fuhr meinen Laptop hoch und ging online.
Faisal und ich trafen uns am nächsten Tag in einer chaikhana, einem Teehaus in der Altstadt, im ersten Stock eines alten Gebäudes. Schläfrige Ventilatoren kräuselten die Luft. Wie üblich war ich die einzige Frau an einem solchen Ort, meine Fremdheit machte mich ehrenhalber zu einem Mann. Faisal stand auf dem Balkon und wartete. Er sah sehr gut aus, wohlhabend und klug.
Als er mich sah, lächelte er.
»Jo«, sagte er. »Ich freue mich so, dich zu sehen.«
Ich hätte ihn am liebsten in die Arme genommen und gedrückt, aber ich wusste, dass selbst ein Händeschütteln ihm Unbehagen bereitet hätte, also lächelte ich einfach.
»Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen, Faisal«, sagte ich.
»Geht es dir gut?«
»Mir geht es sehr gut.«
»Und deiner Familie?«
Faisal weiß, dass ich keine Familie habe. Es war seine Art zu fragen, ob ich verheiratet sei. Ich wusste nie genau, was Faisal über diesen Aspekt meines Lebens dachte. Anders als seine Schwestern war er viel zu höflich, um es zu sagen.
Wir bestellten Tee.
»Deine Kinder, Faisal, wie geht es ihnen?«
Er kramte in seiner Tasche und holte Fotos von einem Jungen und einem Mädchen hervor, etwa sechs und acht Jahre alt.
»Sie sind wunderschön.«
»Du musst sie kennenlernen, und meine Frau Sonia auch.«
»Natürlich.«
Ich dachte an Leila und Sushila, wie sie gekichert hatten, als sie mir die Nägel lackierten. »Wie geht es deinen Schwestern?«
Er zögerte, dann sagte er: »Es geht ihnen gut.«
»Ich würde sie auch gern sehen.«
»Vielleicht.«
Faisal hatte erreicht, was er angestrebt hatte – er war Arzt geworden, und ein guter dazu. Er war leitender Oberarzt in einem der Krankenhäuser in Kabul und daher zu beschäftigt, um wieder mit mir loszuziehen, also hatte ich ihn per E-Mail gefragt, ob er jemanden kenne, der mich unterstützen könne. Als ich sagte, ich würde eine Frau bevorzugen, war er anfangs etwas ratlos, aber jetzt hatte er einen Vorschlag.
»Ihr Name ist Rashida. Sie ist die Tochter eines Kollegen, der auch ein sehr guter Freund ist. Sie hat gerade ihren Abschluss in Journalismus gemacht und sucht Arbeit. Es wäre eine gute Erfahrung für sie, und ich denke, sie könnte dir nützlich sein.«
»Großartig!«
Er zögerte.
»Was?«
»Du weißt, dass sie nicht alle Dinge tun kann, die ein Mann tun kann. Ihr werdet Begleitung brauchen, wenn du bestimmte Orte aufsuchen möchtest.«
»Das ist in Ordnung«, sagte ich. »Wir können uns einen Fahrer nehmen – wir werden sowieso einen brauchen. Und den Rest kriege ich schon hin.«
»Ich weiß«, sagte er.
»Und wann kann ich sie treffen?«
»Vielleicht morgen Nachmittag? Ich werde klären, ob sie verfügbar ist. Es gibt ein Lokal namens Flower Street Café. Da gehe ich manchmal mit meinen europäischen Kollegen hin.«
»Die Flower Street kenne ich«, sagte ich und sah die Stände mit den staubigen Sträußen Plastikrosen vor mir.
»Es ist nicht direkt in der Flower Street, sondern in Qala-e Fatullah, in der Nähe deiner Pension. Sie können dir den Weg erklären. Treffen wir uns dort um drei.«
Am nächsten Nachmittag fuhr ich eine staubige, leere Straße hinunter zum Flower Street Café. In der Pension hatte man auf einem Taxi bestanden, worüber ich am Ende froh war, denn die blanken Betonwände sahen mir nicht gerade nach einem Café aus. Als wir vor einer Metalltür anhielten, saß ich einen Moment lang da und fragte mich, ob wir am richtigen Ort waren, dann entdeckte ich ein handgeschriebenes Schild.
Ich stieg aus dem Taxi und klopfte an die Tür. Ein Guckloch glitt auf und ein Wachmann schaute mich an.
»Flower Street Café?«, fragte ich.
Er grunzte und ließ mich ein. Ich betrat einen kleinen Innenhof, wo ein weiterer streng aussehender Wachmann stand, eine Kalaschnikow über die Schulter geschlungen. Er wies auf meine Tasche.
»Sie haben Waffe?«
Ich schüttelte den Kopf und öffnete die Tasche, nervös wegen meiner Kameraausrüstung, aber nach einem kurzen Check nickte er, und ich trat durch eine weitere Tür.
Ein schmaler Pfad führte zu einem Garten mit Rosen und einem Rasenstück, auf dem Tische unter heiteren roten Sonnenschirmen aufgestellt waren. Am fernen Ende befand sich ein von Weinreben umrankter Pavillon, in dem mehrere Leute saßen, die ins Gespräch vertieft waren oder an ihren Laptops arbeiteten. Faisal entdeckte ich nicht, also schlenderte ich ins Haus. Hier ging es noch geschäftiger zu als im Garten, es war voller weiterer Expats bei der Arbeit, die stirnrunzelnd auf Bildschirme blickten, Telefone neben sich, Tassen mit Kaffee in Reichweite.
Ich kehrte in den Garten zurück, suchte mir einen Tisch im Schatten und bestellte bei dem freundlichen Kellner einen Mango-Smoothie. Ein paar Minuten später erschien Faisal.
»Das ist Rashida«, sagte er. »Und das ist ihr Bruder Ahmed.«
Ahmed war offensichtlich mitgekommen, um mich unter die Lupe zu nehmen. Charme schien mir die beste Strategie.
»Hallo«, sagte ich. »Schön, euch kennenzulernen.«
Er nickte nur, aber Rashida lächelte. »Ich freue mich auch sehr, dich kennenzulernen.«
Es entstand eine Pause, während der Kellner erschien, um die Bestellungen aufzunehmen. Dann kamen wir zur Sache.
»Rashida, Faisal hat mir erzählt, dass du Arbeit suchst. Ich würde mich freuen, wenn du mir behilflich sein könntest«, sagte ich und schaute dabei sowohl Ahmed als auch sie an.
»Was genau soll sie tun?«, fragte Ahmed. »Was hoffst du fotografieren zu können?«
»Ich will mir ansehen, was der Krieg für ganz normale Menschen bedeutet.«
Er schaute skeptisch drein.
»Ich will keine ISAF-Truppen fotografieren«, fuhr ich fort. »Und ich bin nicht auf der Suche nach Taliban.«
Sowohl er als auch Rashida wirkten verwundert.
»Wirklich«, sagte ich schnell. »Ich will nur mit den Menschen reden und Fotos von ihnen machen. Faisal kann euch bestätigen, dass ich immer sehr vorsichtig bin. Ich gehe keine unnötigen Risiken ein.«
Faisal nickte. »Stimmt, das tut sie nicht.«
»Rashida, glaubst du, du könntest mir helfen? Bist du interessiert?«
Sie und ihr Bruder tauschten Blicke, dann nickte sie. »Ja, gern.«