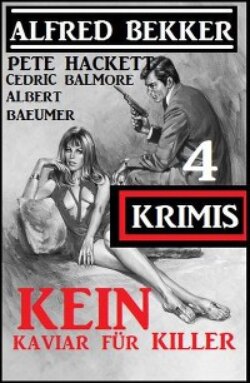Читать книгу Kein Kaviar für Killer: 4 Krimis - Cedric Balmore - Страница 38
Kapitel 1
ОглавлениеEin kühler Wind blies zwischen den Brückenpfeilern hindurch und setzte etwas in Bewegung, dessen schepperndes Echo sich unheimlich in dieser Abgeschiedenheit anhörte.
„Du müsstest den Hund mal richtig erziehen!“
„Jetzt meckerst du auch noch herum!“
„Ist doch wahr! Wenn man pfeift, müsste er kommen. Und zwar sofort!“
„Ja, ja ...“
„Habe ich nicht recht?“
„Seitdem ich dir den Hof überschrieben habe, hast du anscheinend immer recht!“
„Ach, Quatsch, was hat das denn damit zu tun!“
Jens Termeulen war ein kräftiger, breitschultriger Mann mit rötlichem Haar und vielen Sommersprossen. Er war Bauer, fünfunddreißig Jahre alt und hatte durch seine Beteiligung an der Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“ eine kurzzeitige überregionale Berühmtheit erlangt. Im Selfkant hingegen hatte er sich einen Namen als Skatspieler gemacht und früher sogar in der Birgdener Spitzenmannschaft gespielt.
Sein Vater, Rudolf Termeulen, war genau doppelt so alt wie er. Beide sahen sich sehr ähnlich, bis auf den Umstand, dass das Haar des Vaters inzwischen nur noch an ein paar Stellen rot und ansonsten schon sehr grau war.
„So’n Hund muss man richtig erziehen. Dann läuft der auch nicht weg!“, grummelte Vater Termeulen. „Aber inzwischen traut sich ja schon der Postbote nicht mehr auf den Hof, weil dieser bissige Köter ihn vertreibt!“
„Ach komm, Vater, jetzt übertreibst du aber!“
„Ist doch wahr!“
„Zwei Stunden suchen wir die Töle jetzt schon. Das hätte alles nicht sein müssen!“
„Ja, ja ...“
„Ja, wirklich!“
„Kann ich dir eigentlich noch irgendetwas recht machen?“
So vor sich hinschimpfend erreichten sie die Brücke, die über die neue B 56 n geführt wurde.
Nun war allerdings die Brücke eher fertig geworden als das betreffende Stück Bundesschnellstraße.
Jens Termeulens Blick schweifte über die weit ausgedehnten, im frühen Sonnenlicht schimmernden Felder. In der Ferne sah er weitere Brücken, die seltsam bizarr anmuteten, weil die darunterführende B 56 n noch fehlte. Diese neue Selfkant-Trasse würde mehrere, bis dahin benachbarte Dörfer voneinander trennen. Die mächtigen Planierraupen hatten tiefe Furchen durch die Landschaft gezogen, sodass die Baustelle ein wenig einer bizarren Mondlandschaft glich.
Unter der Brücke hatte sich der Hund, er hörte auf den besonders originellen Namen Rex, schon einmal verkrochen. Was zwischen den Betonpfeilern so interessant sein mochte, lag auf der Hand oder besser gesagt, es klebte am Beton, denn zurzeit war das Gebiet ein Eldorado für Hundehalter.
„Rex!“, rief Jens Termeulen im Befehlston.
Er kam sich immer lächerlich vor, wenn er streng klingen wollte. Vielleicht hörte der Hund auch deswegen nicht auf ihn. Aber irgendwie war der strenge Befehlshaber einfach keine Rolle, in der er sich wohlfühlte. „Rex!“, rief er noch einmal und nun etwas lauter.
Ein aufgeregtes Bellen war zu hören.
„Das ist er!“, meinte Jens‘ Vater überzeugt, und seiner Stimme war die Erleichterung anzumerken.
Sie fanden ihn hinter einem der Betonpfeiler. Die Sonne schien schräg unter die Brücke. Die Pfeiler warfen lange Schatten, und in eine dieser dunklen Zonen war Rex, ein reinrassiger, aber unerzogener deutscher Schäferhund, gekrochen. Irgendetwas an dem Pfeiler interessierte ihn.
Er schnüffelte, kratzte, knurrte ... Etwas Betonstaub rieselte zu Boden.
„Rex, nun komm endlich!“
Die beiden Männer gingen näher an den Hund heran. Jens versuchte ihm die Leine anzulegen, was das Tier sich erst nicht gefallen lassen wollte.
„Wirst du wohl!“
„Du, Jens ...“
„Hilf mir lieber mal, anstatt nur herumzumeckern!“
„Jens, sieh dir das mal an!“
Der erschrockene Tonfall ließ Jens hochschauen, und er erstarrte ebenso wie sein Vater. Die beiden Männer wurden bleich und fast so grau wie der Beton, aus dem die Pfeiler gegossen worden waren.
„Das gibt’s doch nicht!“, murmelte Vater Termeulen völlig fassungslos.
Jens schluckte.
„So etwas“, dachte er laut, „gibt es doch eigentlich nur in richtigen Horrorfilmen.“
„Letzte Ausfahrt Selfkant“, seufzte der etwas füllige Mann mit dem sympathisch wirkenden Gesicht. Seine gelockten Haare waren dunkelblond, der Schnauzbart ebenfalls. Die randlose Brille sorgte dafür, dass der verschmitzt wirkende Blick seiner Augen gut zur Geltung kam.
Er wirkte nicht nur verschmitzt, er hieß auch noch so.
Georg Schmitz, von seinen Freunden und Bekannten einfach nur „George“ genannt, passierte mit seinem VW Lupo die Ortsausfahrt von Geilenkirchen in Richtung Gillrath. Dabei schaltete er routinemäßig den Radiosender „100,5 DAS HITRADIO“ ein, der eine Mischung aus aktueller Musik und lokaler Berichterstattung brachte. Für George sozusagen die Konkurrenz aus dem Äther.
Der Reporter lächelte. Im Zweifel bin ich trotzdem meistens schneller als die Kollegen vom Radio, dachte er.
George war im gesamten Westzipfel des Dreiecks Aachen, Heinsberg, Geilenkirchen und darüber hinaus gewissermaßen eine Institution; ein rasender Reporter, der für die hiesigen Tageszeitungen und Wochenblätter schrieb. Er verfügte über ein hervorragendes Netz von Informanten und Zuarbeitern. Wenn irgendwo etwas Außergewöhnliches geschah, traf er nicht selten zusammen mit der Polizei, den Rettungskräften oder der Feuerwehr am Tatort ein, und man konnte sich immer wieder nur wundern, wie er die Neuigkeiten quasi mit dem Wind zu wittern schien.
„Letzte Ausfahrt Selfkant“, murmelte George noch einmal. Ihm gingen dabei viele Dinge durch den Kopf. Er dachte an „Letzte Ausfahrt Brooklyn“, einen Roman von Hubert Selby. Ihn zu lesen, dafür hatte er bisher keine Zeit gehabt. Schließlich war er Lokalreporter und nicht fürs Feuilleton zuständig. Den Film hatte er aber gesehen und die Kritiken der Kollegen vom Ressort Kultur gelesen. Ein deprimierender Film in einer bedrückenden Umgebung. Liebende Menschen in unglücklichen Zeiten, so hatte es ein Kritiker formuliert. Wer sich umbringen wollte und noch nicht den richtigen Mut gefunden oder sich in die richtige Stimmung gebracht hatte, dem war er wärmstens ans Herz zu legen.
Aber die deprimierenden Stadtlandschaften aus dem heruntergekommenen Brooklyn der Fünfzigerjahre hatten nichts mit der freundlichen Weite des Selfkants zu tun. Während die Bilder des städtischen und menschlichen Verfalls aus dem fernen Amerika mahnten, wie unerbittlich die Zeit voranschritt, so ließen einen die Burganlagen von Gangelt oder Millen eher darüber nachdenken, ob die Zeit überhaupt verging oder ob sie nicht vielleicht irgendwann im Spätmittelalter oder der frühen Neuzeit stehen geblieben war.
Ohne die Autos und den Asphalt auf den Straßen, ohne die modernen Gebäude hätte man sich in die Zeiten von Albrecht Dürer oder Gerhard Mercator zurückversetzt fühlen können, in denen die Grafen von Jülich-Berg über das Land geherrscht hatten, und die Pest im Aachener Land die Kaiserwahl von Karl V. für Monate verzögerte.
Und doch, der Selfkant und Brooklyn hatten etwas gemeinsam: eine letzte Ausfahrt.
So wie in New York die mehrspurigen Expressways Stadtviertel durchschnitten und undurchlässiger waren als manche Staatsgrenze, so durchzog die B 56 n den Selfkant. Von Heinsberg aus sollte sie sich eines Tages bis zur niederländischen Grenze ziehen und den Durchgangsverkehr durch die kleinen Ortschaften verringern. Aber noch war die Lücke zwischen der niederländischen A 2 und der A 46 bei Heinsberg nicht geschlossen. Immer wieder wurden neue Teilstücke für den Verkehr freigegeben. Insofern schob sich die „letzte Ausfahrt Selfkant“ jeden Tag ein Stück weiter in Richtung der niederländischen Grenze.
George sollte eine kleine Reportage über die Fortschritte an der sich ständig verlagernden Baustelle machen. Aber das war nicht der eigentliche Grund dafür, dass er jetzt in den Selfkant fuhr. Auf seinem Programm standen noch ein Bericht über eine Ausstellung und Vortragsveranstaltung lokal bekannter Künstler sowie die Recherche über die gestohlene Bronzegans, dem Wahrzeichen Gangelts. Und dann gab es da noch eine Fahrerflucht mit Todesfolge, die bis heute nicht richtig aufgeklärt war, bei der George noch mal nachhaken wollte. Kleinkram eben.
Nichts Spektakuläres wie im letzten Jahr, als Georg Schmitz ein paar Tage im Mercator-Hotel von Gangelt verbracht hatte, um Urlaub zu machen, und ausgerechnet in dieser Zeit ein brutaler Mörder in dem kleinen, mittelalterlich geprägten Ort sein Unwesen getrieben hatte. Aus dem Urlaub war daraufhin natürlich nicht mehr viel geworden. So ein außergewöhnliches Ereignis verlangte danach, dass George seine besonderen Reporter-Antennen ausfuhr, eine Art siebter Sinn für Neuigkeiten und Hintergründe, der ihn zielsicher auf die richtige Spur brachte.
Auch jetzt hatte er vor, einige Tage im Mercator-Hotel zu verbringen. Allerdings nicht, weil er Urlaub machen wollte, sondern weil seine Wohnung in Geilenkirchen derzeit renoviert wurde und in einem, gelinde gesagt, unbewohnbaren Zustand war. Neue Tapeten, ein neuer Anstrich und ein neuer Lebensabschnitt. Das fiel für Georg Schmitz zusammen, denn er hatte sich von seiner Frau getrennt.
Es war eine Trennung im guten Einvernehmen, aber eben doch eine Zäsur in seinem Leben, obwohl seine Frau behauptet hatte, dass sich für George eigentlich nichts änderte.
Schließlich hatten sie auch vor der Trennung schon kaum noch Zeit miteinander verbracht. Das war die Schattenseite des Jobs, der für Georg Schmitz weit mehr als ein Beruf war, nämlich eine Berufung.
Diesmal, so hatte sich der Reporter vorgenommen, würde er die zahlreichen Wellness-Einrichtungen des Mercator-Hotels allesamt ausnutzen, so wie es sich gehörte, wenn man schon einmal dort logierte.
Es war Anfang August, die Sonne schien durch sein Autofenster, und er hatte richtig gute Laune. In Gedanken sah er sich schon am Rodebach entlangradeln, die Natur genießen, mit Einheimischen plaudern ...
Immerhin hatte George ja dafür gesorgt, dass er nur ein überschaubares Quantum an Arbeit zu verrichten hatte.
Andererseits wusste er natürlich auch, dass sich dieses Quantum urplötzlich und sehr drastisch erhöhen konnte, wenn sich irgendwo etwas ereignete, das Schlagzeilenpotenzial besaß.
Die Musik im Radio verklang.
„Liebe Hörerinnen und Hörer, zu Gast im Studio an diesem schönen Freitagmorgen ist der Heimatforscher und Spezialist für die Geschichte Gangelts - Dr. Martin Achten. Wir sprachen gerade schon davon, dass der große Kartograph Gerhard Mercator in Gangelt aufgewachsen ist und kommen nun zu Albrecht Dürer, dem bekannten Maler und Kupferstecher, dessen Signatur weltbekannt sein dürfte. Ich spreche von dem großen „A“, unter welches ein kleines „D“ gestellt ist. Dr. Achten, ein Markenzeichen im späten Mittelalter?“
„Ja, so könnte man das durchaus sehen“, bestätigte die Stimme von Dr. Achten, die George sofort wiedererkannte.
Dr. Achten war ihm natürlich ein Begriff. Er hatte ihn bei seinem letzten Mordfall näher kennengelernt und schätzte seinen großen Sachverstand in geschichtlichen Angelegenheiten.
„Dr. Achten, nun sagten Sie mir im Vorgespräch, dass Albrecht Dürer auch durch Gangelt gereist sei und möglicherweise sogar ein Bild dort gemalt habe. Ist das richtig?“
„Es gibt tatsächlich Quellen, die darauf hindeuten. So sind die Tagebücher Albrecht Dürers über seine letzte Reise fast vollständig erhalten, und darin hat er unter anderem den Verlauf seiner Reise nach Antwerpen dokumentiert. Genauer gesagt, war er schon auf dem Rückweg nach Nürnberg ...“
„Sind denn irgendwelche Motive aus Gangelt oder dem Selfkant in den Gemälden Dürers zu erkennen? Irgendetwas, das vielleicht aus den Eindrücken dieser Landschaft in sein Werk eingeflossen ist, ohne dass wir etwas davon ahnen?“
„Wir müssen leider davon ausgehen, dass viele Werke der Künstler zu Dürers Zeit gar nicht erhalten sind.“
„Das ist natürlich bedauerlich.“
„Sehen Sie, jemand wie Albrecht Dürer hat oft ganz spontan seine Malsachen ausgepackt und etwas auf die Leinwand gebracht. Mitunter hat er sich durch das Malen von Bildern sogar die Reisekosten finanziert. Und daher gibt es eigentlich keinen Grund für die Annahme, dass er nun ausgerechnet hier im Selfkant nicht gemalt haben sollte ...“
„Und bevor wir jetzt zum nächsten Musiktitel kommen, hätte ich noch die Frage, was der große Künstler denn eigentlich hier in der Gegend zu tun hatte?“
„Nun, Dürer bezog eine Leibrente von jährlich 100 Gulden durch Kaiser Maximilian I. Nach dessen Tod musste er sich diese Rente von seinem neuen Herrn Karl V., dem Enkel Maximilians, bestätigen lassen. Im Sommer 1520 verließ er Nürnberg, um durch persönliche Vorsprache seine Angelegenheit zu regeln. In Begleitung seiner Frau und einer Magd fuhr er ab Bamberg mit dem Schiff main- und rheinabwärts bis Köln und zog dann über Land bis nach Antwerpen, wo er sein Standquartier nahm. Dort verfolgte er auch den feierlichen Einzug Karls V., dem er dann bis nach Aachen nachreiste, um seine Krönung zum König zu erleben. Im November erhielt er in Köln endlich das Jahrgeld erneut verbrieft. Bei diesen Reisen muss er durch Gangelt gekommen sein, denn das war zur damaligen Zeit die übliche Reiseroute von Antwerpen nach Aachen oder Köln.“
„Sehr interessant. Wir kommen nach dem nächsten Hit noch einmal auf den Verlauf dieser Reise zurück und werden auch etwas aus dem Tagebuch vorlesen“, versprach der Moderator.
Bevor die Musik einsetzte, folgte noch ein Hinweis eines aufmerksamen Hörers, der eine mobile Laserpistole am Ortsausgang von Birgden in Richtung Kreuzrath entdeckt und gemeldet hatte.
Da George in eine andere Richtung fuhr und schon von weitem den Gangelter Kirchturm ausmachen konnte, hörte er diesem Warnhinweis nur mit halbem Ohr zu. Kurz vor dem Kreisverkehr in Gangelt klingelte plötzlich sein Handy. Und zwei Minuten später war ihm klar, dass er nicht auf dem direkten Weg zum Mercator-Hotel nach Gangelt fahren würde.
Es war etwas passiert, das seine Anwesenheit und Aufmerksamkeit erforderte.
Letzte Ausfahrt Selfkant ...
Es gab jemanden, für den das zur bitteren und sehr endgültigen Wahrheit geworden war.
Jemanden, für den diese Ausfahrt direkt in die Hölle geführt hatte ...
Eine Reihe von Einsatzfahrzeugen parkte am Ende der Baustelle zur neuen B 56 n in der Nähe einer Brücke. George schoss ein paar Bilder mit seiner Kamera. Je mehr Bildmaterial zur Verfügung stand, desto besser. Die Redaktion konnte dann aussuchen.
Mit mehreren uniformierten Polizisten war er bestens bekannt. Da war unter anderem der erste Polizeihauptkommissar Burkhard Biewendt. Er war im gleichen Alter wie George, kam auch aus Geilenkirchen und war wohl zur Unterstützung der hiesigen Kräfte hierher beordert worden.
„Unser Katastrophen-George“, stöhnte Biewendt, ehe er lächelnd fortfuhr: „Ich nehme an, Sie wissen schon, was passiert ist.“
„Ja, zumindest in groben Zügen“, gab der Reporter zu.
„Manchmal könnte man meinen, Sie könnten hellsehen.“
„Leider nicht.“
„Dann hören Sie den Polizeifunk ab ...“
„Es hat mich jemand angerufen.“
„Sie verraten mir nicht zufällig, wer?“
„Aber Herr Biewendt, ich kann doch einen Informanten nicht verraten. Der sagt mir doch sonst nie wieder etwas!“
„Ihr Informant könnte für uns aber ein wichtiger Zeuge sein.“
George schüttelte den Kopf. Er sah in einiger Entfernung die beiden Termeulens im Gespräch mit Kriminalhauptkommissar Krichel von der Kripo aus Heinsberg. „Ich denke, der Informant wurde bereits vernommen“, meinte er.
Biewendt wandte den Kopf in seine Blickrichtung und nickte: „Verstehe!“
George wollte weitergehen, aber der Kommissar hatte ihm offenbar noch etwas zu sagen und hielt ihn am Arm zurück. Eigentlich war er für seine humorvolle Art bekannt. Aber das, was hier geschehen war, hatte ihm offenbar den Humor erst einmal ausgetrieben. Seine Züge wirkten ungewohnt angespannt und ernst.
„Ich kann Sie nur warnen! Was Sie da sehen werden, das vergessen Sie nicht so schnell!“
Während sich George den Brückenpfeilern langsam näherte, machte er weiter eifrig Fotos. Er erreichte Franz-Josef Krichel, den Leiter des Kriminalkommissariats 21 in Heinsberg.
Dieser überragte den Reporter um einen halben Kopf und hatte etwa dieselbe Größe wie Jens Termeulen, mit dem er sich gerade unterhielt. George hatte einmal über ein bundesweites Skatturnier berichtet, das in Geilenkirchen stattgefunden hatte und bei dem der erste Preis an niemand anderen als an eben diesen Jens Termeulen gegangen war, den Kartenkönig von Birgden, wie ihn manche mit einer Mischung aus Spott und heimlicher Bewunderung nannten.
Seitdem versorgte Jens Termeulen George mit Informationen, wenn sich in seiner Umgebung irgendetwas zutrug, von dem er glaubte, dass die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden sollte.
Er war damit Teil des feinen Informationsnetzes von Georg „George“ Schmitz, das die gesamte Region überspannte und den Reporter ständig mit Informationen versorgte.
Jens Termeulen hatte George mit dem Handy angerufen. Jetzt wechselte er einen kurzen Blick mit dem Reporter.
Dann streckte er die Hand aus und deutete auf einen der Brückenpfeiler. „Da ist es!“, sagte Termeulen nur.
George schaute in die angegebene Richtung, aber ein Beamter, der wohl nach Spuren suchte, versperrte ihm zunächst die Sicht. Dann aber sah er, was Termeulen ihm zeigen wollte.
Es durchfuhr ihn ein Gefühl, als ob sich ihm eine eiskalte Hand auf die Schulter legte.
Er musste unwillkürlich schlucken.
Im ersten Moment glaubte er, seinen Augen nicht zu trauen, aber aus dem Beton ragte - ein Zeigefinger.
Der Finger war lang und dick. Ein Männerfinger, dachte George, nachdem er den ersten Schreck überwunden hatte. Obwohl es natürlich auch Männer mit zierlichen Fingern gab.
George und alle Umstehenden waren der Auffassung, dass nicht nur ein Körperteil, sondern auch der dazugehörige Torso sich in dem mächtigen Brückenpfeiler befand.
„Tja, es wird nicht ganz einfach sein, herauszufinden, wer das Opfer ist“, sagte Krichel. „Das ist selbstverständlich ein Fall, den die Kollegen aus Aachen an sich ziehen werden. Die haben auch die nötigen Laborkapazitäten dafür.“
„Denken Sie auch, dass das ein Mann war?“
„Also nach meinem persönlichen Pi-mal-Daumen-Maß würde ich sagen: Ja, es ist ein Mann. Aber schreiben Sie das bitte erst, wenn der Gerichtsmediziner da war.“
„Natürlich.“
„Sonst ist am Ende irgendeine Falschinformation im Umlauf, die uns bei der Fahndung nur das Leben schwer macht.“
„Ist schon klar.“
„Sehen Sie, wo der Finger hinzeigt?“
George folgte der Richtung, die der Finger anzuzeigen schien. Er deutete auf einen benachbarten Pfeiler, an dem zwei Buchstaben im Graffiti-Stil prangten.
„A“ und „D“.
Sie waren genauso angeordnet wie im Kürzel von Albrecht Dürer.
„Herr Krichel, was meinen Sie? Kann das ein Zufall sein?“, fragte George.
„Das werden wir noch sehen. Wir wissen, wann die Brückenpfeiler gegossen wurden. Das Opfer muss zuvor in die Verschalung geworfen worden sein. Dass der Finger so herausragt, kann dabei kaum arrangiert worden sein.“
„Sie glauben wirklich, dass das nichts miteinander zu tun hat?“
„Der Sprayer könnte ein wichtiger Zeuge sein, und darum suchen wir ihn auch.“
In letzter Zeit hatte es wieder Sprayer gegeben, die die frisch gegossenen Brückenpfeiler für ihre speziellen Signaturen benutzten, ihre Takes.
Derzeit hing in jedem zweiten Geschäft in Geilenkirchen ein Plakat, das 500 Euro Belohnung für denjenigen auslobte, der Hinweise auf Graffiti-Sprayer lieferte. Zusammen mit zerkratzten Schaufenstern und anderen Formen des Vandalismus wurden hohe Instandsetzungskosten verursacht. Einen der Täter hatte man in der letzten Woche festgenommen, aber in der Regel waren sie nicht feststellbar.
George hatte wiederholt darüber berichtet.
Er fragte sich, ob diese Welle vielleicht gerade dabei war, nach Gangelt zu schwappen. Vielleicht war in diesem Fall auch einfach nur der freie Beton eine zu große Versuchung für Sprayer.
Aber zusammen mit der Leiche wirkte das Graffito schon fast wie eine bewusste Anordnung.
Eine bizarre, makabre Form der Kunstinstallation.
Das „AD“ war einerseits auf dieselbe Weise arrangiert wie Albrecht Dürer das seinerzeit getan hatte, aber andererseits waren die Buchstaben auch in einem höchst individuellen Sprayer-Stil gehalten. Sie wirkten dreidimensional, und die Farben schienen sehr bewusst platziert zu sein. Gelb, Blau und Rot wechselten einander ab.
„Ich wundere mich, dass der Finger zuvor nicht aufgefallen ist“, meinte George nachdenklich und blickte sich dabei suchend um. „Ich meine, die Verschalung muss doch irgendwann abgenommen worden sein.“
„Die beteiligten Bauarbeiter werden wir natürlich allesamt verhören“, versprach Krichel. „Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dabei viel herauskommt.“
„Wieso nicht?“
Nun mischte sich der alte Termeulen ein, der sich mit dem immer noch aufgeregt winselnden Hund bis jetzt abseits gehalten hatte. „Sie haben nie auf dem Bau gearbeitet, was?“, wandte er sich an George. „Also, ich schon. Vor ein paar Jahren lief unser Hof nicht so gut, nachdem wir die Maul- und Klauenseuche gehabt hatten. Sie erinnern sich ...“
Natürlich erinnerte sich Schmitz.
Er hatte zu diesem Thema seinerzeit schließlich ein gutes Dutzend oder mehr Artikel geschrieben und dafür im gesamten Selfkant recherchiert.
Der alte Termeulen fuhr fort: „Jedenfalls habe ich da eine Weile auf dem Bau gearbeitet. Streng genommen war das Schwarzarbeit, aber das dürfte längst verjährt sein, und der Herr Krichel ist ja auch nicht von der Agentur für Arbeit, oder? Jedenfalls kann ich mir gut vorstellen, dass der Finger völlig übersehen wurde, zumal er wohl auch vollkommen mit einer Schicht Beton bedeckt und vielleicht gar nicht zu sehen war.“
„Erst unser Rex hat daran herumgekaut“, ergänzte sein Sohn und tätschelte Rex den Hals, was diesem allerdings gar nicht gefiel. Das Tier zog dauernd an seiner Leine und hechelte herum. Rex erwürgte sich dabei mit dem Halsband beinahe selbst - zumindest konnte man den Eindruck gewinnen.
George warf einen Blick auf das „AD“-Take des Sprayers und meinte: „Da war wohl ein später geistiger Ahne des Malers Albrecht Dürer am Werk ...“
„Ich würde eher sagen, ein Schmierfink“, sagte der alte Termeulen. „Aber dazu laden diese Betonpfeiler ja auch geradezu ein.“
George wandte sich noch mal an die beiden Termeulens.
„Sie haben nicht zufällig eine Ahnung, wer dahinterstecken könnte, oder?“
„Nein“, meinte der alte Termeulen.
Und sein Sohn ergänzte: „Dann hätte mein Vater den schon längst angezeigt!“
George blieb noch eine ganze Weile am Tatort, aber ihm war schnell klar, dass es sehr kompliziert sein würde, die Leiche zu bergen. Die Polizei war genauso ratlos wie der Gerichtsmediziner, der später eingetroffen war.
Irgendwo schnappte George den Satz auf, dass wahrscheinlich die Kollegen der Kriminalpolizei aus Aachen den Fall übernehmen würden. Aber das schien noch nicht ganz klar zu sein.
Mitarbeiter der Baufirma, die die Brücke gebaut hatten, tauchten ebenfalls auf. Es wurden verschiedene Vorgehensweisen erwogen, um den Toten aus seinem Betongrab zu befreien. Dabei kam es natürlich darauf an, dass der Leichnam am Ende noch identifizierbar war, was wohl in jedem Fall schwer genug sein würde.
Aber die Identifizierung des Opfers war der wichtigste Ansatzpunkt bei der Überführung des Täters.
„Meinen Sie denn, dass Sie den Täter kriegen?“, fragte Vater Termeulen an Kommissar Krichel gerichtet.
Diesen zeichnete eine bemerkenswerte Ruhe auch im Umgang mit teilweise recht lästigen Fragern aus. George war das schon bei früheren Gelegenheiten aufgefallen.
„Zunächst mal wissen wir gar nicht, ob es überhaupt einen Täter gibt“, sagte Krichel ruhig. „Das sind bisher alles nur Vermutungen. Es besteht schließlich auch die Möglichkeit, dass es sich um einen Unfall handelt. Das können wir mit Sicherheit erst sagen, wenn wir die Leiche geborgen haben.“
Der ältere Termeulen runzelte die Stirn. „Sie wollen doch wohl nicht behaupten, dass sich jemand selbst in diese äußerst missliche Lage gebracht hat?“
„Es wäre möglich, dass vor der Füllung der Verschalung jemand hinabgestürzt und dabei zu Tode gekommen ist“, erläuterte Krichel. Dann deutete er auf die Takes des Sprayers. „Sie sehen ja an den Werken dieses Künstlers da vorn, dass sich hier mitunter alle möglichen Gestalten herumtreiben.“
Jetzt wandte sich George an die Termeulens. „Interessant wäre allerdings zu erfahren, weshalb Sie sich denn so sicher sind, dass dies nur ein Mord und kein Unglücksfall gewesen sein kann!“, hakte der erfahrene Reporter nach.
Vater Termeulen wollte etwas dazu sagen, aber sein Sohn stieß ihn an und hielt ihn davon ab. „Komm, hör auf, du blamierst dich hier nur“, raunte Jens.
Danach ließ der ältere Herr sich auch durch Georges gutes Zureden nicht mehr dazu bringen, einen erneuten Anlauf in seiner Erzählung zu nehmen.
George sah sich noch ein bisschen um.
Einer der Bauleiter stand ein Stück abseits und telefonierte. Er wirkte ziemlich nervös. George näherte sich ihm gerade so weit, dass es nicht aufdringlich wirkte. In dem Gespräch ging es offenbar darum, wie man jetzt den Toten aus dem Betonpfeiler herausbekommen konnte und wer die dazu notwendigen Maßnahmen am Ende bezahlen würde.
Denn eins stand fest: Die Bergung würde teuer werden, ganz gleich, wie man das anstellen wollte. Erstens musste das auf eine Weise geschehen, die die Stabilität des Pfeilers möglichst nicht in Mitleidenschaft zog, und zweitens musste man so vorsichtig vorgehen, dass man die Leiche nicht vollkommen zerstörte und am Ende die Todesursache gar nicht mehr feststellbar war.
„Ja, kann ich vielleicht etwas dafür?“, hörte George den Mann nun aufgebracht sagen. „Wir können ja eigentlich nur darauf hoffen, dass es ein Mord war, denn wenn sich herausstellt, dass sich da jemand zu Tode gestürzt hat oder ein Unfall geschehen ist, dann kriegen wir garantiert Schwierigkeiten mit der Versicherung, darauf können Sie wetten! Ja, ich weiß ... Sag ich doch! Und am Ende erwarten die dann, dass man alle zehn Zentimeter ein Warnschild aufstellt und wir haben den Schwarzen Peter ...“
George hätte eigentlich gerne noch länger zugehört, denn der Mann hatte sich jetzt richtig in Rage geredet und den Reporter auf der anderen Seite noch nicht bemerkt. Aber jetzt kam jemand auf sie zu, der nicht zu übersehen war.
Ein Mann Ende dreißig bis Anfang vierzig. Er trug ein Cord-Jackett, das etwas zu eng war, und so blitzte das Holster mit der Dienstwaffe darunter hervor.
Kevin Clausen von der Kripo Aachen! George stöhnte innerlich.
Mordfälle gingen normalerweise an Clausen und seine Mitarbeiter, zumindest dann, wenn es sich um kompliziertere Fälle mit erhöhtem Ermittlungsaufwand handelte.
Unter Umständen wurde dann auch eine Sonderkommission eingerichtet.
Clausen hatte George schon erkannt.
Er blieb abrupt etwa drei Schritte von dem Reporter entfernt stehen. Der Sand war hier recht tief und weich. Clausen sank fast bis zu den Knöcheln ein.
„Na, wie geht’s, Herr Schmitz?“, fragte Clausen, nicht eben freundlich.
„Viel Arbeit, wenig Zeit - wie immer!“
„Und mal wieder als Erster am Ort des Geschehens.“
„Tja, so bin ich eben.“
„Da kann man sich schon fast fragen, ob Sie immer vor Ort sind, wenn etwas passiert oder immer etwas passiert, wenn Sie auftauchen!“
„Natürlich Letzteres“, gab Schmitz freundlich zurück und dachte verwundert: Es geschehen noch Zeichen und Wunder! Kommissar Clausen hat Humor!
Normalerweise war Clausen eher für seine knurrige, launenhafte Art bekannt, und dementsprechend unbeliebt war er auch bei manchen seiner Kollegen.
„Und jetzt, wo ich komme, verlassen Sie uns schon?“, fragte Clausen scheinheilig in einem bedauernden Tonfall.
„Wollen Sie mit auf das Bild?“, fragte George. „Dann stellen Sie sich vor die Brücke und ich drücke ab.“
„Na ja, meinetwegen!“
Da war er wieder, der knurrige Unterton, den George ebenfalls von Clausen kannte. Nur etwas weicher und weniger scharf, als es der Reporter schon erlebt hatte. „Ich kann natürlich nicht dafür garantieren, dass die Zeitung Ihr Foto auch druckt. Das wählt die Redaktion aus“, fügte Schmitz noch hinzu.
„Verstehe ...“
Da hatte er ihn wohl an der richtigen Stelle gepackt, dachte George. Einmal als Held der Region im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu stehen, davon träumten viele. Und wenn man ihnen diesen Wunsch erfüllte - soweit das möglich war und journalistische Grundsätze nicht dagegensprachen - dann wurden einige Mitmenschen oft auch gesprächiger und kooperativer.
Das galt vielleicht sogar für Kommissar Clausen.
„Wäre natürlich schön, wenn ich dazu auch noch ein Statement von Ihnen bringen könnte, Herr Clausen“, ließ George dann die Katze aus dem Sack.
„Sie sind gut, ich habe den Tatort noch nicht mal erreicht und soll schon eine Stellungnahme abgeben! Typisch Presse!“
„Dachte ich mir schon, dass das etwas zu früh ist, aber das können wir später nachholen.“ Er reichte Clausen seine Karte. „Hier ist meine Nummer. Ich bin rund um die Uhr erreichbar. So, ich bin nur kurz weg und komme später noch mal wieder hierher zurück.“
„Hm“, meinte Clausen brummig.
„Also bis dann ...“
George ging davon aus, dass es ein paar Stunden dauern würde, bis sich an der Brücke wieder irgendetwas Interessantes ergab.
In der Zwischenzeit konnte er also in aller Ruhe nach Gangelt fahren, im Hotel Mercator einchecken, einen Kaffee trinken, vielleicht etwas vom Kuchenbüfett probieren und dabei auf seinem Laptop einen ersten, kurzen Artikel schreiben.
Vielleicht hundert Zeilen, nicht mehr. Für die würde man in den Blättern schon noch Platz machen, wenn es um etwas so Spektakuläres wie eine Leiche im Brückenpfeiler ging. Da mussten Ereignisse wie das Treffen des heimischen Kaninchenzüchtervereins oder ein Garagenflohmarkt in Waldfeucht vielleicht um eine Ausgabe verschoben werden.
Aber das war ja zum Glück nicht Georges Sorge.
Dafür war die jeweilige Redaktion zuständig, und der Reporter war froh, mit derlei Entscheidungen nichts zu tun zu haben.
George erreichte das Mercator-Hotel, das in den zwölf Monaten seit seiner Fertigstellung bereits zu einer festen Größe in der heimischen Tourismusbranche geworden war und sich bestens etabliert hatte. Erst vor wenigen Wochen hatte es vier Sterne vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband verliehen bekommen.
George stieg aus seinem Lupo und hatte gerade den Kofferraum geöffnet, als ein Wagen hielt. George nahm ihn nur kurz aus den Augenwinkeln heraus wahr. Es war ein silberfarbener Opel. Dann drehte sich der Reporter herum. Wollte da jemand etwas von ihm, oder hatte er seinen Lupo vielleicht auf einem Parkplatz abgestellt, an dem schon irgendjemand anders ältere, vererbte Rechte hatte?
George erinnerte sich daran, mal über eine Schlägerei berichtet zu haben, an der insgesamt zehn Personen teilgenommen hatten. Ausgangspunkt war deren Parkplatz gewesen. Bei so etwas verstanden viele Leute einfach keinen Spaß. Mochten andere sich für ihren Glauben, eine politische Idee oder das Vaterland schlagen, bei manchen tat es eben auch der ganz profane Parkplatz.
George kniff die Augen zusammen.
Die Scheiben des Opel reflektierten das Licht, so konnte er zuerst nicht sehen, wer am Steuer des Wagens saß.
Er dachte kurz darüber nach, wer von all den Leuten, die er in Gangelt mehr oder weniger flüchtig kannte, einen silberfarbenen Opel Meriva fuhr. Sich zu den Menschen auch die richtigen Wagen zu merken, war für jemanden wie ihn sehr wichtig. Oft genug wurde er während der Fahrt von anderen gegrüßt. Manchmal durch Zuwinken, in anderen Fällen durch die Lichthupe. Wenn man dann gerade in Gedanken war oder über die Sprechanlage ein Telefonat führte, war es gar nicht so einfach, rechtzeitig zu erkennen, dass da ein Bekannter an einem vorbeifuhr.
Und wenn man nicht grüßte, hieß es schnell: Der Schmitz ist arrogant. Der grüßt nicht.
„Hallo, Herr Schmitz, gut, dass ich Sie treffe!“, rief eine Frauenstimme, die versuchte, das Motorengeräusch des Opel Meriva zu übertönen, was ihr aber nicht sonderlich gut gelang. Endlich stellte sie den Motor ab.
Die Frau beugte sich über den Beifahrersitz zum Fenster und nun konnte George sie sehen.
Sie war Anfang vierzig, sportlich, hatte mittelblondes Haar und ein charmantes, gewinnendes Lächeln auf den Lippen.
„Hallo“, sagte George.
Er war sich ziemlich sicher, dieses Gesicht schon mal gesehen und sogar fotografiert zu haben, nur konnte er sich auf die Schnelle nicht daran erinnern, wo und zu welchem Anlass das gewesen war.
„Sie wissen doch noch, wer ich bin?“
„Na ja ...“
„Liesel Hagen.“
Jetzt machte es bei George klick. Liesel Hagen war Besitzerin einer Galerie, über die ab und an mal in den lokalen Medien berichtet wurde. Sie gab Malkurse, in denen Sie den Umgang mit Aquarelltechniken und Acrylfarben näherbrachte. George erinnerte sich daran, dass sie ihm bei dieser Gelegenheit eingehend die Vor- und Nachteile der jeweiligen Technik und die besonderen Gestaltungsmöglichkeiten erläutert hatte, die sich daraus ergaben.
„Sie könnten mal wieder was über meine Galerie bringen.“
„Natürlich. Aber ...“
„Aber deswegen spreche ich Sie jetzt nicht an, Herr Schmitz.“
„Weswegen dann?“
Sie blickte auf seinen Koffer und meinte: „Ich hoffe, Sie machen nicht gerade Urlaub.“
„Nun, um ehrlich zu sein ...“
Die Antwort hätte eigentlich „Ja“ lauten müssen, aber das war vor dem Toten im Betonpfeiler gewesen. George sah das ganz realistisch. Der Urlaub war gestrichen und würde sich in einen Arbeitsaufenthalt verwandeln.
Eigentlich hatte es das MercatorHotel mit seinen ganzen Extras nicht verdient, nur als Schlafstätte genutzt zu werden, und insgeheim hatte George ja auch die Hoffnung, vielleicht doch noch die eine oder andere Gelegenheit zu finden, um sich zu erholen.
Aber ein anderer Teil von ihm wusste genau, dass das nichts weiter als eine schöne Illusion war. So war er nun mal.
Er würde nicht eher Ruhe finden, bis die Sache mit dem Finger, der aus dem Beton ragte, restlos geklärt war. Unfall, Mord oder Selbstmord, das würde bis dahin einwandfrei feststehen. Offene Fragen hasste George. Und so tat er stets das Seine, um ihre Anzahl nach Möglichkeit zu verringern. Aber das war oft wie mit den Köpfen des Zerberus-Ungeheuers, die in doppelter Anzahl nachwuchsen, wenn einer von ihnen abgeschlagen wurde. Eine beantwortete Frage ergab meist zwei neue.
„Es geht heute Abend um die Versammlung der hiesigen Künstler aus der Region Selfkant. Wir treffen uns im Haus Hamacher, und ich habe auch versucht, die heimische Presse auf Trab zu bringen, aber irgendwie hat da keiner angebissen. Und wenn Sie jetzt schon mal vor Ort sind ...“
„Mal sehen“, sagte George. „Ich bin nämlich wirklich der Erholung wegen hier, ob Sie es nun glauben oder nicht.“
Sie verschränkte die Arme vor der Brust und legte den Kopf etwas schief. Die Art und Weise, in der sie ihn ansah, schien zu sagen: Das glaubt dir sowieso niemand, George! Aber selbstverständlich enthielt sie sich jeden Kommentars in diese Richtung.
„Wir haben in letzter Minute die Zusage für einen Vortrag über Albrecht Dürers Wirken im Selfkant erhalten.“
„Oh ...“
Vage kam George der Radiobeitrag wieder ins Gedächtnis.
„Der Referent heißt Franz Serken und kommt aus Vaals.“
„Ist er Holländer?“
„Nein, er ist Deutscher, aber er lebt dort drüben. Hat einen Hof gekauft, der ihm als Atelier dient. Er malt selbst und ist durch private Studien wohl zu einer Art Dürer-Experte geworden, obwohl er keinen akademischen Grad hat. Und seitdem nun dieses Bild hier aufgetaucht ist ...“
George runzelte die Stirn.
„Welches Bild?“, fragte er.
Sie lächelte. „Ach, dann gibt es tatsächlich noch Dinge, die Sie nicht mitbekommen haben?“
George erwiderte ihr Lächeln. „Noch nicht mitbekommen“, korrigierte er.
Liesel Hagen atmete tief durch. „Wie auch immer. Die Sache ist ganz frisch, und wenn ich das eher gewusst hätte, wären Ihre Pressekollegen sicher auch darauf eingestiegen.“
„Was für ein Bild, Frau Hagen?“, fragte George noch einmal interessiert nach.
„Ein Bild, das - wahrscheinlich und unter allem gebotenen Vorbehalt natürlich - Albrecht Dürer hier in Gangelt gemalt hat!“
George hob die Augenbrauen. „Das klingt interessant. Ich habe auf dem Weg hierher einen Bericht darüber im Radio gehört.“
„Über unsere Veranstaltung? Wohl kaum ...“ Die Galeristin seufzte. „Schön wär’s! Aber das kann nicht sein.“
„Nein, nein, nicht über Ihre Veranstaltung, sondern darüber, dass Dürer mal hier in Gangelt gewesen sein soll.“
Die Galeristin lächelte. „Ja, wenn man es so recht bedenkt, dann scheint sich hier zu Beginn der frühen Neuzeit eine regelrechte Versammlung von Persönlichkeiten mit Rang und Namen eingefunden zu haben. Der berühmte Mercator, an den ja der Mercator-Stein erinnert, Albrecht Dürer und ich wette, da gibt es noch den einen oder anderen, wenn man noch etwas in den Archiven stöbert ...“
George verstand den spöttischen Unterton, der in den Worten der Galeristin mitschwang. Ja, ja, Mercator, dachte George, der große Kartenzeichner des sechzehnten Jahrhunderts, der den Schnittpunkt vom 51. Breitengrad und 6. Längengrad so legte und damit seiner Heimat ein ewiges Denkmal setzte, indem die Lage Gangelts nun auf jedem Globus und jeder Weltkarte erkennbar war - ganz gleich, wie der Maßstab auch gewählt sein mochte. Dieser Schnittpunkt war immer zu sehen.
Um diesen Mercator-Stein hatte sich nämlich im letzten Jahr eine bizarre Mordgeschichte gerankt, die der Reporter aufzuklären geholfen hatte.
George dachte an das „AD“-Zeichen des Sprayers, auf das der aus dem Brückenpfeiler herausragende Zeigefinger deutete. Zufall oder grausige Inszenierung, das war hier die Frage. Auf jeden Fall konnte es nicht schaden, etwas mehr über Albrecht Dürer und seinen Aufenthalt im Selfkant zu erfahren.
„Wann beginnt denn Ihr Vortrag?“, fragte George nun doch sehr interessiert.
„Heute Abend, acht Uhr.“
„Ich kann Ihnen nichts versprechen. Sie wissen ja, wie das so ist.“
„Der rasende Reporter ohne Zeit.“
„Sie sagen es! Aber wenn es sich einrichten lässt, komme ich hin.“
„Die Künstler-Szene des Selfkants wird Ihnen ewig dankbar sein, Herr Schmitz!“
„Nun übertreiben Sie mal nicht.“
„Doch, ganz bestimmt!“
Ehe George noch etwas hinzufügen konnte, betätigte ein ungeduldiger Ford-Fahrer die Lichthupe und zeigte einen Vogel. Die Galeristin beeilte sich, wieder ans Steuer ihres Wagens zu kommen, denn auf sie waren Lichthupe und die wenig freundliche Geste gemünzt. „Ich muss jetzt wieder, Herr Schmitz!“, rief sie, während sie auf die andere Seite ihres Autos eilte. „Mein Wagen steht im Weg!“
Sie stieg ein, startete und fuhr weiter.
Der wartende Fahrer des Ford verdrehte die Augen.
Das war also das nächste Kapitel in der unendlichen Fortsetzungsserie Autofahrer ohne Raum - der Kampf um den Parkplatz, ging es George durch den Kopf.
Eine humorvolle Glosse dazu lag ihm gleichsam in der Feder oder besser gesagt in den Tasten.
Er sah noch kurz auf das Autokennzeichen des Ford.
„D“ wie Düsseldorf.
Na, Gott sei Dank, dachte George, sonst müsste man sich als Selfkanter Lokalpatriot ja noch schämen!
Kopfschüttelnd ging George ins Hotel und checkte ein. Er brachte seine Sachen in sein Zimmer auf die 1. Etage, packte das Nötigste aus aus seinem Koffer aus und hängte vor allem seine Hemden in den Schrank, damit er nicht in den nächsten Tagen als wandelndes Faltenrelief herumlaufen musste.
Dann nahm er seine Tasche mit dem Laptop und die Kamera an sich und verließ das Zimmer.
Auf der schön angelegten Terrasse suchte er sich unter einem Sonnenschirm einen guten Platz und begann, seinen Artikel zu schreiben. Dazu bestellte er sich eine Tasse Kaffee. Der Kuchen wäre zwar auch eine Versuchung wert gewesen, aber George verzichtete schweren Herzens darauf. Erstens der Linie zuliebe und zweitens auch deshalb, weil der Artikel jetzt absolute Priorität hatte. Schließlich war ein voller Magen eine ziemlich sichere Methode, um müde zu werden. Genau das konnte er jetzt nicht gebrauchen.
George öffnete den Laptop und begann zu schreiben. Die Zeilen flossen ihm routiniert aus den Fingern. Er formulierte flott, sachlich und zweckmäßig. Sein Ehrgeiz war es schließlich nicht, der Goethe Geilenkirchens zu werden, sondern seine Leser kurzweilig und aktuell zu informieren.
Zwischendurch überprüfte er die Fotos. Besondere Aussagekraft hatten sie zwar nicht, aber die Redaktion würde ihm trotzdem dankbar für das Bildmaterial sein. Als George seinen Blick über die Terrasse schweifen ließ, bemerkte er den Ford-Fahrer. Er war offenbar auch im Hotel abgestiegen. Er trug einen Schnauzbart wie er zu Kaiser Wilhelms Zeiten modern gewesen war und machte schon allein dadurch auf sich aufmerksam.
Vielleicht hätte Schmitz ihn aber trotzdem nicht bemerkt, wenn er sich nicht mit einer ziemlich durchdringenden Stimme nach den Räumen erkundigt hätte, die für das Psychologen-Seminar vorgesehen seien.
„Es tut mir leid, aber hier gibt es kein Psychologen-Seminar“, sagte die Rezeptionistin, eine Blondine Mitte zwanzig, kopfschüttelnd.
„Wie kommt es, dass Sie keine Ahnung von den Dingen haben, die in Ihrem Haus veranstaltet werden?“, fauchte der Schnauzbartträger ziemlich ungehalten, und George hätte am liebsten eingegriffen. So unhöflich wie der Kerl war, konnte man die junge Frau nur bedauern.
Die neue Managerin des Mercator-Hotels kam in geschwindem Schritt daher. Durch den siebten Sinn einer Hotelmanagerin für sich anbahnende Probleme erkannte sie die Situation sofort.
George hatte sie noch nicht kennengelernt, kannte aber ihren Namen und hatte ihr Bild schon mal in der Zeitung gesehen. Allerdings war der Bericht über den Wechsel auf dem Posten des Hotelmanagers im Mercator-Hotel von seinem Pressekollegen Hamacher verfasst worden.
Der Name der Managerin war Tamara Bell. Die agile, blond gelockte Mittdreißigerin im dunklen Hosenanzug und der schwarz eingefassten Brille sprach mit leichtem niederländischen Akzent, der ihre Herkunft verriet. Aber im Hotelgewerbe war Internationalität ja gewissermaßen Programm - auch und gerade, was die Herkunft des Führungspersonals anbelangte.
„Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?“, fragte Tamara Bell mit bewundernswerter Freundlichkeit.
„Ich bin hier, um an einem Seminar teilzunehmen, und niemand weiß etwas davon! Da wird man sich ja noch beschweren dürfen.“
Tamara Bell nickte ihrer Angestellten zu, woraufhin diese sich diskret zurückzog. Dann hörte sie sich an, was der Mann zu sagen hatte, dessen Namen George auf diese Weise auch eher unfreiwillig erfuhr.
Der Mann hieß Dr. Dr. Roloffsen und war offenbar Psychologe.
Nach einigem Hin und Her, währenddem sich der Erregungsgrad des Doppeldoktors merklich abkühlte, kam schließlich heraus, dass es sich schlicht und ergreifend um ein Missverständnis handelte.
„Meine Angestellte konnte nicht wissen, dass Sie das Seminar zur Reinkarnationstherapie meinen“, sagte Frau Bell.
„Ja, meine Güte, aber ...“
Und dann erläuterte ihm die Managerin in aller Ruhe, in welchen Räumlichkeiten das Seminar stattfinden würde.
„Eigentlich müssten Sie aber auch einen Übersichtsplan vom Veranstalter des Seminars zugeschickt bekommen haben.“
Es stellte sich heraus, dass Dr. Dr. Roloffsen den wohl nicht sorgfältig genug aufbewahrt hatte.
Als Tamara Bell die Situation schließlich zu allseitiger Zufriedenheit gelöst hatte und Dr. Dr. Roloffsen sichtlich weniger erregt von dannen zog, kam die Hotelmanagerin an Georges Tisch vorbei. Sie hatte ihn zunächst nicht weiter zur Kenntnis genommen und nickte ihm nur freundlich zu. Dann aber stutzte sie und blieb stehen.
„Sie sind doch ... der Mann von der Zeitung oder?“
„Ja, ja ...“
Georges Konterfei war allgemein im gesamten Westzipfel bekannt wie eine Comic-Figur. Sein Schattenriss war jahrelang das Erkennungszeichen seiner Kolumnen und Berichte gewesen und sorgte dafür, dass er wahrscheinlich so manchen Bürgermeister der Region an Wiedererkennungswert und Bekanntheit übertraf.
„Ich komme jetzt leider nicht auf Ihren Namen, aber ... Smits?“
„Schmitz!“, korrigierte George.
„Herzlich willkommen im Mercator-Hotel. Und schön, dass ich Sie auf diese Weise auch einmal kennenlerne, Herr Schmitz.“
„Danke sehr.“
„Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl und genießen hier Ihren Aufenthalt.“