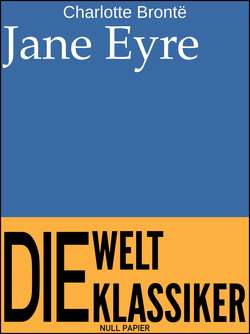Читать книгу Jane Eyre - Шарлотта Бронте, Charlotte Bront - Страница 11
Drittes Kapitel
ОглавлениеDann erinnerte ich mich an nichts mehr. Als ich erwachte, war es mit dem Gefühl eines schrecklichen Alpdrückens, vor mir sah ich eine unheimliche rote Glut, von der sich dicke, schwarze Stangen abhoben. Ich hörte Stimmen, die hohl an mein Ohr klangen, als würden sie durch das Rauschen des Wassers oder Toben des Windes übertönt. Aufregung, Ungewissheit und ein alles beherrschendes Gefühl des Entsetzens hielt alle meine Sinne gefangen. Es vergingen nur wenige Augenblicke, und dann gewahrte ich, dass jemand mich berührte, mich aufhob und mich in eine sitzende Stellung brachte, und zwar viel zärtlicher und sorgsamer, als mich bis jetzt irgendjemand gestützt oder emporgehoben hatte. Ich lehnte meinen Kopf gegen einen Arm oder ein Polster und fühlte mich unendlich wohl.
Noch fünf Minuten und die Wolken der Bewusstlosigkeit begannen zu schwinden. Jetzt wusste ich sehr wohl, dass ich in meinem eigenen Bette lag, und dass die rote Glut nichts anderes war, als das Feuer im Kamin der Kinderstube. Es war Nacht, eine Kerze brannte auf dem Tische; Bessie stand am Fußende meines Bettes und hielt eine Waschschüssel in der Hand, ein Herr saß auf einem Lehnstuhle neben mir und beugte sich über mich.
Ich empfand eine unbeschreibliche Erleichterung, eine wohltuende Überzeugung der Sicherheit und des Beschütztseins, als ich sah, dass sich ein Fremder im Zimmer befand, ein Mensch, der nicht zum Haushalt von Gateshead, nicht zu den Verwandten von Mrs. Reed gehörte. – Mich von Bessie abwendend – obgleich ihre Gegenwart mir weit weniger unangenehm war, als mir zum Beispiel Abbots Gesellschaft gewesen wäre – prüfte ich die Gesichtszüge des Herrn; ich kannte ihn, es war Mr. Lloyd, ein Apotheker, den Mrs. Reed zuweilen rufen ließ, wenn ihre Dienstboten krank waren. Für sich selbst und ihre Kinder nahm sie immer nur die Hilfe des Arztes in Anspruch.
»Nun, wer bin ich?« fragte er.
Ich sprach seinen Namen aus und streckte ihm zu gleicher Zeit meine Hand entgegen; er nahm sie, lächelte und sagte: »Ah, wir werden uns jetzt langsam erholen.« Dann legte er mich nieder, wandte sich zu Bessie, empfahl ihr, sehr vorsichtig zu sein und mich während der Nacht nicht zu stören. Nachdem er noch weitere Weisungen erteilt und gesagt hatte, dass er am folgenden Tage wiederkommen würde, ging er fort; zu meiner größten Betrübnis; während er auf dem Stuhl neben meinem Kopfkissen saß, fühlte ich mich so beschützt, so sicher, und als die Tür sich hinter ihm schloss, wurde das ganze Zimmer dunkel und mein Herz verzagte von neuem, es unterlag der Last eines unbeschreiblichen Grams.
»Glauben Sie, dass Sie schlafen können, Miss?« fragte Bessie mich ungewöhnlich sanft.
Kaum wagte ich, ihr zu antworten, denn ich fürchtete, dass ihre nächsten Worte wieder rau klingen würden. »Ich will es versuchen«, sagte ich leise.
»Möchten Sie nicht irgend etwas essen oder trinken?«
»Nein, ich danke, Bessie.«
»Nun, dann werde ich auch schlafen gehen, denn es ist schon nach Mitternacht; aber Sie können mich rufen, wenn Sie während der Nacht irgend etwas brauchen.«
Welche seltene Höflichkeit! Sie ermutigte mich, eine Frage zu stellen.
»Bessie, was ist denn mit mir geschehen? Bin ich sehr krank?«
»Ich vermute, dass Sie vor Schreien im roten Zimmer krank geworden sind; aber Sie werden ohne Zweifel bald wieder ganz gesund sein.«
Bessie ging in das anstoßende Zimmer der Hausmädchen. Ich hörte, wie sie dort sagte:
»Sarah, komm und schlaf bei mir in der Kinderstube, und wenn es mein Leben gälte, so könnte ich diese Nacht nicht mit dem armen Kinde allein bleiben; es könnte sterben! Wie sonderbar, dass Miss Jane einen solchen Anfall haben musste! Ich möchte doch wissen, ob sie irgend etwas gesehen hat. Mrs. Reed war dieses Mal aber auch zu hart gegen sie.«
Sarah kam mit ihr zurück; beide gingen zu Bett; sie flüsterten wenigstens noch eine halbe Stunde miteinander, bevor sie einschliefen. Ich hörte einige Bruchstücke ihrer Unterhaltung, und aus diesen schloss ich auf den Hauptgegenstand ihrer Diskussion.
»Etwas ist an ihr vorübergeschwebt, ganz in Weiß gekleidet, dann ist es verschwunden.« – – »Ein großer, schwarzer Hund hinter ihm.« – »Dreimal hat es laut an der Zimmertür geklopft.« – »Ein Licht auf dem Friedhofe gerade über seinem Grabe« – u.s.w., u.s.w.
Endlich schliefen beide ein. Feuer und Licht erloschen. In schaurigem Wachen ging die Nacht für mich langsam hin; Entsetzen und Angst hielten Ohren, Augen und Sinne wach. – Entsetzen und Angst, wie nur Kinder es zu empfinden imstande sind.
Diesem Zwischenfall im roten Zimmer folgte keine lange, ernste, körperliche Krankheit; nur eine heftige Erschütterung meiner Nerven, deren Widerhall ich noch bis auf den heutigen Tag empfinde. Ja, Mrs. Reed, Ihnen verdanke ich gar manchen qualvollen Schmerz der Seele. Aber ich sollte Ihnen verzeihen, denn Sie wussten nicht, was Sie taten, während Sie jede Faser meines Herzens zerrissen, glaubten Sie nur meine bösen Neigungen und Anlagen zu ersticken.
Am nächsten Tage gegen Mittag war ich bereits aufgestanden und angekleidet und saß in einen warmen Shawl gehüllt vor dem Kaminfeuer. Ich fühlte mich körperlich schwach und gebrochen, aber mein schlimmstes Übel war ein unaussprechlicher Jammer der Seele, ein Jammer, der mir fortwährend stille Tränen entlockte, kaum hatte ich einen salzigen Tropfen von meiner Wange getrocknet, als auch schon ein anderer folgte. Und doch meinte ich, dass ich augenblicklich glücklich sein müsste, denn keiner von den Reeds war da, alle waren mit ihrer Mama im großen Wagen spazieren gefahren; auch Abbot nähte in einem anderen Zimmer, und während Bessie hin und her ging, Spielsachen forträumte und Schiebladen ordnete, richtete sie dann und wann ein ungewöhnlich freundliches Wort an mich. Diese Lage der Dinge wäre für mich ein Paradies des Friedens gewesen, für mich, die ich nur an ein Dasein voll unaufhörlichen Tadels und grausame Sklaverei gewöhnt war, – aber in der Tat waren meine Nerven jetzt in einem solchen Zustande, dass keine Ruhe sie mehr sänftigen, kein Vergnügen sie mehr freudig erregen konnte.
Bessie war unten in der Küche gewesen und brachte mir jetzt einen Kuchen herauf, der auf einem gewissen, bunt gemalten Porzellanteller lag, dessen Paradiesvogel, welcher sich auf einem Kranz von Maiglöckchen und Rosenknospen schaukelte, stets eine enthusiastische Bewunderung in mir wach gerufen hatte. Gar oft hatte ich innig gebeten, diesen Teller in die Hand nehmen zu dürfen, um ihn genauer betrachten zu können, bis jetzt hatte man mich aber stets einer solchen Gunst für unwürdig gehalten. Jetzt stellte man mir nun diesen kostbaren Teller auf den Schoß und bat mich freundlich, das Stückchen auserlesenen Gebäcks, welches auf demselben lag, zu essen. Eitle Gunst! Sie kam zu spät, wie so manche andere, die so innig erwünscht, und so lange versagt worden war! Ich konnte den Kuchen nicht essen, und das Gefieder des Vogels, die Farben der Blumen schienen mir seltsam verblasst – ich schob sowohl Teller wie Gebäck von mir. Bessie fragte mich, ob ich ein Buch haben wolle. Das Wort Buch wirkte wie ein vorübergehendes Reizmittel, und ich bat sie, mir »Gullivers Reisen« aus der Bibliothek zu holen. Dieses Buch hatte ich schon unzählige Male mit Entzücken gelesen; ich hielt es für eine Erzählung von Tatsachen und entdeckte in ihm eine Ader, die ein weit tieferes Interesse für mich hatte, als dasjenige, welches ich in Märchen gefunden hatte; denn nachdem ich die Elfen vergebens unter den Blättern des Fingerhuts und der Glockenblume, unter Pilzen und altem, von Epheu umrankten Gemäuer gesucht, hatte ich mein Gemüt mit der traurigen Wahrheit ausgesöhnt, dass sie alle England verlassen hätten, um in ein unbekanntes Land zu gehen, wo die Wälder noch stiller und wilder und dicker, die Menschen noch spärlicher gesäet seien. Liliput hingegen und Brobdignag waren nach meinem Glauben solide Bestandteile der Erdoberfläche; ich zweifelte gar nicht, dass, wenn ich eines Tages eine weite Reise machen könnte, ich mit meinen eigenen Augen die kleinen Felder und Häuser, die winzigen Menschen, die zierlichen Kühe, Schafe und Vögel des einen Königreichs sehen würde, und ebenso die baumhohen Kornfelder, die mächtigen Bullenbeißer, die Katzen-Ungeheuer, die turmhohen Männer und Frauen des anderen. Und doch, als ich den geliebten Band jetzt in Händen hielt – als ich die Seiten umblätterte und in den wundersamen Bildern den Reiz suchte, welchen sie mir bis jetzt stets gewährt hatten – da war alles alt und trübselig; die Riesen waren hagere Kobolde; die Pigmäen boshafte und scheußliche Gnomen, Gulliver ein trübseliger Wanderer in öden und gefährlichen Regionen. Ich schloss das Buch, in dem ich nicht länger zu lesen wagte und legte es auf den Tisch neben das unberührte Stück Kuchen.
Bessie war jetzt mit dem Abstauben und Aufräumen des Zimmers zu Ende, und nachdem sie ihre Hände gewaschen hatte, öffnete sie eine gewisse kleine Schieblade, welche mit den schönsten, prächtigsten Lappen von Seide und Atlas angefüllt war, und begann einen Hut für Georginas neue Puppe zu machen. Dann begann sie zu singen; das Lied lautete:
»Als wir durch Wald und Flur streiften.
Vor langer, langer Zeit.«
Wie oft hatte ich dies Lied schon gehört, und immer mit dem größten Entzücken; denn Bessie hatte eine süße Stimme – wenigstens nach meinem Geschmack. Aber jetzt, obgleich ihre Stimme noch immer lieblich klang, lag für mich eine unbeschreibliche Traurigkeit in dieser Melodie. Zuweilen, wenn ihre Arbeit sie ganz in Anspruch nahm, sang sie den Refrain sehr leise, sehr langsam: »Vor langer, langer Zeit«; dann klang es wie die Schlusskadenz eines Grabliedes. Endlich begann sie eine andere Ballade zu singen, diesmal eine wirklich traurige.
Mein Körper ist müd und wund ist mein Fuß,
Weit ist der Weg, den ich wandern muss.
Bald wird es Nacht, und den Weg ich nicht find’.
Den ich wandern muss, armes Waisenkind!
Weshalb sandten sie mich so weit, so weit,
Durch Feld und Wald, auf die Berg’, wo es schneit?
Die Menschen sind hart! Doch Engel so lind.
Bewachen mich armes Waisenkind.
Die Sterne, sie scheinen herab so klar.
Die Luft ist mild! Es ist doch wahr: Gott ist barmherzig, er steuert dem Wind, Dass er nicht erfasse das Waisenkind. Und wenn ich nun strauchle am Waldesrand Oder ins Meer versink, wo mich führt keine Hand’, So weiß ich doch, dass den Vater ich find’, Er nimmt an sein Herz das Waisenkind! Das ist meine Hoffnung, die Kraft mir gibt. Dass Gott da droben sein Kind doch liebt. Bei ihm dort oben die Heimat ich find’. Er liebt auch das arme Waisenkind!
»Kommen Sie, Miss Jane, weinen Sie nicht«, sagte Bessie, als sie zu Ende war. Ebensogut hätte sie dem Feuer sagen können »brenne nicht!« aber wie hätte sie denn auch eine Ahnung von dem herzzerreißenden Schmerz haben können, dessen Beute ich war? – Im Laufe des Morgens kam Mr. Lloyd wieder.
»Wie? Schon aufgestanden?« rief er, als er in die Kinderstube trat. »Nun, Wärterin, wie geht es ihr denn eigentlich?«
Bessie entgegnete, dass es mir außerordentlich gut gehe.
»Dann sollte sie aber fröhlicher aussehen. Kommen Sie her, Miss Jane. Sie heißen Jane, nicht wahr?«
»Ja, mein Herr, Jane Eyre!«
»Nun, Sie haben geweint, Miss Jane Eyre, wollen Sie mir nicht sagen, weshalb? Haben Sie Schmerzen?«
»Nein, Herr.«
»Ah, ich vermute, dass sie weint, weil sie nicht mit Mrs. Reed spazieren fahren durfte«, warf Bessie hier ein.
»O nein, gewiss nicht, für solche Albernheit ist sie denn doch zu alt.«
Das dachte ich auch; und da meine Selbstachtung durch die falsche Beschuldigung verletzt war, antwortete ich schnell: »In meinem ganzen Leben habe ich noch keine Tränen um solche Dinge vergossen. Ich hasse die Spazierfahrten. Ich weine, weil ich so unglücklich bin.«
»Schämen Sie sich, Miss!« rief Bessie.
Der gute Apotheker schien ein wenig verwirrt. Ich stand vor ihm; er heftete seine Augen fest auf mich. Diese Augen waren klein und grau, nicht sehr leuchtend, aber ich glaube, dass ich sie jetzt sehr klug finden würde. Trotz der harten Züge hatte er ein gutmütiges Gesicht. Nachdem er mich lange mit Muße betrachtet hatte, sagte er: »Was hat Sie gestern krank gemacht?«
»Sie ist gefallen«, sagte Bessie wieder einfallend.
»Gefallen! Nun, das ist gerade wieder wie ein Kind! Kann sie bei ihrem Alter denn noch nicht allein gehen? Sie muss doch acht oder neun Jahre alt sein?«
»Jemand hat mich zu Boden geschlagen«, lautete die derbe Erklärung, welche der Schmerz gekränkten Stolzes mir wiederum entriss, »aber das hat mich nicht krank gemacht«, fügte ich hinzu, während Mr. Lloyd bedächtig eine Prise Tabak nahm.
Als er die Tabaksdose wieder in seine Westentasche schob, rief der laute Klang einer Glocke die Dienstboten zum Mittagessen; er wusste, was es bedeutete: »Das gilt Ihnen, Wärterin«, sagte er, »Sie können hinunter gehen; ich werde Miss Jane einige Lehren geben, bis Sie zurückkehren.«
Bessie wäre lieber geblieben, aber sie war gezwungen zu gehen, weil die Pünktlichkeit bei den Mahlzeiten eine Sache war, auf welche in Gateshead-Hall strenge gehalten wurde.
»Der Fall hat Sie nicht krank gemacht? Nun, was war es denn?« fragte Mr. Lloyd weiter, nachdem Bessie gegangen war.
»Ich war in einem Zimmer eingesperrt, wo ein Geist umgeht – und es war schon lange dunkel.«
Ich sah, wie Mr. Lloyd lächelte und zugleich die Stirn runzelte. »Ein Geist! Was! Sie sind am Ende doch nichts anderes, als ein kleines Kind! Sie fürchten sich vor Geistern?«
»Ja, vor Mr. Reeds Geist fürchte ich mich. Er starb in jenem Zimmer und lag dort auf der Bahre. Weder Bessie noch sonst jemand geht am Abend hinein, wenn es nicht dringend notwendig ist; und es war so furchtbar grausam, mich dort allein, ohne Licht, einzuschließen – so grausam, dass ich glaube, ich werde es niemals vergessen können.«
»Unsinn! Und macht das Sie so elend? Fürchten Sie sich jetzt bei Tage auch noch?«
»Nein. Aber es dauert nicht lange und dann wird es wieder Nacht. Und außerdem, ich bin unglücklich, sehr unglücklich um anderer Dinge willen.«
»Was für Dinge denn? Können Sie mir die nicht nennen?«
Wie sehr wünschte ich, offen und ehrlich auf diese Frage zu antworten! Wie schwer war es aber, Worte für eine solche Antwort zu finden! Kinder können wohl empfinden, aber sie können ihr Empfinden nicht zergliedern; und wenn ihnen die Zergliederung zum Teil auch in Gedanken gelingt, so wissen sie nicht, wie sie das Resultat dieses Vorganges in Worte kleiden sollen. Da ich aber fürchtete, dass ich diese erste und einzige Gelegenheit, meinen Kummer durch Mitteilung zu erleichtern, ungenützt vorübergehen lassen könnte, gelang es mir nach einer unruhigen Pause, eine unzulängliche, aber wahre Antwort hervorzubringen.
»Erstens habe ich keinen Vater, keine Mutter, keinen Bruder, keine Schwester.«
»Aber Sie haben eine gütige Tante und liebe Vettern und Cousinen.«
Wiederum hielt ich inne, dann rief ich kindisch aus:
»Aber John Reed hat mich zu Boden geschlagen und meine Tante hat mich im roten Zimmer eingesperrt.«
Zum zweiten Mal holte Mr. Lloyd seine Schnupftabaksdose hervor.
»Finden Sie denn nicht, dass Gateshead-Hall ein wunderschönes Haus ist?« fragte er. »Sind Sie nicht dankbar, an einem so schönen Orte leben zu können?«
»Es ist nicht mein eigenes Haus, Sir; und Abbot sagt, dass ich weniger recht habe, hier zu sein, als ein Dienstbote.«
»Dummes Zeug! Sie können doch nicht so dumm sein, zu wünschen, dass Sie einen so herrlichen Ort wie diesen verlassen dürften?«
»Wenn ich nur wüsste, wohin ich gehen sollte, ich wäre wahrhaftig froh zu gehen; aber ich darf Gateshead erst verlassen, wenn ich erwachsen bin.«
»Vielleicht doch früher – wer weiß? Haben Sie außer Mrs. Reed keine Verwandte?«
»Ich glaube nicht, Sir.«
»Niemanden, der mit Ihrem Vater verwandt war?«
»Ich weiß es nicht. Einmal fragte ich Tante Reed, und da sagte sie, dass ich möglicherweise irgendwelche arme, heruntergekommene Verwandte, namens Eyre, haben könne, dass sie aber nichts über sie wisse.«
»Möchten Sie denn zu ihnen gehen, wenn Sie solche Angehörige hätten?«
Ich besann mich. Armut hat etwas abschreckendes für erwachsene Menschen; für Kinder aber noch mehr; sie haben nicht viel Sinn für fleißige, arbeitsame, ehrenhafte Armut; dies Wort erweckt in ihnen nur den Gedanken an zerlumpte Kleider, kärgliche Nahrung, einen kalten Ofen, rohe Manieren und entwürdigende Laster: auch für mich war Armut gleichbedeutend mit Entehrung.
»Nein. Ich möchte nicht bei armen Leuten leben«, war meine Antwort.
»Auch nicht, wenn sie gütig gegen Sie wären?«
Ich schüttelte den Kopf. Ich konnte nicht begreifen, wie arme Leute überhaupt die Mittel haben, gütig zu sein. Und dann – sprechen lernen wie sie – ihre Manieren annehmen – schlecht erzogen werden – aufwachsen wie eins jener armen Weiber, die ich zuweilen vor den Türen der Hütten ihre Kinder warten und ihre Kleider waschen sah? – nein, ich war nicht heroisch genug, meine Freiheit um den Preis meiner Kaste zu erkaufen.
»Aber sind Ihre Verwandten denn so arm? Gehören sie zur arbeitenden Klasse?«
»Das weiß ich nicht; Tante Reed sagt, wenn ich überhaupt Angehörige habe, so müssen sie Bettlergesindel sein. Nein, nein, ich möchte nicht betteln gehen.«
»Möchten Sie nicht in die Schule gehen?«
Wiederum dachte ich nach; kaum wusste ich, was eine Schule denn eigentlich sei; Bessie sprach zuweilen davon wie von einem Orte, an dem man von jungen Damen erwartet, dass sie außerordentlich manierlich und geziert sind; John Reed hasste seine Schule und schmähte seinen Lehrer, aber John Reeds Ansichten und Geschmack waren keine Regel für die meinen, und wenn Bessies Berichte über Schuldisziplin (diese stammten von den Töchtern einer Familie, in welcher sie gedient hatte, bevor sie nach Gateshead kam) etwas abschreckend lauteten, so waren ihre Erzählungen von verschiedenen Talenten und Kenntnissen, welche diese selben jungen Damen sich angeeignet hatten, andererseits höchst verlockend. Sie prahlte von wunderschönen Gemälden, von Landschaften und Blumen, welche sie vollendet, von Liedern, die sie singen und Klavierpiecen, die sie spielen, von Geldbörsen, die sie häkeln, von französischen Büchern, die sie übersetzen konnten, bis mein Gemüt, während ich ihr lauschte, zur Nachahmung aufgestachelt wurde. Außerdem wäre die Schule doch eine gründliche Abwechselung: damit war eine lange Reise verknüpft, eine gänzliche Trennung von Gateshead, ein Eintritt in ein neues Leben.
»Ich möchte in der Tat in eine Schule gehen«, war die hörbare Schlussfolgerung meines Nachsinnens.
»Nun, nun, wer weiß denn, was geschieht!« sagte Mr. Lloyd, indem er sich erhob. »Das Kind braucht Luft- und Ortsveränderung«, fügte er hinzu, mit sich selbst redend, »die Nerven sind in einer bösen Verfassung.«
Jetzt kam Bessie zurück; in demselben Augenblick hörte man Mrs. Reeds Wagen über den Kies der Gartenwege rollen.
»Ist das Ihre Herrin, Wärterin?« fragte Mr. Lloyd, »ich möchte noch mit ihr reden bevor ich gehe.«
Bessie forderte ihn auf, ins Frühstückszimmer zu gehen und geleitete ihn hinaus. Wie ich aus den nachfolgenden Begebenheiten schloss, wagte der Apotheker während der Unterredung mit Mrs. Reed ihr anzuempfehlen, dass sie mich in eine Schule schicke; und ohne Zweifel wurde dieser Rat sehr bereitwillig angenommen, denn als ich an einem der folgenden Abende im Bette lag, und Bessie und Abbot mich schlafend glaubten, sagte letztere: »Ich glaube, die gnädige Frau ist nur zu froh, solch ein langweiliges, boshaftes Kind los zu werden; sie sieht immer aus, als beobachte sie jeden Menschen und schmiede heimliche Pläne.« – Ich glaube wahrhaftig, dass Abbot mich für eine Art kindlichen Guy Fawkes1 hielt.
Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich auch aus Miss Abbots Mitteilungen an Bessie, dass mein Vater ein armer Prediger gewesen; dass meine Mutter ihn gegen den Willen ihrer Angehörigen geheiratet habe, welche diese Heirat für erniedrigend gehalten; dass mein Großvater Reed so erzürnt über ihren Ungehorsam gewesen, dass er sie gänzlich enterbte; dass mein Vater, nachdem er kaum ein Jahr mit meiner Mutter verheiratet gewesen, ein typhöses Fieber bekommen, während er die arme Bevölkerung einer großen Fabrikstadt, in welcher seine Pfarre lag, besuchte; und dass meine arme Mutter kaum einen Monat später ihrem Gatten ins Grab folgte.
Als Bessie diese Erzählung mit anhörte, seufzte sie und sagte: »Abbot, die arme Miss Jane ist auch zu bedauern.«
»Ja, ja«, entgegnete Abbot, »wenn sie ein liebes, gutes, hübsches Kind wäre, so könnte man Mitleid mit ihr haben, weil sie so gänzlich verlassen ist; aber solch eine scheußliche kleine Kröte kann einem doch unmöglich Erbarmen einflößen.«
»Nein, nicht viel«, stimmte Bessie ihr bei, »auf jeden Fall würde eine so prächtige Schönheit wie Miss Georgiana in einer solchen Lage viel rührender sein.«
»Ja, ja, ich bete Miss Georgiana an!« rief die begeisterte Abbot. »Der kleine süße Liebling! – Mit ihren langen Locken und blauen Augen, und den süßen, lieblichen Farben, gerade als ob sie angemalt wäre! – Bessie, ich hätte wahrhaftig Appetit auf einen gerösteten Käse zum Abendbrot.«
»Ich auch, ich auch – mit geschmorten Zwiebeln. Kommen Sie, wir wollen hinunter gehen.«
Und sie gingen.
1 Guy Fawkes, geboren 1570, Haupt der Pulververschwörung in London, 1605 hingerichtet. <<<