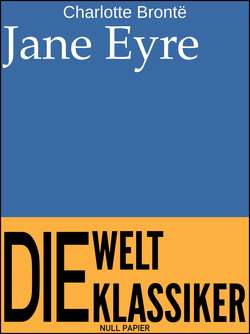Читать книгу Jane Eyre - Шарлотта Бронте, Charlotte Bront - Страница 17
Neuntes Kapitel
ОглавлениеAber der Entbehrungen oder vielmehr der Mühseligkeiten in Lowood wurden auch weniger. Der Frühling kam – er war in der Tat schon gekommen; die Winterfröste hatten aufgehört; der Schnee war geschmolzen, die schneidenden Winde hatten nachgelassen. Meine armen Füße, welche die Lüfte des Januar geschunden und entzündet hatten, begannen zu heilen und unter den warmen Winden des April ihre alte Gestalt anzunehmen; die Nächte und Morgen ließen mit ihrer kanadischen Temperatur nicht länger das Blut in unseren Adern erfrieren; wir ertrugen es jetzt, die Spielstunde im Garten zuzubringen; zuweilen an besonders sonnigen Tagen begann es schon angenehm und freundlich zu werden, ein zartes Grün begann die braunen Beete zu überziehen, täglich wurde es frischer und erweckte die Vorstellung, dass die Hoffnung während der Nacht über sie hinschreite und jeden Morgen schönere Spuren ihrer Schritte zurücklasse. Unter den Blättern blickten Blumen hervor: Schneeglöckchen, Krokus, dunkelrote Aurikeln und goldäugige Dreifaltigkeitsblumen. An Donnerstagnachmittagen – ein halber Ferialtag – machten wir jetzt lange Spaziergänge und fanden am Feldrain, unter den Hecken noch schönere Blumen.
Ich entdeckte auch, dass ein großes Vergnügen, ein Genuss, welchem nur der Horizont eine Grenze setzte, außerhalb der hohen und mit eisernen Spitzen gekrönten Mauern unseres Gartens lag, – dieser Genuss bestand nämlich in der Aussicht, welche eine lange Reihe hochgipfeliger, grüner und schattiger Hügel bot – in einem klaren Bach voll dunkler Steine und funkelnder Wirbel und Strudel.
Wie ganz anders hatte dieses Bild ausgesehen, als ich es in Frost erstarrt, in ein Leichentuch von Schnee gehüllt unter dem bleiernen Himmel des Winters gesehen! Wenn todeskalte Nebel vom Ostwind gejagt über diese düsteren Gipfel hinzogen und über Wiesen und Anhöhen hinunterrollten, bis sie sich mit dem gefrorenen Nebel des Baches vereinigten! Dieser Bach selbst war damals ein Strom, zügellos und tobend; er durchriss den Wald und erfüllte die Luft mit tosendem Lärm und wildem Sprühregen; und der Wald an seinen Ufern war nichts als eine Reihe von Gerippen.
Aus dem April wurde Mai; ein klarer, schöner Mai; all seine Tage brachten blauen Himmel und milden Sonnenschein und leise westliche oder südliche Winde. Und jetzt reifte die Vegetation mit Macht; Lowood schüttelte seine Locken; es wurde grün und blütenreich; seine großen Ulmen- und Eschen- und Eichen-Skelette wurden majestätischem Leben zurückgegeben. Waldpflanzen sprießten in allen Ecken und Winkeln; zahllose Abarten von Moos füllten die Vertiefungen, und die wilden Schlüsselblumen bedeckten den Boden wie mit Sonnenstrahlen; oft habe ich an schattigen Stellen ihren zarten, goldigen Glanz für hellen Sonnenschein gehalten. Und alles dies genoss ich oft und voll, frei, unbewacht und fast immer allein; diese ungewohnte Freiheit, dieses Vergnügen hatte eine Ursache, von welcher zu reden jetzt meine Aufgabe sein muss.
Habe ich die Lage meines Wohnsitzes nicht als eine reizende geschildert, wenn ich erzählte, dass dieser in Hügel und Wald gebettet liegt und sich am Rande eines Stromes erhebt? Reizend in der Tat; ob aber gesund oder nicht, das ist eine andere Frage.
Jenes Waldtal, in welchem Lowood lag, war die Brutstätte von Nebeln und einer aus Nebel entstandenen Pestilenz; diese wuchs mit dem Frühling, kroch in das Waisenasyl, hauchte den Typhus in die überfüllten Schlafsäle und Schulzimmer, und bevor der Mai gekommen, war die Erziehungsanstalt in ein Hospital umgewandelt.
Durch Hunger und vernachlässigte Erkältungen war die Mehrzahl der Schülerinnen für die Ansteckung veranlagt; von achtzig Mädchen wurden fünfundvierzig zu gleicher Zeit von der Krankheit ergriffen. Die Schulstunden hörten auf, alle Regeln blieben unbeachtet. Den Wenigen, welche gesund blieben, wurde eine fast unbeschränkte Freiheit gewährt, denn der Arzt bestand auf der Notwendigkeit häufiger Bewegung in freier Luft, um sie gesund zu erhalten; und selbst wenn es anders gewesen wäre, so hatte niemand Zeit oder Lust, sie zu bewachen oder zurückzuhalten. Miss Temples ganze Aufmerksamkeit war von den Patientinnen in Anspruch genommen; sie wohnte im Krankenzimmer; niemals verließ sie es, mit Ausnahme von wenigen Stunden der Nacht, wo sie selbst die ihr so nötige Ruhe suchte. Die Lehrerinnen waren vollauf mit dem Packen oder anderen notwendigen Vorbereitungen für die Abreise jener Mädchen beschäftigt, welche glücklich genug waren, Freunde und Verwandte zu besitzen, die sie von dem Seuchenherd entfernten. Viele, welche den Keim der Ansteckung bereits in sich trugen, kehrten nur nach Hause zurück, um zu sterben; einige starben in der Anstalt und wurden schnell und ruhig begraben, da die Natur der Krankheit keinen Aufschub duldete.
Während so die entsetzliche Krankheit eine Bewohnerin von Lowood geworden war und der Tod sein häufiger Besucher; während innerhalb seiner Mauern Furcht und Trauer herrschten; während die Dünste eines Hospitals durch Zimmer und Korridore zogen, und Tränke und Pastillen umsonst versuchten, der Ausdünstung des Todes entgegen zu wirken, – leuchtete draußen der strahlende Mai über stolze Hügel und herrliches Waldland. Der Garten prangte im Blumenflor: Rosenpalmen waren so hoch wie Bäume in die Höhe geschossen; Lilienkelche waren erschlossen, Tulpen und Rosen standen in Blüte; die Ränder der kleinen Beete strahlten in ihrem Schmuck von rosa Seenelken und dunkelroten Tausendschönchen; Morgen und Abend strömten die Heckenrosen ihren würzigen Duft aus – und diese blühenden Schätze waren jetzt für die meisten Bewohnerinnen von Lowood wertlos – nur zuweilen legte man ihnen eine Handvoll Blüten und Kräuter in den Sarg.
Aber ich und die übrigen, welche gesund blieben, genossen in vollen Zügen die Schönheit des Frühlings und der Gegend; man ließ uns wie Zigeuner im Walde umher streifen; wir taten von morgens bis abends nur, was uns gefiel, gingen wohin wir wollten – und führten überhaupt ein besseres Dasein als früher. Mr. Brocklehurst und seine Familie kamen Lowood jetzt gar nicht mehr zu nahe; die Angelegenheiten der Haushaltung wurden nicht mehr geprüft; die böse Haushälterin war fort; die Furcht vor Ansteckung hatte sie fortgetrieben; ihre Nachfolgerin, welche in der Armenapotheke in Lowton Vorsteherin gewesen war, kannte die Gebräuche ihres neuen Aufenthalts noch nicht und versorgte uns mit verhältnismäßiger Freigebigkeit. Außerdem waren unserer ja weniger, die da Nahrung verlangten; die Kranken konnten wenig essen; unsere Frühstücksschüsseln wurden besser gefüllt; wenn sie keine Zeit hatte, ein regelrechtes Mittagessen herzurichten – ein Fall, der ziemlich häufig eintrat, – pflegte sie uns ein großes Stück kalter Pastete zu geben oder eine große Schnitte Brot und Käse, und diesen Proviant nahmen wir dann mit uns in den Wald hinaus, wo jede von uns ihr Lieblingsplätzchen aufsuchte und ein königliches Mahl hielt.
Mein Lieblingssitz war ein breiter, glatter Stein, welcher weiß und trocken mitten aus dem Waldbache herausragte; er war nur zu erreichen, indem ich durch das Wasser watete, und diese Tat vollbrachte ich denn ziemlich oft und zwar barfuß. Der Stein war gerade breit genug, um außer mir noch einem anderen Mädchen bequemen Platz zu gewähren; dies war Mary Ann Wilson, damals meine auserwählte Gefährtin; sie war ein kluges, beobachtendes Geschöpf, deren Gesellschaft mir Freude machte, teilweise weil sie witzig und originell war, und teilweise, weil sie Manieren und Sitten hatte, welche mir besonders zusagten. Um einige Jahre älter als ich, kannte sie mehr von der Welt und konnte mir von vielen Dingen erzählen, die ich gern hörte; in ihrer Gesellschaft wurde meine Neugierde befriedigt; mit meinen Fehlern hatte sie die größte Nachsicht und niemals versuchte sie meinen Worten Zwang oder Zügel anzulegen. Sie hatte ein großes Erzählertalent, – ich besaß Talent für die Analyse; sie liebte es zu belehren – ich zu fragen; so wurden wir prächtig miteinander fertig und zogen wenn auch nicht viel Belehrung, so doch viel Vergnügen aus unseren gegenseitigen Verkehr.
Und wo war inzwischen Helen Burns? Weshalb brachte ich diese süßen Tage der Freiheit nicht in ihrer Gesellschaft zu? Hatte ich sie vergessen? Oder war ich so leichtsinnig, so unwürdig, dass ich ihrer veredelnden Gesellschaft müde geworden? Gewiss war die obenerwähnte Mary Ann Wilson jener meiner ersten Freundin nicht ebenbürtig; sie konnte mir nur lustige Geschichten erzählen oder irgend einen witzigen Klatsch wiederholen, der mir gerade Vergnügen machte, während Helen, wenn ich die Wahrheit über sie gesprochen habe, geeignet war, denen, welche das Vorrecht, die Begünstigung ihrer Unterhaltung genossen, Sinn und Geschmack für höhere, reinere Dinge einzuflößen.
Das ist wahr, mein teurer Leser, und ich wusste und fühlte das; – und obgleich ich ein unvollkommenes Geschöpf bin mit vielen Fehlern und wenigen guten Eigenschaften, so war ich Helen Burns’ doch noch niemals überdrüssig geworden; niemals hatte ich aufgehört, für sie eine Liebe zu hegen, die so stark, so zärtlich und so achtungsvoll war, wie nur je ein Gefühl mein Herz bewegt hat. Wie hätte es denn auch anders sein können, wenn Helen zu allen Zeiten und unter allen Umständen mir eine ruhige und treue Freundschaft bewiesen hatte, welche keine böse Laune je verbitterte, kein Streit jemals störte? – Aber Helen war augenblicklich krank; seit mehreren Wochen war sie meinen Augen bereits entrückt; ich wusste nicht, in welchem Zimmer sie sich jetzt befand. Man hatte mir gesagt, dass sie sich nicht in der Hospitalabteilung unter den Fieberkranken befände; denn ihre Krankheit war die Schwindsucht, nicht der Typhus, und ich in meiner Unwissenheit stellte mir unter Schwindsucht etwas mildes vor, das durch Pflege und Fürsorge mit der Zeit geheilt werden müsse.
In dieser Idee wurde ich noch dadurch bestärkt, dass sie einigemal an sonnigen, warmen Nachmittagen herunter kam und von Miss Temple in den Garten geführt wurde; bei diesen Gelegenheiten gestattete man mir aber nicht, mit ihr zu sprechen oder mich ihr auch nur zu nähern; ich sah sie nur aus dem Fenster des Schulzimmers und dann nicht einmal deutlich; denn sie war in viele Tücher gehüllt und saß in einiger Entfernung auf der Veranda.
Eines Abends im Anfang des Monats Juni war ich sehr spät mit Mary Ann im Walde geblieben; wie gewöhnlich hatten wir uns von den anderen getrennt und waren weit gewandert, so weit, dass wir den Weg verloren und denselben in einer einsamen Hütte erfragen mussten, wo ein Mann und eine Frau wohnten, die eine Herde voll halbwilder Schweine zu hüten hatten, welche von der Eichelmast im Walde gemästet wurden. Als wir endlich zurückkamen, war der Mond schon aufgegangen; ein Pony, welches wir als dasjenige des Arztes erkannten, stand an der Gartenpforte. Mary Ann bemerkte, dass wahrscheinlich irgendjemand schwer erkrankt sein müsse, wenn Mr. Bates noch so spät am Abend geholt worden sei. Sie ging in das Haus; ich blieb zurück, um noch eine Handvoll Wurzeln, die ich im Walde ausgegraben, in meinem Garten einzupflanzen; ich fürchtete, dass sie bis zum nächsten Morgen verwelken würden. Nachdem dies geschehen, verweilte ich noch einige Minuten; die Blumen dufteten so süß, als der Tau fiel; es war ein so wunderschöner Abend, so rein, so ruhig, so warm; und der noch gerötete Westen versprach wiederum einen schönen Tag. Im dunklen Osten stieg majestätisch der Mond empor. Ich beobachtete dies alles und freute mich daran, wie ein Kind sich zu freuen vermag, – da plötzlich kam mir der Gedanke, wie niemals zuvor:
»Wie traurig ist es doch, jetzt auf dem Krankenbett liegen zu müssen und in Todesgefahr zu schweben! Diese Welt ist so schön – wie entsetzlich wäre es, abberufen zu werden und wer weiß wohin gehen zu müssen!«
Und dann machte meine Seele die erste ernste Anstrengung, das zu begreifen, was man in Bezug auf Himmel und Hölle in sie gelegt hatte; zum ersten Mal blickte ich um mich und sah vor mir, neben mir, hinter mir nichts als einen unermesslichen Abgrund; zum ersten Mal bebte meine Seele entsetzt zurück, sie empfand und fühlte nichts sicheres mehr als den einen Punkt, auf welchem sie stand – die Gegenwart, alles andere war eine formlose Wolke, eine unergründliche Tiefe – es schauderte mich bei dem Gedanken zu straucheln, zu wanken – und in das Chaos hinabzutauchen. Als ich noch diesen neuen Gedanken nachhing, hörte ich, wie die große Haustür geöffnet wurde; Mr. Bates trat heraus, mit ihm eine Krankenwärterin. Nachdem sie gewartet bis er aufs Pferd gestiegen und fortgeritten war, wollte sie die Tür wiederum schließen. Ich lief zu ihr.
»Wie geht es Helen Burns?«
»Sehr schlecht«, lautete die Antwort.
»War Mr. Bates ihretwegen gekommen?«
»Ja.«
»Und was sagt er?«
»Er sagt, dass sie nicht mehr lange bei uns verweilen wird.«
Hätte ich diese Phrase gestern gehört, so würde sie nur den Glauben in mir wachgerufen haben, dass man sie nach Northumberland in ihre Heimat bringen wolle. Ich würde nicht vermutet haben, dass es bedeute, sie sei sterbend, – aber jetzt begriff ich sofort; es wurde mir augenblicklich klar, dass Helen Burns’ Tage auf dieser Welt gezählt seien, und dass sie bald hinauf in die Region der Geister gehen würde – wenn es überhaupt eine solche Region gab. Im ersten Moment bemächtigte sich meiner ein namenloser Schrecken; dann empfand ich den heftigsten Schmerz, dann einen Wunsch – den Wunsch, sie zu sehen. Und ich fragte, in welchem Zimmer sie läge.
»Sie ist in Miss Temples Zimmer«, sagte die Wärterin.
»Kann ich hinauf gehen und mit ihr sprechen?«
»O nein, Kind! Das geht nicht an. Und jetzt ist es auch für Sie Zeit, hinein zu gehen; Sie werden das Fieber bekommen, wenn Sie draußen sind, während der Tau fällt.«
Die Wärterin schloss die Haustür; ich ging durch den Seiteneingang, welcher zu dem Schulzimmer führte; ich kam noch zu rechter Zeit; es war neun Uhr, und Miss Miller rief gerade die Schülerinnen zum Schlafengehen.
Es mochte vielleicht zwei Stunden später, ungefähr elf Uhr sein; es war mir nicht möglich gewesen einzuschlafen und aus der tiefen Ruhe, welche im Schlafzimmer herrschte, schloss ich, dass meine Gefährtinnen fest schliefen; leise stand ich auf, zog mein Kleid über mein Nachtgewand und schlich mich barfuß aus dem Gemach, um Miss Temples Zimmer zu suchen. Es befand sich am entgegengesetzten Ende des Hauses; aber ich kannte den Weg, und die Strahlen des unbewölkten Sommermondes halfen mir, ihn zu finden. Ich verspürte einen scharfen Geruch von Kampher und gebranntem Essig, als ich mich dem Zimmer der Fieberkranken näherte; schnell eilte ich an der Tür vorüber, aus Furcht, dass die Krankenwärterin, welche die ganze Nacht wachen musste, mich hören könne. Ich hatte Angst davor, entdeckt und zurückgeschickt zu werden, denn ich musste Helen sehen, – ich musste sie umarmen bevor sie starb, – ich musste ihr einen letzten Kuss geben, noch ein letztes Wort mit ihr sprechen.
Nachdem ich die Treppe hinuntergegangen war, einen Teil vom Erdgeschoss des Hauses durchschritten hatte und es mir gelungen war, ohne Geräusch zwei Türen zu öffnen, erreichte ich eine zweite Treppe; diese stieg ich wieder hinauf und befand mich gerade vor der Tür von Miss Temples Zimmer. Durch das Schlüsselloch und eine Spalte unterhalb der Tür fiel ein Lichtschein; überall herrschte tiefste Stille. Als ich näher kam, fand ich die Tür ein wenig geöffnet, wahrscheinlich um in das dumpfe Krankengemach etwas Luft dringen zu lassen. Nicht gewillt zu zögern, von ungeduldigem Drange beseelt – Seele und alle Sinne in heftigem Schmerz erbebend – öffnete ich sie ganz und blickte hinein. Mein Auge suchte Helen und fürchtete – den Tod zu finden.
Dicht neben Miss Temples Bett und mit den weißen Vorhängen desselben halb verhängt, stand ein kleines Bettchen. Ich sah die Umrisse einer Gestalt unter der Bettdecke, doch das Gesicht war durch die Gardinen verdeckt. Die Wärterin, mit welcher ich im Garten gesprochen hatte, saß in einem Lehnstuhl und schlief; eine halbherabgebrannte Kerze, die auf dem Tische stand, verbreitete ein trübes Licht. Miss Temple war nicht sichtbar; später erfuhr ich, dass sie zu einer im Delirium liegenden Fieberkranken gerufen worden. – Ich wagte mich weiter ins Zimmer hinein; dann stand ich neben dem kleinen Bette still; meine Hand fasste den Vorhang, doch hielt ich es für besser, zu sprechen, bevor ich denselben zur Seite zog. Ein Schauer fasste mich bei dem Gedanken, dass ich vielleicht nur noch eine Leiche sehen könnte.
»Helen«, flüsterte ich sanft, »wachst du?«
Sie bewegte sich, schob den Vorhang zurück – – und ich blickte in ihr bleiches, abgezehrtes aber ruhiges Gesicht. Sie schien so wenig verändert, dass meine Furcht augenblicklich schwand.
»Bist du’s wirklich, Jane?« fragte sie mit ihrer gewohnten, sanften Stimme.
»Ah!« dachte ich, »sie wird nicht sterben; sie irren sich alle; wäre es der Fall, so könnte sie nicht so ruhig, so friedlich aussehen; das wäre nicht möglich.«
Ich ging an ihr Bett und küsste sie; ihre Stirn war kalt und ihre Wange war kalt und abgezehrt, und ihre Hände und ihre Arme ebenfalls; aber ihr Lächeln war das alte geblieben.
»Weshalb kommst du hierher, Jane? Es ist schon nach elf Uhr; ich habe es vor einigen Minuten schlagen hören.«
»Ich kam um dich zu sehen, Helen. Ich hörte, du seist sehr krank, und ich konnte nicht einschlafen, bevor ich noch einmal mit dir gesprochen hatte.«
»Du bist also gekommen, um mir Lebewohl zu sagen: wahrscheinlich bist du gerade noch zu rechter Zeit gekommen.«
»Willst du fort, Helen? Willst du etwa nach Hause.«
»Ja, nach Hause – in meine letzte, meine ewige Heimat!«
»Nein, nein, Helen«, unterbrach ich sie jammernd. Während ich versuchte, meiner Tränen Herr zu werden, hatte Helen einen heftigen Hustenanfall; indessen weckte dieser die Krankenwärterin nicht; als er vorüber, lag sie einige Minuten ganz erschöpft da; dann flüsterte sie:
»Jane, deine kleinen Füße sind nackt; lege dich zu mir ins Bett und decke dich mit meiner Decke zu.«
Ich tat es; sie schlang ihren Arm um mich, und ich schmiegte mich dicht an sie. Nach langem Schweigen fuhr sie flüsternd fort:
»Ich bin sehr glücklich, Jane; und wenn du hörst, dass ich gestorben bin, so musst du mir versprechen, nicht zu trauern; denn es ist nichts zu betrauern. Wir alle müssen ja eines Tages sterben, und die Krankheit, die mich fortrafft, ist nicht schmerzhaft; sie schreitet langsam und schmerzlos fort; mein Gemüt ist in Frieden. Ich hinterlasse niemanden, der mich betrauert. Ich habe nur einen Vater; er hat sich vor kurzem wieder verheiratet und wird mich nicht vermissen. Ich sterbe jung – aber ich werde auch vielen Leiden entgehen. Ich hatte keine Eigenschaften, keine Talente, die mir geholfen hätten, einen guten Weg durch die Welt zu machen. Fortwährend würde ich das Verkehrte getan haben.«
»Aber wohin gehst du denn, Helen? Kannst du es sehen? Kannst du glauben?«
»Ich glaube; – ich habe die feste Zuversicht: ich gehe zu Gott.«
»Wo ist Gott? Was ist Gott?«
»Mein Schöpfer und der deine, der niemals zerstören kann, was er geschaffen hat. Ich glaube fest an seine Macht und vertraue seiner Allgüte. Ich zähle die Stunden bis zu jener großen, bedeutungsvollen, die mich ihm zurückgeben soll, ihn mir von Angesicht zu Angesicht zeigen wird.«
»Du bist also sicher, Helen, dass es ein Etwas gibt, das sich Himmel nennt; und dass unsere Seelen dorthin gehen werden, wenn wir sterben?«
»Ich bin sicher, dass es ein künftiges Leben gibt; ich glaube, dass Gott gut ist; ich gebe ihm mein unsterbliches Teil vertrauensvoll hin. Gott ist mein Vater; Gott ist mein Freund, ich liebe ihn; ich glaube, dass er mich liebt.«
»Und werde ich dich wiedersehen, Helen, wenn ich sterbe?«
»Du wirst in dieselben Regionen der Glückseligkeit kommen wie ich; derselbe mächtige Allvater wird auch dich an sein Herz nehmen, Jane, zweifle nicht daran.«
Wiederum fragte ich, doch dieses Mal nur in Gedanken, »wo sind jene Regionen? Sind sie wirklich?« Und fester schlang ich meine Arme um Helen; sie war mir in diesem Augenblick teurer denn je; mir war, als könne ich sie nicht fortgehen lassen; ich verbarg mein Gesicht an ihrer Brust. Gleich darauf sagte sie in ihrer süßesten Weise:
»Wie wohl ich mich fühle! Jener letzte Hustenanfall hat mich ein wenig ermüdet; mir ist, als könnte ich jetzt schlafen; aber verlass mich nicht, Jane; es ist so schön, dich so nahe zu wissen.«
»Ich bleibe bei dir, süße Helen; niemand soll mich von hier fortnehmen.«
»Ist dir warm, mein Liebling?«
»Ja.«
»Gute Nacht, Jane.«
»Gute Nacht, Helen.«
Sie küsste mich und ich küsste sie: bald schliefen wir beide.
Als ich erwachte, war es Tag. Eine ungewöhnliche Bewegung weckte mich; ich öffnete die Augen; jemand hielt mich in den Armen; es war die Krankenwärterin; sie trug mich durch die Korridore in den Schlafsaal zurück. Man erteilte mir keinen Verweis dafür, dass ich mein Bett verlassen hatte; die Leute hatten an andere Dinge zu denken. Auf meine vielen Fragen gab man mir damals keine Erklärungen; aber einige Tage später erfuhr ich, dass Miss Temple, als sie in ihr Zimmer zurückgekehrt, mich in dem kleinen Bette gefunden habe; mein Gesicht ruhte auf Helen Burns Schulter, meine Arme umschlangen ihren Hals. Ich schlief, und Helen war – tot.
Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhofe von Brocklebridge; noch fünfzehn Jahre nach ihrem Tode deckte es nur ein einfacher Grashügel. Jetzt bezeichnet eine graue Marmortafel die Stelle; darauf steht ihr Name und das Wort: »Resurgam.«