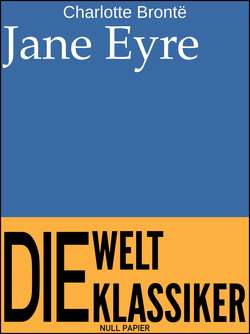Читать книгу Jane Eyre - Шарлотта Бронте, Charlotte Bront - Страница 19
Elftes Kapitel
ОглавлениеEin neues Kapitel in einem Roman ist mit einem neuen Akt in einem Schauspiel zu vergleichen; wenn ich den Vorhang wiederum in die Höhe ziehe, lieber Leser, musst du dir vorstellen, dass du ein Zimmer im »Georgs Wirtshaus« in Millcote siehst, mit so großblumigen Tapeten an den Wänden, wie Gasthauszimmer sie gewöhnlich aufweisen; mit dazu passenden Teppichen, Möbeln, Nippesfiguren auf dem Kamin, Kupferstichen, einem Porträt von Georg III., einem zweiten des Prinzen von Wales, und einer Darstellung vom Tode des General Wolfe. Und alles dies siehst du bei dem Schein einer Öllampe, welche von der Decke herabhängt, und dem eines hellen Kaminfeuers, neben welchem ich in Mantel und Hut sitze; mein Muff und Regenschirm liegen auf dem Tische, und ich versuche, mich an der Wärme des Ofens von der Steifheit und Betäubung zu erholen, welche eine sechszehnstündige Reise in kaltem Oktoberwetter bei mir hervorgerufen hatte; um vier Uhr morgens hatte ich Lowton verlassen und die Stadtuhr von Millcote schlug jetzt gerade die achte Stunde.
Lieber Leser, wenn es auch den Anschein hat, als ob ich mich ganz behaglich fühlte, so befindet mein Gemüt sich doch durchaus in keiner beneidenswerten Verfassung. Ich hatte gehofft, hier bei Ankunft der Postkutsche jemanden zu meinen Empfange bereit zu finden. Als ich die hölzerne Treppe hinabstieg, welche der Hausknecht zu meiner größeren Bequemlichkeit an den Wagen gestellt, blickte ich ängstlich umher, in der Erwartung, meinen Namen von irgendjemandem aussprechen zu hören und einen Wagen zu erblicken, welcher meiner harrte, um mich nach Thornfield zu bringen. Aber nichts derartiges war sichtbar, und als ich den Kellner fragte, ob jemand da gewesen, um sich nach Miss Eyre zu erkundigen, wurde meine Frage verneinend beantwortet. So blieb mir also nichts anderes übrig, als zu verlangen, dass man mir ein Privatzimmer anweise – und hier sitze ich nun, während Furcht und Zweifel aller Art meine Seele martern.
Für die unerfahrene Jugend ist es ein seltsames Gefühl, sich plötzlich ganz allein in der Welt zu sehen – von allen Bekannten getrennt – ungewiss, ob sie in den Hafen, für welchen sie bestimmt ist, einlaufen kann und durch tausend Schwierigkeiten verhindert, in den sicheren Port, aus welchem sie ausgelaufen, zurückzukehren. Der Reiz der Neuheit, die Freude am Abenteuerlichen versüßt dies Gefühl, das Bewusstsein der Selbstständigkeit erwärmt es – aber die Empfindung der Furcht dämpft es – und kaum war eine halbe Stunde vergangen, in welcher ich noch immer allein war, so wurde das Gefühl der Furcht durchaus vorherrschend. Da fiel es mir ein, dem Kellner zu läuten.
»Ist hier in der Nähe ein Ort, welcher Thornfield heißt?« fragte ich den Aufwärter, welcher auf mein Klingeln erschienen war.
»Thornfield? Ich weiß nicht, Madame; ich werde mich in der Schenkstube erkundigen.« Er verschwand, kam aber augenblicklich zurück:
»Ist Ihr Name Eyre, Miss?«
»Ja.«
»Es wartet jemand auf Sie.«
Ich sprang auf, griff nach Muff und Regenschirm und eilte in den Korridor des Gasthauses. Ein Mann stand in der offenen Tür und auf der von Laternen erhellten Straße konnte ich die Umrisse eines einspännigen Gefährts unterscheiden.
»Dies ist wohl Ihr Gepäck?« sagte der Mann in der Tür hastig, als er meiner ansichtig wurde, und zeigte auf meinen Koffer, der im Gange stand.
»Ja.« Er hisste ihn auf den Wagen, welcher eine Art von Karren war, hinauf, und dann stieg ich nach. Ehe er die Tür hinter mir zuschlug, fragte ich, wie weit es bis Thornfield sei.
»Eine Sache von sechs Meilen.«
»Und wie lange fahren wir?«
»Vielleicht anderthalb Stunden!«
Er schloss die Wagentür, kletterte auf seinen Sitz, und wir fuhren ab. Langsam kamen wir vorwärts, und ich hatte reichliche Muße zum Nachdenken. Ich war zufrieden, dem Endziel meiner Reise so nahe zu sein, und als ich mich in das bequeme, wenn auch durchaus nicht elegante Gefährt zurücklehnte, gab ich mich ungestört meinen Gedanken hin.
»Nach der Einfachheit und der Anspruchslosigkeit des Dieners und des Wagens zu urteilen, ist Mrs. Fairfax keine sehr elegante Person; umso besser; ich habe nur einmal unter feinen Leuten gelebt und bei ihnen habe ich mich sehr unglücklich gefühlt. Ich möchte wissen, ob sie mit diesem kleinen Mädchen ganz allein lebt. Wenn das der Fall und sie auch nur einigermaßen liebenswürdig ist, werde ich sehr gut mit ihr fertig werden. Ich werde mein Bestes tun. Aber wie schade, dass es nicht immer genügt, sein Bestes zu tun. In Lowood allerdings fasste ich diesen Entschluss, führte ihn aus, und es gelang mir, allen zu gefallen; aber bei Mrs. Reed erinnere ich mich, dass selbst mein Bestes immer nur Hohn und Verachtung hervorrief. Ich flehe zu Gott, dass Mrs. Fairfax keine zweite Mrs. Reed sein möge. Wenn sie es aber ist, so brauche ich nicht bei ihr zu bleiben. Kommt das Schlimmste zum Schlimmen, so kann ich ja immer noch wieder eine Annonce in den Herald rücken lassen. – Wie weit wir jetzt wohl schon auf dem Wege sein mögen?«
Ich ließ das Fenster herab und blickte hinaus. Millcote lag hinter uns; nach der Anzahl seiner Lichter schien es ein Ort von beträchtlicher Größe, viel größer als Lowton. So weit ich es überblicken konnte, befanden wir uns jetzt auf einer Art Weide; aber über den ganzen Distrikt lagen Häuser zerstreut; ich fühlte, dass wir uns in Regionen befanden, welche sehr verschieden von denen Lowoods; sie waren bevölkerter, aber weniger malerisch; sehr belebt, aber weniger romantisch.
Die Straßen waren kotig, die Nacht war nebelig; mein Kutscher ließ sein Pferd fortwährend im Schritt gehen, und ich glaube, dass aus den anderthalb Stunden mindestens zwei wurden. Endlich wandte er sich um und sagte:
»Jetzt sind wir nicht mehr weit von Thornfield.«
Wieder blickte ich hinaus; wir fuhren an einer Kirche vorüber; ich sah den niedrigen, breiten Turm sich gegen den Himmel abzeichnen, seine Glocken verkündeten die Viertelstunde; dann sah ich auch eine schmale Reihe von Lichtern auf einer Anhöhe; es war ein Dorf oder ein Weiler. Nach ungefähr zehn Minuten stieg der Kutscher ab und öffnete eine Pforte; wir fuhren hindurch und sie schlug hinter uns zu. Jetzt kamen wir langsam über den großen Fahrweg des Parks und fuhren an der langen Front eines Hauses entlang; aus einem verhängten Bogenfenster fiel ein Lichtschein; alle übrigen waren dunkel. Der Wagen hielt vor der Haustür. Eine Dienerin öffnete dieselbe; ich stieg aus und ging hinein.
»Bitte, diesen Weg, Fräulein«, sagte das Mädchen, und ich folgte ihr durch eine viereckige Halle, in welche von allen Seiten Türen mündeten. Sie führte mich in ein Zimmer, dessen doppelte Illumination durch Kerzen und Kaminfeuer mich im ersten Augenblick blendete, denn sie kontrastierte zu stark mit der Dunkelheit, an welche meine Augen sich während der letzten Stunden gewöhnt hatten. Als ich jedoch imstande war, wieder zu sehen, bot sich meinen Blicken ein gemütliches und angenehmes Bild dar.
Ein hübsches, sauberes, kleines Zimmer, ein runder Tisch an einem lustig lodernden Kaminfeuer; ein hochlehniger, altmodischer Lehnstuhl, in welchem die denkbar zierlichste, ältere Dame saß. Sie trug eine Witwenhaube, ein schwarzes Seidenkleid und eine schneeweiße Muslinschürze: gerade so wie ich mir Mrs. Fairfax vorgestellt hatte, nur weniger stattlich und viel milder und gütiger aussehend. Sie war mit Stricken beschäftigt; eine große Katze lag schnurrend zu ihren Füßen, – kurzum, nichts fehlte, um das beau-idéal häuslichen Komforts zu vervollständigen. Eine angenehmere Introduktion für eine neue Gouvernante ließ sich kaum denken; keine Erhabenheit, die überwältigte, keine Herablassung, die in Verlegenheit setzte. Als ich eintrat, erhob die alte Dame sich und kam mir schnell und freundlich entgegen.
»Wie geht es Ihnen, meine Liebe? Ich fürchte, dass Sie eine sehr langweilige Fahrt gehabt haben. John fährt so langsam; es muss Ihnen aber kalt sein, kommen Sie ans Feuer.«
»Mrs. Fairfax vermutlich?« fragte ich.
»Die bin ich. Bitte, nehmen Sie Platz.«
Sie führte mich zu ihrem eigenen Stuhl und dort begann sie, mir meinen Shawl abzunehmen und meine Hutbänder zu lösen. Ich bat sie, sich meinetwegen nicht so viel Umstände zu machen.
»O, das sind keine Umstände. Ihre eigenen Hände müssen vor Kälte ja ganz erstarrt sein. Leah, bereite ein wenig heißen Negus und streiche ein paar Butterbrote; hier sind die Schlüssel zur Speisekammer.«
Bei diesen Worten zog sie ein hausfräuliches Bund Schlüssel aus ihrer Tasche und übergab es der Dienerin.
»Und jetzt rücken Sie näher an das Feuer«, fuhr sie fort. »Nicht wahr, meine Liebe, Sie haben Ihr Gepäck mitgebracht?«
»Jawohl, Madame.«
»Ich werde dafür sorgen, dass man es auf Ihr Zimmer trägt«, sagte sie und trippelte geschäftig hinaus.
»Sie behandelt mich wie einen Gast«, dachte ich. »Solch einen Empfang habe ich wahrlich nicht erwartet; ich sah nichts als Kälte und Steifheit voraus; dies gleicht wenig den Erzählungen, die ich von der Behandlung der Gouvernanten gehört habe; – aber ich darf nicht zu früh jubeln.«
Sie kehrte zurück; mit ihren eigenen Händen räumte sie ihren Strickstrumpfapparat und mehre Bücher vom Tische, um Platz für das Speisenbrett zu machen, welches Leah jetzt brachte, und dann reichte sie selbst mir die Erfrischungen. Ich ward ein wenig verwirrt, als ich mich in dieser Weise zum Gegenstand so zarter, ungewohnter Aufmerksamkeiten gemacht sah, und das noch obendrein von meiner Brotherrin; da sie selbst aber garnicht zu finden schien, dass sie etwas tat, was ihr nicht zukam, hielt ich es für das Beste, ihre Liebenswürdigkeit ruhig hinzunehmen.
»Werde ich das Vergnügen haben, Miss Fairfax noch heute Abend zu sehen?« fragte ich, nachdem ich von dem genossen hatte, was sie mir vorgesetzt.
»Was sagten Sie, meine Liebe? Ich bin ein wenig taub«, entgegnete die gute Dame, indem sie ihr Ohr meinem Munde näherte.
Deutlicher wiederholte ich die Frage.
»Miss Fairfax? O, Sie meinen Miss Varens! Varens ist der Name Ihrer künftigen Schülerin.«
»In der Tat? Dann ist sie also nicht Ihre Tochter?«
»Nein. – Ich habe keine Familie.«
Eigentlich hätte ich meiner ersten Frage noch einige andere folgen lassen sollen und mich erkundigen, in welcher Weise Miss Varens denn mit ihr verwandt sei; aber ich erinnerte mich glücklicherweise noch zu rechter Zeit, dass es nicht höflich sei, so viele Fragen zu stellen; überdies wusste ich ja, dass ich mit der Zeit wohl alles erfahren würde.
»Ich bin so froh« – fuhr sie fort, als sie sich mir gegenüber setzte und die Katze auf ihren Schoß nahm, »ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. Jetzt wird das Leben hier mit einer Gefährtin ganz angenehm sein. Nun, es ist auch wohl zu allen Zeiten angenehm, denn Thornfield ist ein prächtiger alter Herrensitz; während der letzten Jahre ist es allerdings ein wenig vernachlässigt worden, aber immerhin ist es ein stattlicher Ort; aber Sie wissen wohl, selbst in dem schönsten Hause fühlt man sich zur Winterszeit unglücklich, wenn man ganz allein ist. Ich sage allein – Leah ist gewiss ein liebes Mädchen, und John und sein Weib sind anständige, brave Leute; aber sehen Sie, es sind doch immer nur Dienstboten und man kann nicht mit ihnen wie mit seinesgleichen verkehren; man muss sie sich immer zehn Schritte vom Leibe halten aus Furcht, seine Autorität zu verlieren. Sie können mir glauben, im letzten Winter – er war sehr strenge, wenn Sie sich erinnern können, und wenn es nicht schneite, tobte der Wind und es regnete – kam vom November bis zum Februar nicht eine lebende Seele in dies Haus, mit Ausnahme des Schlächters und des Postboten; und ich wurde wahrhaftig ganz melancholisch, wie ich so Abend für Abend allein dasaß. Allerdings musste Leah mir zuweilen vorlesen, aber ich fürchte, dass das arme Mädchen von dieser Aufgabe nicht sonderlich entzückt war; sie kam sich dabei wohl wie eine Gefangene vor. Im Frühling und Sommer ging es dann natürlich besser. Sonnenschein und lange Tage machen einen so großen Unterschied. Und nun zu Anfang dieses Herbstes kam die kleine Adèle Varens mit ihrer Wärterin; ein Kind bringt sofort Leben ins Haus, und jetzt, da auch Sie hier sind, werden wir am Ende gar noch ganz lustig und vergnügt werden.«
Als ich die würdige alte Dame so plaudern hörte, schlug mein Herz ihr warm entgegen; ich zog meinen Stuhl näher an den ihren und sprach den aufrichtigen Wunsch aus, dass meine Gesellschaft sich wirklich als so angenehm für sie erweisen möge, als sie erwartete.
»Heute Abend will ich Sie aber nicht lange wach halten«, sagte sie; »es ist jetzt Schlag zwölf Uhr, und Sie sind den ganzen Tag unterwegs gewesen; Sie müssen ja todmüde sein. Sobald Ihre Füße ordentlich erwärmt sind, will ich Ihnen Ihr Schlafzimmer zeigen. Ich habe das Gemach, welches an das meine stößt, für Sie herrichten lassen; es ist nur ein kleines Zimmer, aber ich meinte, dass es Ihnen lieber sein würde, als eins der großen Vorderzimmer; allerdings haben diese prächtigere Möbeln, aber sie sind so düster und einsam; ich könnte niemals darin schlafen.«
Ich dankte ihr für ihre rücksichtsvolle Wahl, und da ich mich von der langen Reise wirklich ermüdet fühlte, zeigte ich mich bereit, mich auf mein Zimmer zurückzuziehen. Sie nahm ihr Licht, und ich folgte ihr auf den Korridor hinaus. Zuerst ging sie, um sich zu überzeugen, ob die große Haustür auch wirklich verschlossen sei; nachdem sie den Schlüssel aus dem Schlosse gezogen, führte sie mich die Treppe hinauf. Stufen und Geländersäulen waren von Eichenholz; das Treppenfenster war hoch und vergittert; sowohl dieses, wie die lange Galerie, auf welche die Schlafzimmertüren hinausgingen, sahen aus als gehörten sie zu einer Kirche und nicht zu einem Hause. Eine feuchte, dumpfige Luft wie in einem Gewölbe herrschte auf der Treppe, wie in der Galerie, – eine Luft, die den Gedanken an trostlos öde Räume und düstere Einsamkeit wachrief, – und ich war froh, als ich endlich in mein Zimmer trat und fand, dass es von kleinen Dimensionen und in gewöhnlich modernem Stil möbliert sei.
Als Mrs. Fairfax mir eine herzliche Gutenacht gewünscht, und ich meine Tür sorgsam verschlossen hatte, sah ich mich mit Muße um; der Anblick meines behaglichen, kleinen Zimmers löschte bis zu einem gewissen Grade den Eindruck aus, welchen die weite Halle, die düstere, große Treppe und jene lange, kalte Galerie auf mich gemacht hatten, und endlich kam es mir zum Bewusstsein, dass ich mich nach ein paar Tagen körperlicher Ermüdung und geistiger Erregung nun endlich in einem sicheren Hafen befinden würde. Der Impuls der Dankbarkeit schwellte mein Herz, ich kniete neben meinem Bette nieder und sandte ein inniges Dankgebet zu dem empor, dem ich Dank schuldete; und bevor ich mich wieder erhob, vergaß ich nicht, weitere Hilfe für meinen Pfad zu erflehen, und um die Gabe zu bitten, mich der Güte wert machen zu können, welche mir in so reichem Maße zu teil wurde, bevor ich sie noch hatte verdienen können. In dieser Nacht lag ich auf keinem Dornenlager; mein einsames Zimmer war von Ruhe und Frieden erfüllt. Zugleich müde und zufrieden, schlief ich bald und fest ein. Als ich erwachte, war es bereits heller Tag.
In dem Sonnenschein, welcher durch die hellblauen Zitzfenstervorhänge fiel, erschien mir mein Zimmer so freundlich und gemütlich; ich wurde fast mutig bei dem Anblick der tapezierten Wände und des teppichbelegten Fußbodens, welche den buntfarbigen Kalkwänden und nackten Holzböden in Lowood so unähnlich waren. Äußerlichkeiten üben einen so großen Einfluss auf die Jugend. Mir war, als müsse jetzt eine schönere Lebensära für mich anbrechen, eine Ära, welche neben ihren Dornen und Mühseligkeiten auch ihre Blüten und Freuden haben würde. All meine Seelenkräfte schienen durch die Ortsveränderung, durch das neue Feld, welches sich für meine Hoffnungen öffnete, wieder lebendig geworden. Ich könnte nicht genau definieren, was sie erwarteten, aber es war eben etwas freudiges: nicht vielleicht gerade für einen bestimmten Tag oder Monat, sondern für irgend eine unbestimmte Zeit in der Zukunft.
Ich erhob mich. Mit großer Sorgfalt kleidete ich mich an. Wenn ich auch gezwungen war, einfach zu sein – ich hatte kein einziges Kleidungsstück, welches nicht in der einfachsten Weise gemacht wäre – so hatte ich doch von Natur das größte Verlangen, sauber und nett auszusehen. Es war durchaus nicht meine Gewohnheit, achtlos in Bezug auf mein Äußeres oder unbekümmert um den Eindruck zu sein, welchen ich hervorbrachte, – im Gegenteil, ich wünschte stets, so hübsch wie möglich zu sein und so sehr zu gefallen, wie mein gänzlicher Mangel an Schönheit es gestattete. Wie oft bedauerte ich, nicht hübscher zu sein! Wie innig wünschte ich, rosige Wangen, eine gerade Nase und einen kleinen Kirschenmund zu besitzen; ich hätte schlank und stattlich, von imposanter Figur sein mögen; ich empfand es wie ein Unglück, so klein und bleich zu sein, so unregelmäßige, markierte Züge zu haben. Aber weshalb hatte ich diese Wünsche, dies Verlangen? Dieses Bedauern? Das wäre schwierig gewesen zu sagen. Damals hätte ich selbst mir keine klare Rechenschaft darüber geben können. Indessen hatte ich einen Grund, und einen logischen, natürlichen noch dazu. – Als ich jedoch mein Haar sehr sorgsam gekämmt und mein schwarzes Kleid angezogen hatte, welches trotz seiner Quäkerhaftigkeit das Verdienst hatte, aufs genauste zu passen, – als ich eine reine, weiße Halskrause umgebunden, glaubte ich sauber und respektabel genug auszusehen, um vor Mrs. Fairfax erscheinen zu können. Von meiner Schülerin hoffte ich, dass sie wenigstens nicht mit Widerwillen vor mir zurückschrecken werde. Nachdem ich das Fenster geöffnet und gesehen hatte, dass ich auf dem Toiletttische alles sauber und ordentlich zurückließ, wagte ich mich hinaus.
Nachdem ich die lange, mit Teppichen bedeckte Galerie entlang gegangen war, stieg ich die glänzend blanke Eichentreppe hinunter; dann kam ich in die Halle; hier stand ich eine Minute still; ich betrachtete einige Kupferstiche an den Wänden, – noch heute erinnere ich mich derselben, das eine stellte einen finster aussehenden Mann in einem Küraß dar; das andere eine Dame mit gepuderten Haaren und einem Perlhalsband – eine Bronzelampe, welche von der Decke herabhing, eine große, alte Wanduhr, deren Gehäuse aus Eichenholz seltsam geschnitzt und durch die Zeit schwarz und blank wie Ebenholz geworden war. Alles erschien mir sehr stattlich und imposant – aber ich war ja auch so wenig an Glanz und Pracht gewöhnt. Die Tür der Halle, welche halb aus Glas war, stand offen; ich überschritt die Schwelle. Es war ein herrlicher Herbstmorgen; die Sonne schien klar auf herbstlich gefärbtes Laub und noch immer frische Felder herab; ich ging auf den freien Platz hinaus und betrachtete die Front des Herrenhauses. Es war drei Stockwerke hoch, von großen, obgleich nicht überwältigenden Proportionen, der Herrensitz eines Gentleman, nicht die feste Burg eines Edelmannes; Zinnen auf dem Dache gaben dem Hause ein pittoreskes Aussehen. Die graue Front hob sich hübsch von dem Hintergrunde eines Krähengenistes, dessen krächzende Bewohner jetzt flügge waren; sie flogen über den Grasplatz und den Park, um sich auf einer großen Weide niederzulassen, von welcher erstere durch einen eingesunkenen Zaun getrennt waren; auf dieser Wiese stand eine lange Reihe alter, starker, knorriger Dornenbäume, mächtig wie Eichen, welche sofort die Etymologie der Benennung des Herrenhauses erklärten.1 In der Ferne waren Hügel, nicht so hoch wie jene um Lowood, nicht so zackig, nicht so ähnlich Barrieren, welche einen von der übrigen Welt abschlossen, aber doch stille, einsame Hügel, welche Thornfield eine Abgeschiedenheit verliehen, die ich in der lebhaft bewegten Nähe Millcotes niemals vermutet hätte. Ein kleiner Weiler, dessen Dächer von Bäumen überschattet waren, zog sich an einem der Hügel hinauf; die Kirche des Distrikts stand näher an Thornfield, ihr alter Turm sah über einen Hügel zwischen dem Hause und den Parkpforten hervor.
Ich erfreute mich noch an der friedlichen Aussicht und an der frischen, angenehmen Luft, horchte noch mit Entzücken auf das Gekrächze der Krähen, blickte noch auf die große, von der Zeit geschwärzte Front der Halle und dachte bei mir, welch ein weitläufiger Aufenthalt es für eine einzelne kleine Dame wie Mrs. Fairfax sei, als diese Dame in der Tür erschien.
»Was? schon draußen?« sagte sie. »Ich sehe, Sie sind gewöhnt früh aufzustehen.« Ich ging zu ihr und wurde mit einem Kusse und einem herzlichen Händedruck bewillkommnet.
»Wie gefällt Ihnen Thornfield?« fragte sie. Ich sagte ihr, dass ich es sehr schön fände.
»Ja«, sagte sie, »es ist ein reizender Ort; aber ich fürchte, es wird vernachlässigt werden, wenn Mr. Rochester es sich nicht in den Kopf setzt, herzukommen und permanent hier zu residieren, oder es wenigstens häufiger zu besuchen. Große Häuser und schöne Parks erfordern die Anwesenheit ihres Besitzers.«
»Mr. Rochester!« rief ich aus. »Wer ist das?«
»Der Besitzer von Thornfield«, antwortete sie ruhig. »Wussten Sie nicht, dass er Rochester heißt?«
Natürlich wusste ich das nicht – ich hatte ja noch niemals von ihm gehört; aber die alte Dame schien sein Dasein für ein so allgemein bekanntes Faktum zu halten, dass jedermann es schon instinktiv kennen musste.
»Ich glaubte«, fuhr ich fort, »dass Thornfield Ihr Eigentum sei.«
»Mein Eigentum? Gott segne Sie, Kind! Welche eine Idee! Mein Eigentum? Ich bin nur die Haushälterin, die Verwalterin. Allerdings bin ich durch die Familie seiner Mutter entfernt mit den Rochesters verwandt, oder wenigstens war mein Gatte es: er war ein Geistlicher, Pfründenbesitzer von Hay – jenes kleine Dorf da drüben auf dem Hügel – und die Kirche neben der Parkpforte war die seine. Die Mutter des jetzigen Mr. Rochester war eine Fairfax und meines Mannes Cousine im zweiten Grade; aber ich tue mir auf diese Verwandtschaft niemals etwas zu Gute und erlaube mir deshalb keine Freiheiten – in der Tat, ich mache mir gar nichts daraus; ich betrachte mich selbst in dem Lichte einer ganz gewöhnlichen Haushälterin; mein Brotherr ist immer höflich, und mehr erwarte ich nicht.«
»Und das kleine Mädchen – meine Schülerin?«
»Sie ist Mr. Rochesters Mündel; er beauftragte mich, eine Gouvernante für sie zu suchen. Ich glaube, dass er die Absicht hegt, sie in …shire erziehen zu lassen. Da kommt sie mit ihrer ›Bonne‹, wie sie ihre Wärterin nennt.«
Das Rätsel war also gelöst; diese freundliche, gütige, kleine Witwe war keine große Dame, sondern eine Untergebene wie ich selbst. Deshalb war sie mir nicht weniger lieb; im Gegenteil, ich fühlte mich wohliger als zuvor. Die Gleichheit zwischen ihr und mir bestand wirklich, – sie war nicht das Resultat bloßer Herablassung von ihrer Seite. Umso besser – meine Stellung war deshalb umso viel freier.
Während ich noch über diese Entdeckung nachdachte, kam ein kleines Mädchen, welchem eine Wärterin folgte, über den Grasplatz daher gelaufen. Ich betrachtete meine Schülerin, welche mich anfangs nicht zu bemerken schien. Sie war noch ein Kind, vielleicht sieben oder acht Jahre alt, zart gebaut, blass mit kleinen Gesichtszügen und einem Überfluss von Haar, das in Locken über die Schultern wallte.
»Guten Morgen, Miss Adela«, sagte Mrs. Fairfax. »Kommen Sie her und sprechen Sie mit dieser Dame, welche Ihre Lehrerin sein wird, damit Sie eines Tages eine gescheite Dame werden.« Die Kleine kam näher.
»C’est là ma gouvernante?« fragte sie zu ihrer Wärterin gewendet auf mich zeigend; diese antwortete:
»Mais oui, certainement.«
»Sind sie Ausländer?« fragte ich, ganz erstaunt, die französische Sprache zu hören.
»Die Wärterin ist eine Ausländerin und Adela wurde auf dem Kontinent geboren; ich glaube auch, dass sie bis vor sechs Monaten dort verblieb. Als sie zuerst herkam, konnte sie kein Wort englisch sprechen; jetzt hat sie es so weit gebracht, ein wenig sprechen zu können; ich verstehe sie nicht, sie vermischt es so sehr mit dem Französischen; aber ich vermute, dass Sie sehr gut begreifen werden, was sie meint.«
Zum Glück hatte ich den Vorteil gehabt, französisch von einer Französin zu lernen; und da ich es mir stets hatte angelegen sein lassen, so viel wie möglich mit Madame Pierrot zu reden und überdies während der letzten sieben Jahre täglich mehrere Seiten französisch auswendig gelernt hatte, war es mir möglich geworden, mir einen Grad der Fertigkeit und der Korrektheit in der Sprache anzueignen, welcher mich in den Stand setzte, mit Mademoiselle Adèle gleichen Schritt zu halten.
Als sie hörte, dass ich ihre Gouvernante sei, kam sie auf mich zugelaufen und reichte mir die Hand; dann führte ich sie in das Frühstückszimmer und richtete einige Worte in ihrer Muttersprache an sie; im Anfang antwortete sie sehr kurz, aber nachdem wir am Tische Platz genommen hatten und sie mich ungefähr zehn Minuten mit ihren großen hellbraunen Augen angesehen hatte, begann sie plötzlich ganz geläufig zu plaudern.
»Ach«, rief sie auf französisch aus, »Sie sprechen meine Muttersprache ebenso gut wie Mr. Rochester, ich kann mit Ihnen reden wie mit ihm, und Sophie kann es auch. Sie wird glücklich sein; hier kann niemand sie verstehen, Madame Fairfax ist durch und durch englisch. Sophie ist meine Wärterin; sie ist mit mir über das Meer gekommen in einem großen Schiffe mit einem Schornstein, der rauchte – und wie er rauchte! – und ich war krank, und Sophie war es auch und Mr. Rochester auch. Mr. Rochester legte sich auf ein Sofa in einem hübschen Zimmer, das Salon genannt wurde, und Sophie und ich hatten kleine Betten in einem anderen Zimmer. Beinahe wäre ich aus dem meinen heraus gefallen, es war ganz wie ein Brett. Und, Mademoiselle – wie heißen Sie doch?«
»Eyre – Jane Eyre.«
»Aire? Bah! Das kann ich nicht aussprechen. Nun also weiter: gegen Morgen, der Tag war noch nicht ganz angebrochen, hielt unser Schiff bei einer großen Stadt an – bei einer enorm großen Stadt, mit sehr düsteren Häusern, die ganz von Rauch geschwärzt waren; sie hatte gar keine Ähnlichkeit mit der sauberen, hübschen Stadt, aus welcher ich kam. Und Mr. Rochester trug mich auf seinen Armen über ein Brett ans Land, und Sophie kam hinterher; dann stiegen wir alle in einen Wagen, der uns bis an ein großes, prächtiges Haus brachte, viel größer und viel, viel schöner als dieses, und es hieß ein ›Hotel‹. Dort blieben wir beinahe eine Woche. Sophie und ich gingen oft auf einem großen, grünen Platz voller Bäumen umher, den sie ›Park‹ nannten. Außer mir waren noch viele, viele Kinder dort, und ein Teich mit prachtvollen Vögeln darauf, die ich oft mit Brotkrumen gefüttert habe.«
»Können Sie sie denn eigentlich verstehen, wenn sie so schnell plappert?« fragte Mrs. Fairfax.
Ich verstand sie sehr gut, denn ich war an Madame Pierrots geläufige Zunge gewöhnt.
Dann fuhr die gute, alte Dame fort: »ich möchte gern, dass Sie ein paar Fragen über ihre Eltern an sie richteten; es soll mich doch wundern, ob sie sich ihrer noch erinnert?«
»Adèle«, fragte ich, »mit wem hast du in jener hübschen, sauberen Stadt gewohnt, von welcher du mir erzählt hast?«
»Mit meiner Mama, aber das ist schon lange her; sie ist zur heiligen Jungfrau gegangen. Mama hat mich auch tanzen und singen und schöne Verse hersagen gelehrt. Viele Herren und Damen kamen stets, um Mama zu besuchen, und dann pflegte ich ihnen etwas vorzutanzen oder vorzusingen. Oft nahmen sie mich auf den Schoß, und ich sagte ihnen Gedichte her. Wollen Sie mich jetzt auch singen hören?«
Sie war mit ihrem Frühstück zu Ende, und deshalb erlaubte ich ihr, mir eine Probe ihres Talents zu geben. Sie kletterte von ihrem Stuhl herunter und kam zu mir, um sich auf meinen Schoß zu setzen; dann faltete sie ernsthaft ihre kleinen Hände, warf ihre Locken zurück, heftete ihre Augen auf die Decke des Zimmers und begann, eine Melodie aus irgend einer Oper zu singen. Es war ein Lied von einer verlassenen Frau, welche anfangs die Treulosigkeit ihres Geliebten beweint und dann ihren Stolz zu Hilfe ruft; darauf befiehlt sie ihrer Begleiterin, ihr die schönsten Gewänder und ihre prächtigsten Juwelen zu bringen und beschließt, dem Falschen am Abend auf einem Balle zu begegnen und ihm durch ihre Fröhlichkeit zu beweisen, wie wenig seine Treulosigkeit sie ergriffen hat.
Das Lied schien seltsam gewählt für eine so kindliche Sängerin; aber ich vermute, dass der Schwerpunkt dieser Produktion darin lag, diese Töne und Worte der Liebe und Eifersucht von den Lippen des Kindes zu hören; und sehr geschmacklos schien mir diese Pointe zu sein.
Adèle sang die Canzonette ganz geschmackvoll und mit der Naivetät ihrer Jahre. Nachdem sie damit zu Ende, sprang sie von meinem Schoße herab und sagte: »Jetzt, Mademoiselle, will ich Ihnen etwas vordeklamieren.«
Dann nahm sie eine Attitüde an und begann »la ligue des rats; fable de Là Fontaine.« Nun deklamierte sie das kleine Stück mit einer Achtsamkeit auf die Interpunktion und Betonung, einer Biegsamkeit der Stimme und einer Zartheit der Bewegungen, welche in ihren Jahren allerdings ungewöhnlich waren und deutlich bewiesen, dass sie sorgsam trainiert worden war.
»Hat deine Mama dich dieses Gedicht gelehrt?« fragte ich.
»Ja, und sie pflegte immer so zu sagen: ›Où avez-vous donc? lui dit un de ces rats; parlez!‹ Und dann ließ sie mich meine Hand aufheben – so – um mich daran zu erinnern, dass ich die Stimme erheben müsse bei der Frage. Soll ich Ihnen jetzt etwas vortanzen?«
»Nein. Jetzt ist es genug. Aber bei wem wohntest du, als deine Mama zur heiligen Jungfrau gegangen war, wie du sagst?«
»Bei Madame Frederic und ihrem Manne; sie hat mich gepflegt und für mich gesorgt, aber sie ist nicht mit mir verwandt. Ich glaube, dass sie arm ist, denn sie hatte kein so schönes Haus wie Mama. Ich war nicht lange dort. Mr. Rochester kam und fragte mich, ob ich mit ihm nach England gehen und bei ihm bleiben möchte, und ich sagte Ja. Denn ich kannte Mr. Rochester, bevor ich Madame Frederic kannte, und er war immer gütig gegen mich und schenkte mir schöne Kleider und hübsche Spielsachen. Aber Sie sehen, er hat nicht Wort gehalten, denn er hat mich nach England gebracht, aber er selbst ist wieder fortgegangen, und jetzt sehe ich ihn nie mehr.«
Nach dem Frühstück zog ich mich mit Adèle in die Bibliothek zurück; wie es schien, hatte Mr. Rochester bestimmt, dass dieser Raum als Schulzimmer benutzt werden sollte. Die Mehrzahl der Bücher war in Glasschränken verschlossen; aber ein Bücherschrank, welcher offen stand, enthielt alles, was für den elementaren Unterricht gebraucht wurde, und verschiedene Bände der leichteren Litteratur, Poesie, Biografie, Reisebeschreibungen, einige Romanzen u.s.w. Ich vermute, dass er der Ansicht gewesen, dies sei alles, was eine Gouvernante für ihre Privatlektüre brauche, und in der Tat genügten sie mir vollauf für den Augenblick; im Vergleich zu den kärglichen Samenkörnchen, welche ich dann und wann in Lowood zu finden imstande gewesen, schienen diese Bände mir eine reiche, goldene Ernte in Unterhaltung und Belehrung zu bieten. In diesem Zimmer befand sich auch ein ganz neues Klavier von herrlichem Ton; außerdem eine Staffelei und mehrere Erdkugeln.
Ich fand meine Schülerin außerordentlich liebenswürdig, aber sehr zerstreut. Sie war niemals an eine regelmäßige Beschäftigung irgendwelcher Art gewöhnt gewesen. Ich fühlte, dass es nicht ratsam sein würde, sie im Anfang zu sehr mit Arbeit zu überhäufen; deshalb erlaubte ich ihr, als aus dem Morgen Mittag geworden war, und ich viel zu ihr gesprochen und sie ein wenig hatte lernen lassen, zu ihrer Wärterin zurückzukehren. Und dann nahm ich mir vor, bis zur Stunde des Mittagessens einige kleine Skizzen für ihren Gebrauch zu zeichnen.
Als ich hinauf ging, um mein Skizzenbuch und meine Zeichenstifte zu holen, rief Mrs. Fairfax mir zu: »Ihre Morgenschulstunden sind jetzt vorüber, wie ich vermute.« Sie befand sich in einem Zimmer, dessen Flügeltüren weit geöffnet waren; als sie mich anredete, ging ich hinein. Es war ein großes, stattliches Gemach, mit purpurfarbigen Möbeln und Vorhängen, einem türkischen Teppich, nussholzbekleideten Wänden, einem großen buntfarbigen Fenster und einer reich geschnitzten Decke. Mrs. Fairfax wischte den Staub von einigen Vasen aus herrlichem Rubinglas, welche auf einer Kredenz standen.
»Welch ein prächtiges Zimmer«, rief ich aus, indem ich umher blickte, denn ich hatte noch nichts gesehen, was auch nur halb so schön gewesen wäre.
»Ja, dies ist das Speisezimmer. Ich habe soeben das Fenster geöffnet, um ein wenig Luft und Sonnenschein herein zu lassen, denn in Zimmern, die selten bewohnt werden, wird alles feucht und dumpfig. Drüben im großen Salon ist es gerade wie in einem Gewölbe.«
Sie deutete auf einen großen Bogen, welcher dem Fenster gegenüber lag und mit persischen Vorhängen, die in Festons aufgerafft waren, dekoriert war. Als ich zwei breite Stufen, welche zu demselben hinaufführten, erstiegen hatte, war mir’s, als täte ich einen Blick ins Feenreich; so herrlich erschien meinem Novizenblick der Anblick, welcher sich ihm darbot. Und doch war es nichts als ein sehr hübscher Salon mit einem Boudoir; beide waren mit weißen Teppichen belegt, die mit bunten Blumenguirlanden bedeckt schienen; die Decke war reich mit schneeigem Stuck bedeckt, welcher weiße Weintrauben und Blätter darstellte; seltsam kontrastierten damit die feuerroten Stühle und Ottomanen. Die Zierrate, welche den Kaminsims aus weißem, carrarischem Marmor schmückten, bestanden aus funkelndem, rubinrotem, böhmischem Glas, und in den Spiegeln zwischen den Fenstern wiederholte sich die allgemeine Mischung von Schnee und Feuer.
»Wie schön Sie diese Zimmer in Ordnung halten, Mrs. Fairfax!« rief ich. »Kein Staub, keine Überzüge aus Glanzleinwand. Man könnte wirklich glauben, dass sie täglich bewohnt würden, wenn die Luft nicht ein wenig gruftartig wäre.«
»Nun, Miss Eyre, wenn Mr. Rochesters Besuche hier auch nur selten sind, so kommen sie ebenfalls stets unerwartet und plötzlich; und da ich bemerkt habe, dass es ihn stets schlechter Laune macht, wenn er alles eingehüllt findet und mitten in die Geschäftigkeit des Räumens hineinkommt, so dachte ich mir, es sei das Beste, die Zimmer stets in Bereitschaft zu halten.«
»Ist Mr. Rochester ein strenger und kleinlicher Herr?« fragte ich.
»Nicht gerade das; aber er hat die Neigungen und Gewohnheiten eines Gentleman und er erwartet, dass alle Dinge sich dem anpassen.«
»Lieben Sie ihn? Ist er allgemein beliebt?«
»O ja. Die Familie hat hier stets in großer Hochachtung gestanden. Seit Menschengedenken hat alles Land in der Gegend, so weit das Auge reicht, den Rochesters gehört.«
»Gut; aber lieben Sie ihn, ganz abgesehen von seinen Besitzungen? Lieben Sie ihn um seiner selbst willen?«
»Ich habe keine Ursache, etwas anderes zu tun, als ihn zu lieben, und ich glaube auch, dass seine Pächter und Untergebenen ihn als einen freigebigen und gerechten Gebieter betrachten; aber er hat niemals viel unter ihnen gelebt.«
»Aber hat er keine Eigentümlichkeiten? Kurz und gut, wie ist sein Charakter?«
»O, sein Charakter ist fleckenlos. Das glaube ich wenigstens. Vielleicht ist er in manchen Dingen ein klein wenig seltsam; ich vermute, dass er viel gereist ist und viel von der Welt gesehen hat. Ich glaube auch, dass er sehr gescheit ist, aber ich habe niemals Gelegenheit gehabt, mich viel mit ihm zu unterhalten.«
»In welcher Weise ist er denn seltsam?«
»Ich weiß es nicht. Das ist nicht so leicht zu beschreiben – nichts besonders auffallendes, aber man fühlt es, wenn man mit ihm spricht. Man weiß niemals, ob er im Scherz oder im Ernst redet, ob er sich freut oder ob er sich ärgert. Kurzum, man versteht ihn nicht recht – wenigstens ich verstehe ihn nicht. Aber das schadet ja nicht; er ist ein sehr guter Herr und Gebieter.«
Dies war alles, was ich von Mrs. Fairfax über ihren Brotherrn und den meinen erfahren konnte. Es gibt Leute, welche meist nicht imstande zu sein scheinen, einen Charakter beschreiben zu können und die weder bei Menschen noch bei Dingen hervorragende Eigenschaften und Eigentümlichkeiten bemerken, – und augenscheinlich gehörte die gute Dame zu diesen; meine Fragen verblüfften sie, brachten sie aber nicht zum Sprechen. Mr. Rochester war in ihren Augen Mr. Rochester, ein Gentleman, ein Gutsbesitzer – nichts anderes; sie fragte und suchte nicht weiter und wunderte sich augenscheinlich über meinen Wunsch, einen bestimmteren Begriff seiner Persönlichkeit zu bekommen.
Als wir das Speisezimmer verließen, schlug sie mir vor, mir den übrigen Teil des Hauses zu zeigen; und ich folgte ihr treppauf, treppab und bewunderte alles im Gehen, denn alles war schön und geschmackvoll arrangiert. Besonders die großen Zimmer an der Vorderseite des Hauses erschienen mir prächtig und imposant, und einige der Zimmer des dritten Stocks, obgleich düster und niedrig, waren interessant durch ihr altertümliches Aussehen. Die Möbel, welche einst für die unteren Gemächer angeschafft worden, waren je nach den Anforderungen der Mode von Zeit zu Zeit hier herauf geschafft, und das unsichere Licht, welches durch die niederen Fenster eindrang, fiel auf Bettstellen, welche mehr als ein Jahrhundert zählten; Truhen aus Nuss- und Eichenholz sahen mit ihren seltsamen Schnitzereien von Palmenzweigen und Engelsköpfen aus wie die Typen der Arche Noah; Reihen von ehrwürdigen Stühlen mit schmalen und hohen Lehnen; noch ältere Lehnstühle, auf deren gepolsterten Lehnen noch Spuren halbverwitterter Stickereien, welche vor zwei Generationen von Fingern gearbeitet waren, die längst im Grabe moderten. All diese Reliquien verliehen dem dritten Stockwerk von Thornfield-Hall das Aussehen eines Heims der Vergangenheit, eines Schreins der Erinnerungen. Ich liebte die Ruhe, das Dämmerlicht, die Eigentümlichkeit dieser Räume während der Tageszeit; aber ich wünschte mir durchaus nicht das Vergnügen einer Nachtruhe auf diesen großen und schweren Betten, deren einige durch Türen von Eichenholz abgeschlossen, andere mit schweren alten Vorhängen von englischer Arbeit verdeckt waren, deren Muster seltsame Blumen und noch seltsamere Vögel und die allerseltsamsten menschlichen Gestalten darstellten – wie seltsam würden erst all diese Dinge im bleichen Mondlicht ausgesehen haben!
»Schlafen die Diener in diesen Zimmern?« fragte ich.
»Nein, sie bewohnen eine Reihe kleinerer Gemächer an der Hinterseite des Hauses; hier schläft niemand; man möchte beinahe glauben, dass wenn wir in Thornfield-Hall einen Geist hätten, dies sein Schlupfwinkel wäre.«
»Das glaube ich auch. Sie haben also keinen Geist hier?«
»Ich habe wenigstens niemals davon gehört«, entgegnete Mrs. Fairfax lächelnd.
»Auch keine darauf bezügliche Tradition? Keine Legenden, keine Geistergeschichten?«
»Ich glaube nicht. Und doch sagt man, dass die Rochesters ihrer Zeit ein mehr streitsüchtiges als friedliebendes Geschlecht gewesen. Aber vielleicht ist gerade das der Grund, weshalb sie jetzt ruhig in ihren Gräbern liegen.«
»Ja, ja – sie ruhen aus nach dem verzehrenden Fieber des Lebens«, murmelte ich. – »Wohin gehen Sie denn jetzt, Mrs. Fairfax?« denn sie ging weiter.
»Hinauf auf das Dach; wollen Sie mit mir gehen, um die Aussicht von dort zu genießen?« Ich folgte ihr über eine sehr enge Treppe zu den Bodenkammern hinauf, und von dort über eine Leiter und durch eine Falltür auf das Dach des Herrenhauses. Ich befand mich jetzt auf gleicher Höhe mit der Krähenkolonie und konnte einen Blick in ihre Nester werfen. Als ich mich über die Zinnen lehnte und weit hinunter blickte, sah ich den Park und die Gärten wie eine Landkarte vor mir liegen; der helle, wie Samt geschorne Rasen, der sich dicht um das graue Fundament des Hauses zog; die Felder und Wiesen, auf denen hier und da große Haufen von starkem Bauholz lagen; der ernste, düstere Wald, durch welchen sich ein Fußsteig zog, dessen Moos grüner war als das Laub der Bäume; die Kirche an der Parkpforte; die Landstraße; die Hügel, welche majestätisch und ruhig in das klare Sonnenlicht des Herbsttages hineinragten; der weite, tiefblaue, mit leichten Federwölkchen besäete Himmelsbogen, das ganze vor mir liegende Bild hatte keinen besonders hervorragenden Zug, aber es war lieblich und wohlgefällig. Als ich mein Auge von demselben abwandte und wieder durch die Falltür hinabstieg, konnte ich kaum meinen Weg über die Leiter hinunter finden; im Vergleich mit dem blauen Himmelsbogen, zu dem ich empor geblickt hatte, erschien die Bodenkammer finster wie ein Gewölbe; düster wie ein Grab nach jenem sonnigen Bilde des Parkes, der Weiden und grünen Hügel, dessen Mittelpunkt das Herrenhaus war, und das ich soeben noch mit Wonne betrachtet hatte.
Mrs. Fairfax blieb einen Augenblick zurück, um die Falltür zu schließen; ich tastete mich an den Ausgang der Bodentür und begann dann die enge Bodentreppe hinunter zu steigen. In dem langen Korridor, welcher zu dieser führte, und die Vorderzimmer und Hinterzimmer der dritten Etage trennte, hielt ich inne; schmal, lang und dunkel, mit einem einzigen kleinen Fenster am äußersten Ende, sah er mit seinen beiden Reihen kleiner, niedriger, schwarzer Türen aus wie ein Korridor in Ritter Blaubarts Schloss.
Als ich dann leise vorwärts schritt, schlug das letzte Geräusch, welches ich in diesen Regionen erwartet haben würde – ein lautes Lachen – an mein Ohr. Es war ein seltsames Lachen, deutlich, förmlich, freudlos. Ich stand still. Der Ton verhallte; doch nur für einen Augenblick; dann begann das Lachen von neuem, lauter, denn anfangs war es, wenn auch deutlich, doch nur leise gewesen. Es endigte mit lautem Schall, welcher in jedem einsamen Zimmer ein Echo zu wecken schien; es drang aber nur aus einem einzigen, und ich hätte die Tür bezeichnen können, aus welcher die Töne kamen.
»Mrs. Fairfax!« schrie ich auf, denn jetzt hörte ich sie die große Treppe herabkommen. »Haben Sie das laute Lachen gehört? Woher kommt es? Wer war es?«
»Wahrscheinlich einige der Dienstmädchen«, entgegnete sie, »vielleicht Grace Poole.«
»Haben Sie es auch gehört?« fragte ich wieder.
»Ja, ganz deutlich. Ich höre sie oft, sie näht in einem dieser Zimmer. Zuweilen ist Leah bei ihr; sie machen oft großen Lärm miteinander.«
Wiederum ertönte das leise, eintönige, schaurige Lachen, es endigte mit einem seltsamen Gemurmel.
»Grace!« rief Mrs. Fairfax.
Ich erwartete wirklich nicht, dass irgend eine Grace auf diesen Ruf antworten werde; denn das Lachen klang so tragisch, so unnatürlich, so überirdisch wie ich noch niemals eins vernommen; und wenn nicht heller Mittag gewesen wäre, und kein gespenstischer Umstand die seltsamen Laute begleitete – wenn es nicht gewesen wäre, dass weder Zeit noch Ort die Gespensterfurcht begünstigten, so würde ich mich abergläubischer Furcht hingegeben haben. Der Vorfall zeigte mir indessen, dass ich eine Närrin war, mich auch nur überraschen zu lassen.
Die Tür, neben welcher ich stand, öffnete sich und eine Dienerin trat heraus; sie war eine Frau zwischen dreißig und vierzig, eine untersetzte, knochige Gestalt mit rotem Haar und einem harten, hässlichen Gesicht; eine weniger romantische oder geisterhafte Erscheinung ließ sich kaum denken.
»Zu viel Lärm, Grace«, sagte Mrs. Fairfax, »vergiss deine Weisungen nicht!« Ohne ein Wort zu sagen, machte Grace einen Knix und ging wieder ins Zimmer.
»Sie ist eine Person, die wir hier haben, um zu nähen und Leah bei ihrer Hausarbeit zu helfen«, fuhr die Witwe fort, »in manchen Dingen ist sie nicht ganz vorwurfsfrei, aber sie genügt uns. Aber ehe ich’s vergesse, wie waren Sie heute Morgen mit Ihrer Schülerin zufrieden?«
So kam das Gespräch auf Adèle und wir fuhren fort, über sie zu sprechen, bis wir die sonnigeren, fröhlicheren Regionen des untern Stockwerks erreicht hatten. Adèle kam uns in der Halle entgegen gelaufen und rief:
»Mesdames, vous êtes servies!« Dann fügte sie lachend hinzu: »J’ai bien faim, moi!«
In Mrs. Fairfax Zimmer fanden wir die Mahlzeit angerichtet, welche bereits unserer harrte.
1 Thornfield = Dornenfeld <<<