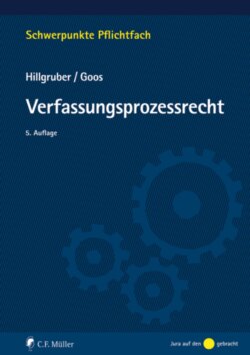Читать книгу Verfassungsprozessrecht - Christian Hillgruber - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI. Das Verhältnis des Bundesverfassungsgerichts zum Gesetzgeber
Оглавление37
Bei dem Spannungsverhältnis zwischen BVerfG und Gesetzgeber geht es um die Gegenläufigkeit von politischer Rechtsetzungsmacht einerseits und der verfassungsgerichtlichen Befugnis andererseits, in Normenkontrollverfahren Gesetze des Parlaments außer Kraft zu setzen, sofern und soweit diese dem GG widersprechen. Ein solches richterliches Prüfungs- und Verwerfungsrecht am Maßstab der Verfassung verändert die Gewaltenbalance zum Nachteil der gesetzgebenden Körperschaften; ihre Rolle im Prozess der Verfassungskonkretisierung reduziert sich auf die eines „gestaltende[n] Erstinterpret[en]“[42] und Erstanwenders der Verfassung (vgl BVerfGE 101, 158, 236). Zwar folgt schon aus dem Vorrang der Verfassung gewissermaßen spiegelbildlich der Nachrang des Gesetzes; aber erst das Letztentscheidungsrecht des BVerfG auch hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit vom Parlament erlassener Gesetze führt dazu, dass das Parlament nur noch das Recht des ersten interpretativen Zugriffs auf die Verfassung hat, in der „Vorhand“ ist, aber sich der maßgeblichen Letztinterpretation der Verfassung durch das kontrollierende BVerfG ausgesetzt und unterworfen sieht. Nicht nur der Gesetzgeber, der sich in unzulässiger Weise seiner verfassungsrechtlichen Bindungen entledigen will, sondern auch der redliche, die offenen und daher häufig mehrdeutigen Verfassungsbestimmungen lege artis auslegende Gesetzgeber sieht seine Verfassungsinterpretation durch das letzte Wort, das dem BVerfG gehört, überspielt („overruling“). Dieses Ergebnis tritt häufig ein, weil das BVerfG die verfassungsinterpretierende und -konkretisierende Staatspraxis anderer Staatsorgane bei der Auslegung der diese verpflichtenden Verfassungsbestimmungen nur äußerst selten berücksichtigt oder gar als für die Auslegungsfrage präjudiziell beachtet (vgl ausnahmsweise BVerfGE 62, 1, 1 f (LS 4), 38 f zu Art. 68 GG – Bundestagsauflösung 1983)[43].
38
Das BVerfG garantiert den Vorrang der Verfassung (Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG) auch vor dem Willen der demokratischen Mehrheit. Diese verfassungsgerichtliche Kontrolle schränkt die demokratisch legitimierte Entscheidungsmacht des Gesetzgebers effektiv ein. Auch und gerade gegenüber dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber kommt dem BVerfG das entscheidende letzte Wort in Verfassungsfragen zu[44]. Dabei ist das BVerfG zwar an die Verfassung als seinen Prüfungsmaßstab gebunden, aber die Auslegung dieses Maßstabes liegt in seiner eigenen Hand. Nichts anderes meint der berühmte Ausspruch des amerikanischen Chief Justice Charles E. Hughes aus dem Jahre 1907: „We are under a constitution, but the constitution is what the judges say it is“[45].
39
Der politische Handlungs- und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers kann durch engmaschige verfassungsgerichtliche Vorgaben in Konkretisierung der vagen verfassungsrechtlichen Vorgaben empfindlich beschnitten werden[46]. Gegen die verbindliche Verfassungsinterpretation des BVerfG kann sich die demokratische Mehrheit jedoch nicht durch Rechtsverwahrung wehren[47]. Ihr kann nur der verfassungsändernde Gesetzgeber mit qualifizierter Mehrheit (Art. 79 Abs. 2 GG) wirksam entgegentreten. In dieser Konstellation droht die demokratische Mehrheit entmachtet zu werden. Daher erhebt sich die Frage, wie der verfassungsrechtlich gebundene demokratische Souverän wieder in sein Recht gesetzt und wie verhindert werden kann, dass die demokratische Willensbildung des Volkes ihre entscheidende Bedeutung verliert. Gesetzgeberische Gestaltung darf nicht zum bloßen Verfassungsvollzug nach Maßgabe diesbezüglicher Anweisungen durch das BVerfG degradiert werden. Im Kern geht es also um die Frage nach den Grenzen der Grenzen der Demokratie.
40
Es besteht die Gefahr einer schleichenden, durch extensive Verfassungsinterpretation bewirkten „Veränderung des vom Grundgesetz festgelegten gewaltenteiligen Verhältnisses zwischen Gesetzgeber und Verfassungsgericht“, die Gefahr eines Einbruchs des BVerfG in den originären Kompetenzbereich des Gesetzgebers (vgl BVerfGE 93, 121, 151 f – SV Böckenförde; siehe auch BVerfGE 135, 1, 29, 32 – SV Masing: „Zu entscheiden, was Recht sein soll, ist im demokratischen Rechtsstaat grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, der hierfür gewählt wird und sich in einem politischen Prozess vor der Öffentlichkeit verantworten muss.“
41
Wie kann die Gefahr gebannt werden? Wo liegt die Grenze der Verfassungsgerichtsbarkeit? Umfang und Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit werden durch den dem BVerfG durch das Grundgesetz und auf dessen Grundlage erteilten Kontrollauftrag bestimmt. Seine Funktionsgrenze wird durch seine auf die Verfassung als Prüfungsmaßstab begrenzte Kompetenz gezogen: „Denn richterliche Entscheidungen sind als Entscheidungen durch Amtsträger, die der Bürger durch die Ausübung seines Wahlrechts weder unmittelbar noch mittelbar zur Verantwortung ziehen kann, vor dem Demokratie- und dem Gewaltenteilungsprinzip nur als Entscheidungen nach rechtlichen Regeln gerechtfertigt“ (Sondervotum Lübbe-Wolff, BVerfGE 134, 366, 419, 421).
42
Das BVerfG wahrt also den eigenständigen Funktionsbereich der anderen Verfassungsorgane, wenn es sich – entsprechend seinem Kontrollauftrag – darauf beschränkt nachzuprüfen, ob sich die zu kontrollierenden Staatsgewalten, auch der Gesetzgeber, innerhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen gehalten haben, die das GG als verfassungsrechtliche Rahmenordnung der ihnen im Übrigen zukommenden Gestaltungsfreiheit gezogen hat. „Allein dort, wo verfassungsrechtliche Maßstäbe für politisches Verhalten normiert sind, kann das BVerfG ihrer Verletzung entgegentreten“ (BVerfGE 62, 1, 51). Die Kognitionskompetenz des BVerfG ist wie alles richterliche Entscheiden auf „determinationskräftige rechtliche Maßstäbe“ angewiesen (Sondervotum Lübbe-Wolff, BVerfGE 134, 366, 419, 421). Im Ergebnis sind damit genuin politische Fragen von der verfassungsgerichtlichen Befassung ausgenommen, wie dies die vom BVerfG nicht übernommene political-question-Doktrin postuliert.
43
Soweit verfassungsrechtliche Maßstäbe existent sind, kann das BVerfG sich dieser ihm aufgetragenen Kontrollfunktion aber auch nicht entziehen. Kompetenzen sind zugleich Wahrnehmungspflichten. Die Grenze der Verfassungsgerichtsbarkeit liegt genau dort, wo es an (Verfassungs-)Rechtsnormen fehlt[48]. Es besteht also ein unauflöslicher Zusammenhang zwischen der Funktion und Kompetenz der Verfassungsgerichtsbarkeit und dem ihr zugewiesenen Prüfungsmaßstab des materiellen Verfassungsrechts: Das BVerfG hält sich im Rahmen der ihm von der Verfassung aufgetragenen Funktion immer dann, wenn es nicht selbst Politik betreibt, sondern die ihm zugewiesenen Kontrollaufgabe ausschließlich am Maßstab der Verfassung vornimmt, also seiner Funktion als Gericht gerecht wird.
44
Aus der Maßgeblichkeit der Verfassung als Prüfungsmaßstab des BVerfG folgt, dass nicht das Gericht, sondern – gegebenenfalls – die Verfassung selbst entweder zurückhaltend oder fordernd ist. Nicht das BVerfG erkennt die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers zu oder an, sondern das GG selbst[49]. Die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers ist mit anderen Worten das, was nach Abzug der verfassungsrechtlichen Bindungen, die das BVerfG erkennt, an verfassungsrechtlicher Ungebundenheit übrig bleibt. Das Problem verlagert sich damit (wieder) auf die dem BVerfG aufgegebene Auslegung des Grundgesetzes; sie kann zurückhaltend(er) ausfallen oder extensiv(er) betrieben werden. Je nach dem verbleibt dem Gesetzgeber mehr oder weniger freier Gestaltungsspielraum, dem Gesetz mehr oder weniger Selbstand gegenüber der Verfassung.
45
Dagegen führt die in der Literatur propagierte Unterscheidung von Handlungs- und Kontrollnormen im Bereich der Verfassung in die Irre. Handlungs- und Kontrollnorm sind nur zwei Seiten ein und derselben Medaille. Das, was aus der Sicht des in Pflicht genommenen Staats- und Verfassungsorgans als eine an ihn gerichtete „Handlungsnorm“ erscheint, stellt für das BVerfG die maßstäbliche Kontrollnorm dar, an der es das Handeln oder Unterlassen staatlicher Organe zu messen hat. Handlungs- und Kontrollnormen weisen daher keine inhaltlichen Unterschiede aus. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Reichweite der Bindung der zur Anwendung des Verfassungsrechts primär berufenen Verfassungsorgane einerseits und dem Umfang der verfassungsgerichtlichen Nachprüfung andererseits. Das GG enthält dafür jedenfalls keinen Anhaltspunkt[50]. Vielmehr weist es dem BVerfG in den ihm zur Entscheidung zugewiesenen Verfahren uneingeschränkt die Aufgabe zu, die Verletzung verfassungsrechtlich geschützter Rechtspositionen oder die Vereinbarkeit staatlicher Maßnahmen mit der gesamten Verfassung zu überprüfen. Die verfassungsgerichtliche Prüfung ist deshalb so intensiv wie die materielle verfassungsrechtliche Bindung. Die einzelnen, mit Bindungswirkung ausgestatteten Verfassungsbestimmungen unterscheiden sich aber in ihrer normativen Regelungsdichte. Für jede Norm der Verfassung ist gesondert zu ermitteln, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sie Beurteilungs- und Handlungsspielräume der zuständigen staatlichen Organe schafft und anerkennt, die verfassungsgerichtlicher Nachprüfung nur auf Einhaltung des verbindlich gesetzten Rahmens unterliegen. Die innerhalb dieses Rahmens zu treffenden Entscheidungen sind – verfassungsrechtlich nicht determiniert – politischer Natur und entziehen sich damit der nur am Maßstab des Grundgesetzes orientierten Rechtsprüfung durch das BVerfG.
46
Nicht unproblematisch ist auch die These von der gebotenen Selbstbeschränkung des Gerichts (judicial self-restraint)[51], die das BVerfG selbst aufgegriffen hat (BVerfGE 36, 1, 14). Die „Beschränkung“, der das BVerfG unterliegt, ist die auf eine gerichtsförmige Rechtskontrolle[52] am Maßstab der Verfassung, dh eine Beschränkung auf die ihm zugewiesenen Entscheidungskompetenzen[53]. Der Begriff der Selbstbeschränkung suggeriert dagegen, dass das BVerfG großzügigerweise auf die Ausübung einer Kompetenz verzichtet, die ihm eigentlich zustünde. Das aber wäre unzulässig. Anders formuliert: „Selbstbeschränkung setzt Selbstermächtigung voraus […] Nichtentscheidung trotz gegebener Entscheidungszuständigkeit ist für ein Gericht Kompetenzüberschreitung“[54]. Andererseits kann angesichts der verfassungsrechtlich vorgegebenen Kompetenzordnung in der Tat nur das mit der Letztentscheidungsbefugnis und dem Recht zur verbindlichen Auslegung des Grundgesetzes ausgestattete BVerfG selbst, also der „unkontrollierte Kontrolleur“ verhindern, dass der Gesetzgeber seine Eigenständigkeit einbüßt, und zwar durch sachgerechte, das gewaltenteilige System des Grundgesetzes im Auge behaltende Auslegung. Das BVerfG darf nicht der Versuchung erliegen, die verfassungsrechtlichen Anforderungen, denen auch die demokratische Mehrheit ihren politischen Willen unterordnen muss, zu überdehnen und ein „gouvernement des juges“ zu errichten. Je mehr Sachentscheidungen nämlich durch autoritative Verfassungsinterpretation seitens des BVerfG als verfassungsrechtlich determiniert gelten, umso weniger Entfaltungsraum verbleibt für den demokratisch legitimierten politischen Prozess. Hier geht es indes letztlich um „amtsethische Erwartungen an das BVerfG“, um einen Appell an das staatspolitische Verantwortungsbewusstsein des BVerfG, nicht dagegen um eine verfahrensrechtlich bestimmbare, „einklagbare“ Funktionsgrenze (zu den Schwierigkeiten der Bestimmung des genauen „Grenzverlaufs“ siehe auch Sondervotum Lübbe-Wolff, BVerfGE 134, 366, 419, 421).
47
Der Vorrang gesetzgeberischer Gestaltungsfreiheit außerhalb des Kernbereichs des durch die Verfassung unabstimmbar Vorgegebenen beruht auf der Erwägung, dass in einem demokratischen Gemeinwesen vor allem der durch das Volk unmittelbar legitimierte parlamentarische Gesetzgeber dazu berufen ist, im öffentlichen Willensbildungsprozess unter Abwägung der verschiedenen, widerstreitenden Interessen nach dem Mehrheitsprinzip über die von der Verfassung offen gelassenen Fragen zu entscheiden (BVerfGE 33, 125, 159; 35, 79, 148, 152 f – abweichende Meinung; 85, 386, 403 f). Dies ist die Logik der parlamentarischen Demokratie, die der parlamentarischen Mehrheit auf Zeit Handlungsvollmacht und politische Verantwortung zuweist. Soll ihr nicht die Verantwortung abgenommen werden, darf ihr auch nicht die Handlungsvollmacht entzogen werden, auch nicht durch das BVerfG. In diesem Sinne muss denn doch vom BVerfG eine gewisse Selbstbeschränkung eingefordert werden; „judicial activism“ ist jedenfalls genau genommen nichts anderes als „political activism“ und als solcher unzulässige Kompetenzüberschreitung durch das BVerfG.
48
Die Gefahr, dass das BVerfG im Gewande der Verfassungsauslegung in Wahrheit Politik betreibt, ist jedenfalls größer als die umgekehrte, oft beschworene Gefahr einer Selbstentmachtung des Parlaments durch Juridifizierung und Justizialisierung der Politik. Zwar wird häufig der Vorwurf erhoben, die Politik stelle sich nicht ihrer Verantwortung und schiebe notwendige Entscheidungen, zu denen sie sich selbst nicht durchringen kann, dem BVerfG zu. Aber das immer wieder beklagte „Abschieben“ ungelöster politischer Fragen an das BVerfG nach Karlsruhe ist so gar nicht möglich. Dem BVerfG können zulässigerweise nur Verfassungsstreitigkeiten unterbreitet werden. Das BVerfG kann und darf in den vorgesehenen Verfahrensarten von den danach Antragsberechtigten mit dem Ziel angerufen werden, eine – je nach Verfahrensart – mehr oder weniger umfassende Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit der Ausübung von Staatsgewalt durch das BVerfG durchführen zu lassen. Beschränkt sich das zulässigerweise angerufene Verfassungsgericht sodann auf eine solche Rechtmäßigkeitskontrolle am Maßstab der Verfassung, so erfüllt es genau die ihm zugewiesene Aufgabe als „Hüter der Verfassung“. Problematisch wird es erst dann, wenn das BVerfG den ihm vorgegebenen, exklusiven Prüfungsmaßstab der Verfassung durch extensive Auslegung anreichert, so dass der Handlungsspielraum der Politik wegen des Primats der Verfassung und der Bindung aller Staatsgewalt an die Entscheidungen des BVerfG über Gebühr eingeschränkt wird, wenn also unter dem Deckmantel der Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit der Sache nach Politik betrieben wird. Dies darf das BVerfG nämlich gerade nicht tun. Es kann und muss sich darauf beschränken, nach Maßgabe des Verfassungsrechts zu entscheiden. Dagegen darf es eine ihm tatsächlich oder auch nur vermeintlich angesonnene politische Lösung weder vorschlagen noch gar verbindlich machen. Der ihm zugespielte „schwarze Peter“ ist nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes vom BVerfG an die politisch zuständigen Instanzen zurückzuschieben. Entscheidend ist also auch hier das Verhalten des BVerfG selbst: Hält es sich strikt an den ihm vorgegebenen, alleinigen Prüfungsmaßstab oder erliegt es der Versuchung, Rechtspolitik zu betreiben und als Verfassungsauslegung zu deklarieren.
49
Im Übrigen ist es verfassungsrechtlich legal und legitim, wenn eine parlamentarische Minderheit, die im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren unterlegen ist, den Versuch unternimmt, die in Berlin erlittene politische Niederlage in einen juristischen Sieg in Karlsruhe umzumünzen. Ob ihr das gelingt, hängt von der Überzeugungskraft ihrer verfassungsrechtlichen Argumentation ab, über die das BVerfG zu befinden hat. In den politischen Streit, der hier vor den Schranken des Verfassungsgerichts „mit anderen Mitteln“ fortgesetzt wird, hat es sich dabei in keiner Weise einzumischen.
50
Kann der verfassungsändernde Gesetzgeber die Mehrheitserfordernisse für eine Gesetzesnormen verwerfende Entscheidung des BVerfG abweichend von der geltenden Grundregel des § 15 Abs. 4 S. 2 BVerfGG erhöhen und damit das Gesetzesrecht in seiner Bestandskraft verstärken? Dazu dürfte ihn Art. 94 Abs. 2 S. 1 GG ohne weiteres ermächtigen. Könnte er einzelne Verfahrensarten, die de constitutione lata dem BVerfG zur Entscheidung zugewiesen sind, etwa die abstrakte Normenkontrolle streichen – zweifelsohne – oder gar – horribile dictu – die Institution des Verfassungsgerichts selbst abschaffen? Die Verfassungsbindung aller Staatsgewalt(en) gemäß Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG bedeutet jedenfalls nicht denknotwendig Unterworfenheit unter eine Verfassungsgerichtsbarkeit, und auch wenn man die erst durch gerichtliche Kontrolle hergestellte Effektivität des Vorrangs der Verfassung als nach Art. 79 Abs. 3 iVm. Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG dauerhaft garantiert ansieht[55], erfordert dies nicht unbedingt die Existenz einer organisatorisch verselbständigten Verfassungsgerichtsbarkeit. Wenn nach Abschaffung des Verfahrens der konkreten Normenkontrolle gemäß Art. 100 Abs. 1 GG entweder dezentral alle Fachgerichte oder – vorzugswürdig – in Konzentration der Normverwerfungskompetenz die obersten Bundesgerichte selbst Gesetzesverwerfung aufgrund angenommener Verfassungswidrigkeit betreiben dürften, wäre jedenfalls dem Schutz individueller Verfassungsrechte ausreichend Genüge getan. Dass das Verfassungsbeschwerdeverfahren als solches nicht verfassungsänderungsfest ist, ergibt sich schon daraus, dass es erst nachträglich (1968) im Grundgesetz verankert worden ist (Art. 93 Abs. 1 Nr 4a GG). Die dem Schutz objektiven Verfassungsrechts oder der Wahrung der Verbands- und Organkompetenzordnung dienenden Verfahrensarten dürften dagegen, auch wenn sie teilweise zum Traditionsbestand deutscher Staatsgerichtsbarkeit zählen, keinen Bestandsschutz genießen. Politisch durchsetzbar wäre die Abschaffung des BVerfG allerdings wohl kaum, nicht nur, aber auch, weil das BVerfG – in einem abstrakten Normenkontrollverfahren angerufen – die darauf zielende Verfassungsänderung selbst überprüfen könnte und müsste und dabei – ebenso unvermeidlich wie das Parlament bei der gesetzlichen Festlegung der Abgeordnetendiäten – zum iudex in causa sua würde. Kann man sich wirklich vorstellen, dass es seiner eigenen Entmachtung den letzten verfassungsgerichtlichen Segen gibt?
§ 1 Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts im Verfassungsgefüge der Bundesrepublik Deutschland › VII. Die Autorität des Bundesverfassungsgerichts