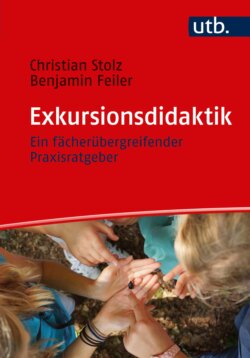Читать книгу Exkursionsdidaktik - Christian Stolz - Страница 12
2.3Lerntheoretische Grundlagen
ОглавлениеBei der methodisch-lerntheoretischen Herangehensweise muss zwischen einer klassischen „Überblicksexkursion“ und einer „Arbeitsexkursion“ unterschieden werden (Ohl & Neeb 2012: 261; Tab. 4.1, S. 33). Im Fall der Überblicksexkursion läuft die Wissensaneignung stark rezeptiv ab.
Die Erläuterung praktischer Sachverhalte durch den Exkursionsleiter oder einen externen Experten, wie z. B. bei einer Betriebsbesichtigung, findet vorrangig in Form von Frontalunterricht statt. Interaktion zwischen Lehrer und Schülern, Diskussionen, impulsgesteuerte Vertiefungen, Erfahrungsaustausch und Fragerunden sind aber auch bei diesem Ansatz in der Regel enthalten (vgl. Klein 2015: 69). Zu den Nachteilen zählen die hohe Passivität der Lernenden, der Mangel an Schüler-Schüler-Interaktion und selbstgesteuerten Zugängen zum Thema, weshalb dieser Ansatz in der Vergangenheit viel Kritik erfahren hat (vgl. Haubrich et al. 1997: 208). Dennoch ist der Typ Überblicksexkursion bis heute weitverbreitet.
Eine handlungsorientierte Arbeitsexkursion kann dagegen sowohl kognitivistische wie auch konstruktivistische Herangehensweisen beinhalten. Sie wird von den meisten Didaktikern als besonders effektiv in Bezug auf einen problemlösungsorientierten Lernprozess bewertet, was mit lernpsychologischen Prozessen begründet wird (z. B. Hemmer 1996). So können die Lernenden innerhalb eines vorgeplanten, systematischen Lernprozesses selbstständig weitgehend festgelegte Lerninhalte und Problemstellungen bearbeiten und Methoden anwenden, wobei das Lösen vorgegebener Fragestellungen im Vordergrund steht.
Lernprozesse können im Gegenzug aber auch rein selbstgesteuert verlaufen, wobei Fragestellung und Fazit ergebnisoffen sind. Vielperspektivigkeit, individuelles Denken, Kreativität, soziale Prozesse, z. B. innerhalb einer Kleingruppe, und die individuelle Prägung des Lernenden, z. B. individuelle Raumvorstellungen, erhalten dadurch eine besondere Wertschätzung (vgl. Dickel & Glasze 2009).
In der Praxis zeigt sich häufig, dass mit einer Verknüpfung beider Ansätze die größten Lernerfolge erzielt werden. Die Gewichtung kann unterschiedlich sein und ist abhängig von der Gruppenzusammensetzung, der Gruppengröße, dem Thema und dem jeweiligen Ort. Fast immer ist es sinnvoll, zunächst im Seminar, vor Ort oder an jedem Standort individuell in das Exkursionsgebiet und die zu behandelnde Problemstellung einzuführen. Danach können Elemente einer problemorientierten Arbeitsexkursion angefügt werden, über die sich die Exkursionsteilnehmer mehr oder weniger selbstbestimmt mit dem jeweiligen Ort und Thema befassen. Eine „konzeptionelle Vielfalt“ ist daher „Kennzeichen einer modernen Exkursionsdidaktik“ und bezieht Stärken und Schwächen der einzelnen Konzepte und Methoden von vorneherein mit ein (Ohl & Neeb 2012: 264).
Darüber hinaus eröffnen Exkursionen die Möglichkeit, Lehr- und Lernprozesse didaktisch so zu gestalten, dass lernpsychologisch relevante Alltagsvorstellungen hin zu fachwissenschaftlichen Sichtweisen verändert werden können. Lernende besitzen hinsichtlich bestimmter Sachverhalte meist bereits ein Alltagsverständnis und eigene Vorstellungen, die im wissenschaftlichen Kontext nicht adäquat sind und einer Veränderung bedürfen (Reinfried 2010, Felzmann 2013). Diese Vorstellungen gewinnt das kognitive System aus sensomotorischen Erfahrungen. Sie werden durch neuronale Erregungsmuster und Strukturen bestimmt, die sich durch Umweltinteraktionen, Bewegungen und Wahrnehmungen formen. Sie entsprechen Begriffen und werden als verkörperte Begriffe gekennzeichnet (Niebert 2007: 39). Diese wiederum sind mit einer funktionellen Gruppe von Neuronen gleichzusetzen, die Bestandteil des sensomotorischen Systems sind oder dessen Aufgabe nutzen (Niebert 2007: 40, Gropengießer 2007). Verkörperte Begriffe werden von uns unmittelbar verstanden. Um abstrakten Zielbereichen imaginativen Zugang zu unseren Kognitionen zu verschaffen, werden verkörperte Begriffe genutzt, die in sensomotorischen Ursprungsbereichen liegen. Daher können wir über Sinneseindrücke, die wir nicht direkt erleben, hinausgehen. Hierbei werden Vorstellungen eines Ursprungsbereichs, die auf Erfahrungen basieren, in Zielbereiche übertragen, die nicht unmittelbar erfahren werden können (Niebert 2007: 40). So bieten auf zahlreichen Themengebieten Exkursionen für Lernende eine Chance, bestimmte Sachverhalte und Realobjekte durch eigene Wahrnehmung zu erfahren. Somit ist eine weitere Aufgabe von Exkursionen, naive Vorstellungen zu wissenschaftlichen Vorstellungen zu verändern bzw. dahingehend anzupassen. Hierbei ist eine häufige Vorgehensweise die Auslösung eines kognitiven Konflikts (Horn & Schweizer 2010). Dabei wird gezielt ein Widerspruch zwischen der wissenschaftlichen Vorstellung und der Alltagsvorstellung des Lernenden erzeugt, wodurch eine Anpassung an die wissenschaftliche Sichtweise ermöglicht wird (Reinfried 2007). Hierfür eignen sich z. B. konstruktivistische Ansätze und Strategien, da dabei Handlungsorientierung und Konstruktion von Wissen im Vordergrund stehen. Dies wird jedoch auch durch mehrere Komponenten (z. B. Gruppenzusammensetzung, Interessen der Teilnehmer, Zielsetzung) beeinflusst. In Abhängigkeit vom Alter der Exkursionsteilnehmer sowie von deren Erfahrungen mit Exkursionen können diese auf unterschiedliche Art und Weise beteiligt und einbezogen werden. Die Bandbreite reicht von einem hohen Grad an Instruktion und sehr geringer Beteiligung (z. B. klassische Überblicksexkursion ohne Interaktion zwischen Exkursionsleitung und Teilnehmern) bis hin zu einem hohen Grad an Konstruktion mit hoher Eigenbeteiligung (z. B. Spurensuche ohne eindeutige Aufgabenstellung durch die Exkursionsleitung). Abschließend kann diese Art der methodischen Großform mit ihrer Möglichkeit der Integration unterschiedlicher Lehrformen und Lernmethoden aus den genannten Gründen als besonders lohnend und wertvoll eingestuft werden.
Das mithilfe von Exkursionen erworbene Wissen kann durch stattgefundene originale Begegnung und eigene Erfahrungen besser gespeichert werden. Der Begriff der „originalen Begegnung“ wurde in der Vergangenheit durchaus kritisch diskutiert, da eine originale Begegnung genau genommen nicht frei sein kann von konstruierten Mustern (Hard 1993b, Kanwischer 2006). Dass jedoch persönlich Erlebtes bei Exkursionsteilnehmern für lange Zeiträume – auch noch nach Jahren – im Gedächtnis verbleibt, belegen auch zahlreiche Praxiserfahrungen. Äußerst eindrucksvoll kann dies im Rahmen von Evaluationen oder Abschlusstreffen von Klassen oder Kursen erlebt werden. Die jeweiligen Erinnerungen hängen aber auch stark vom Alter und Interesse der Beteiligten sowie von den angewandten Methoden (inklusive Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung), der Dauer und dem Ziel ab. Bedingt durch die Komplexität kann zwar keine pauschale Erfolgsgarantie ausgesprochen werden, aber die Vorteile gegenüber anderen Lehr- und Lernmethoden sind deutlich erkennbar. Exkursionen können Inhalte so vermitteln und transportieren, dass sie sowohl fachlich als auch persönlich einen Mehrwert bieten, den andere Lehrformen und Lernmethoden teilweise nicht in diesem Maße leisten können. Dennoch bedarf es einer fachlichen und pädagogischen Abwägung, ob diese methodische Großform im konkreten Einzelfall angebracht und für die Lernenden angemessen erscheint.