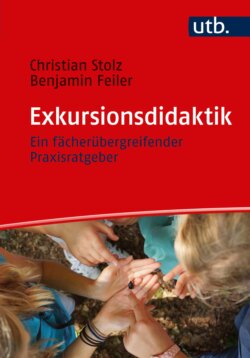Читать книгу Exkursionsdidaktik - Christian Stolz - Страница 17
4.3Die handlungsorientierte Arbeitsexkursion
ОглавлениеSeit den 1980er-Jahren ist eine starke Handlungsorientierung, „die das selbstständige und schülerorientierte Lernen forciert“, fester Bestandteil einer modernen Exkursionsdidaktik (Ohl & Neeb 2012: 265). Sie zielt darauf ab, Schüler zur eigenständigen Handlungs- und Problemlösefähigkeit zu erziehen und sie dazu anzuleiten, sich eigenverantwortlich mit den Inhalten bzw. Lerngegenständen vor Ort auseinanderzusetzen; weiterhin ermöglicht sie die aktive Wissenskonstruktion nach einem vorgegebenen Schema (Tab. 4.2). Im Rahmen einer kognitivistischen Exkursionsdidaktik werden die anzuwendenden Arbeitsmethoden klar durch den Lehrenden definiert, d. h., die Schüler oder Studierenden erhalten eine klare Aufgabenstellung. In einfacher Weise auf das Beispiel einer Wald-Exkursion bezogen könnten die Schüler z. B. den Auftrag erhalten, möglichst viele unterschiedliche Blätter und Früchte von Bäumen zu sammeln, diese einander zuzuordnen, die einzelnen Arten miteinander zu vergleichen sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Die Bearbeitung der Aufgabe erfolgt sinnvollerweise in Kleingruppen- oder Partnerarbeit. Jede Gruppe könnte dann am Ende ihre „Funde“ den anderen präsentieren. Wenn die Aufgabenstellung zuvor klar formuliert und ein grober zeitlicher Rahmen abgesteckt wurde, sind die Steuerung des Lernprozesses und das Erreichen des Lernziels in der Regel ohne weitere Probleme möglich. Wichtig ist dennoch immer, dass sich die Aufgabenstellung an der Zielgruppe orientiert, weil weder eine Über- noch eine Unterforderung zielführend ist.
Schwierigkeiten für den Exkursionsleiter ergeben sich im Gegensatz zur Überblicksexkursion dadurch, dass der Verlauf und das Gelingen der Übung nicht immer genau planbar sind. Dies hängt zum einen von den räumlichen Gegebenheiten ab, andererseits von der Motivation und der Zusammensetzung der Gruppe. Grundsätzlich sollte sich ein Lehrender während der Bearbeitung einer Aufgabe weitgehend im Hintergrund halten und nur eingreifen, wenn Schwierigkeiten auftreten, was vor allem bei lernschwächeren Schülern der Fall sein kann. Bei minderjährigen Schülern ergibt sich zudem häufig das Problem der Aufsichtspflicht, sodass manche Übungen – vor allem solche, die sich über ein größeres Areal erstrecken sollen – überhaupt nicht durchführbar sind.
Für die Lernenden kann sich hingegen der Nachteil ergeben, dass sich bei ausschließlich handlungsorientierten Elementen an einem Standort der Überblick über den Standort selbst nicht richtig erschließt. Daher sind zusätzliche Elemente nach Art einer Überblicksexkursion stets sinnvoll.
Bei der Festlegung der Gruppengröße ist es wichtig, dass während der Übung möglichst alle Gruppenmitglieder beschäftigt sind. Es ist wenig sinnvoll, wenn immer nur eine einzige Person z. B. an einem Messinstrument aktiv werden kann und vier weitere untätig daneben stehen. An eine klar durchführbare Arbeitsteilung ist also von vorneherein zu denken. In der Regel sollte die Kleingruppengröße fünf Teilnehmer nicht überschreiten, was jedoch immer stark themen- und ortsabhängig ist. Wenn die Zahl der verfügbaren Werkzeuge oder Messgeräte nicht ausreicht, ist es dennoch sinnvoll, eine möglichst kleine Gruppengröße beizubehalten, indem einzelne Gruppen Sonderaufgaben erhalten, die sich von denen der anderen Gruppen unterscheiden. Diese können je nach Örtlichkeit manchmal sogar spontan oder nach Interessenslage der Teilnehmer ausgewählt werden, sie sind häufig auf diese Weise gewinnbringend für alle. Während z. B. im Wald vier Gruppen zu je fünf Personen an unterschiedlichen Standorten im Fünf-Minuten-Rhythmus eine Stunde lang Temperatur und Windgeschwindigkeit messen, kann eine fünfte Gruppe losgeschickt werden, um Wettermarken an Bäumen, z. B. vermooste Stammseiten, zu beschreiben und zu fotografieren. Auf die Weise kann auch besonders gut auf leistungsschwächere Schüler eingegangen werden. Weitere methodische Ergänzungen, wie z. B. Gruppenpuzzles, sind bei handlungsorientierten Exkursionselementen fast immer möglich, ebenso Mischformen mit konstruktivistischen Elementen.
Natürlich sind handlungsorientierte Exkursionen immer deutlich aufwendiger in der Vorplanung. Gerade bei mehrtägigen Exkursionen und auf Klassenfahrten kann das mehrere Tage intensive Arbeit bedeuten. Zudem müssen Arbeitsblätter erstellt, gegebenenfalls Geräte und Werkzeuge besorgt bzw. zusammengestellt werden. An manchen Standorten sind zudem Genehmigungen der zuständigen Verwaltung oder von Eigentümern nötig, z. B. wenn es sich um ein Denkmal oder ein Museumsgelände handelt. In Naturschutzgebieten ist z. T. das Verlassen der Wege nicht grundsätzlich erlaubt; ebenso ist die Entnahme von Organismen und Gegenständen aus der Natur häufig genehmigungspflichtig, genau wie Bodenverletzungen jeglicher Art.
Das Fangen und Töten von Tieren durch Schüler sollte in jedem Fall ausgeschlossen werden. Das gilt auch für Hochschulexkursionen (!). Es sei denn, die Organismen können nach der Übung wieder unbeschadet in die Freiheit entlassen werden (z. B. Schnecken, Spinnentiere oder aquatische Organismen). Nicht möglich, grundsätzlich verboten und daher auch nicht zu verantworten ist dies beispielsweise bei Schmetterlingen, Kleinsäugern und Vögeln. Dasselbe gilt für geschützte Pflanzen. Auch bei häufigen Arten sollte sich die Entnahme in Grenzen halten. Das Sammeln von archäologischen Artefakten ohne fachkundigen Begleiter und amtliche Genehmigung ist ebenfalls nicht möglich und erfüllt sogar den Tatbestand einer Straftat. Dasselbe gilt für den Einsatz von Metalldetektoren. Auch Umfragen jedweder Art bedürfen in der Regel einer Genehmigung, vor allem wenn sie auf Privatgelände, wie z. B. in Einkaufszentren, stattfinden sollen. Besonders im Ausland können derartige Aktionen weitreichende juristische Folgen haben. Andererseits genügt normalerweise eine einfache, kurze E-Mail an die zuständige Behörde, um derartige Übungen anzukündigen.
In der Geographie sind handlungsorientierte Lehrinhalte im Gelände spätestens seit den 1970er-Jahren weitverbreitet. Man spricht von Geländepraktika, Lehrprojekten und Projektstudien. Dabei geht es regulär um die selbstständige Anwendung von zuvor klar definierten Methoden im Rahmen einer vorab detailliert besprochenen Fragestellung. In der naturwissenschaftlich orientierten Physischen Geographie handelt es sich in erster Linie um Messungen (z. B. meteorologische Messungen oder die standardisierte Aufnahme und Beschreibung von Sedimenten und Bodenprofilen) und in der sozialwissenschaftlich orientierten Humangeographie häufig um Befragungen oder klar definierte Kartierungen (z. B. zur Raumwahrnehmung oder zur Verbreitung von Gebäudenutzungen).
| Tab. 4.2 Kennzeichen einer handlungsorientierten Arbeitsexkursion | |
| lerntheoretische Verortung | kognitivistisch, handlungsorientiert |
| vorwiegende Methodik | Partner- und Kleingruppenarbeit |
| Lernprozess | angeleitet und/oder selbstständig, hoher Selbstbestimmungsgrad, hohe Aktivität der Lernenden |
| Lernziele | aktive Wissenskonstruktion nach vorgegebener Methodik |
Wichtige Punkte bei handlungsorientierten Arbeitsexkursionen sind:
eine klare Aufgabenstellung und ein vorgeplanter Verlauf der Übung
klare Angaben zur Art der Ergebnissicherung (z. B. Mitschriften oder Fotos machen)
ein klarer zeitlicher Rahmen
vor Beginn der Übungen Verständnisfragen klären
Die Lehrperson hält sich weitgehend im Hintergrund und greift nur bei Schwierigkeiten ein.
Die handlungsorientierte Arbeitsexkursion und mögliche fachspezifische Methoden
Messungen, Zählungen und Bestimmungsübungen: Kleine empirische Erhebungen oder Projekte eignen sich sehr gut für die Ausgestaltung handlungsorientierter Exkursionen oder als Element innerhalb methodisch breiter aufgestellter Exkursionskonzepte. Sowohl im natur- als auch im sozialwissenschaftlichen Kontext sind Messungen mittels einfacher Messgeräte oder Mess-Sets möglich (z. B. Wetter-, Wasser- und Bodenparameter, Wuchshöhen). Noch einfacher sind Zählungen (Passanten inkl. geschätzter Altersklasse, Verkehr, Einzelhandelsgeschäfte, Pflanzen, Makrozoobenthos, Geschiebe-, Flusskies- oder Strandgeröllspektren u. a.). Etwas komplizierter sind Bestimmungsübungen und komplexere empirische Methoden aus den einzelnen Fächern (z. B. krautige Pflanzen und Bäume, Feldfrüchte, Insekten, Steine, Fossilien, Korngrößen, Bodentypen, Jahrringe von Bäumen, aber auch Bodendenkmäler, Baustile und Kunstrichtungen), wobei meist Vorkenntnisse und eine entsprechende Fachliteratur vonnöten sind. Bei vielen empirischen Studien mit Schülern und Studierenden ist zudem zu beachten, dass u. U. Genehmigungen der zuständigen Behörden und Grundstückseigentümer einzuholen sind und z. T. auch eine Verletzungsgefahr einkalkuliert werden muss. Nach der Studie lassen sich solche Daten sehr gut vor Ort oder anschließend im Unterricht aufbereiten, auswerten, diskutieren und reflektieren. Der Mehrwert kann mitunter so groß sein, dass sogar kleine Publikationen mit den Ergebnissen möglich sind.
Kartierungen: Eine besondere Form empirischer Studien ist die Kartierung, die vor allem in der Geographie und ihren Nachbarwissenschaften stark verbreitet ist. Dabei können unterschiedliche Sachverhalte im Gelände in eine möglichst großmaßstäbliche Karte eingetragen werden. Es bietet sich hier eine Vielfalt an Möglichkeiten. Außerhalb von Siedlungen eignen sich z. B. Bäume, Feldfrüchte, Gesteine, Biotope, Knicks- und Wallhecken, die Gewässerstrukturgüte, kulturhistorische Relikte (z. B. Grabhügel, Meilerplätze oder Feldraine) u. v. m. In der Stadt können Grünanlagen, Spielplätze, Baustile, Gewerbe- und Flächennutzungen, Leerstände u. Ä. kartiert werden. Vor der Kartierung sollten bestimmte Farben oder Legendensymbole für Unterschiede und Kategorien abgesprochen werden. Karten bieten den Vorteil, dass auch das räumliche Orientierungsvermögen geschult wird. Einfacher ist in der Regel die Benutzung von Hand-GPS-Geräten, mithilfe derer sich sogenannte Wegpunkte speichern lassen. Dasselbe leisten aber heutzutage auch schon fast alle Smartphones mit Unterstützung kostenloser Apps (z. B. GPS-Mate free). Die Punkte können anschließend in ebenfalls meist kostenlosen Viewern am PC, in einfachen Geographischen Informationssystemen (z. B. im kostenlosen QGis) oder in Google Earth angesehen, ausgewertet und interpretiert werden. Nicht selten können auf derartige Weise gewonnene Ergebnisse auch für die Öffentlichkeit von Interesse sein.
Befragungen: Befragungen von Passanten, anderen Schülern oder Studierenden, Familienmitgliedern und ausgewählten Personen an einem bestimmten Exkursionsziel können auf unterschiedlichem Niveau durchgeführt werden. Für kleinere Übungen genügen normalerweise vorher mit den Lernenden gemeinsam entworfene oder zumindest abgestimmte Fragen, die mehr quantitativ oder qualitativ orientiert sein können. Bei größeren empirischen Projekten empfiehlt sich vorher ein Blick in die entsprechende Fachliteratur aus dem Bereich der Methodenlehre. Die Ergebnisse können zumeist auf einfache Weise mittels schnell angefertigter Graphen, aber auch in MS-Excel, Open Office oder vergleichbaren Tabellenkalkulationsprogrammen ausgewertet werden. Für komplexere Studien sind u. U. professionelle Statistikprogramme vonnöten. Auch zur Durchführung von Befragungen bedarf es in der Regel behördlicher Genehmigungen. Besonders im Ausland ist Vorsicht geboten.
Orientierungsübungen: Orientierungsübungen und -spiele können sehr gut nach Art einer Schnitzeljagd oder auch mit Elementen des Geocachings, einer GPS-geleiteten Schatzsuche, verknüpft werden. Dafür eignen sich am besten Lernstationen, an denen es thematische Aufgaben zu lösen gilt, um ans Ziel zu gelangen. Möglich ist es aber auch, ganz traditionell topographische Karten einzusetzen, in denen bestimmte Schlüsselpunkte eingetragen sind, die angesteuert werden sollen. Dasselbe funktioniert auch mit Stadt- oder Museumsplänen. Auch Koordinaten können vorgegeben werden. Wegen ihrer Realitätsnähe empfiehlt es sich dabei aber, metrische Systeme, wie Gauß-Krüger- oder UTM-Koordinaten, zu bevorzugen. Sie bieten den Vorteil, dass ein Rechtswert mit einem zehn Meter größeren Koordinatenwert eben auch exakt zehn Meter weiter östlich liegt. Geographische Koordinaten in Grad, Bogenminuten und -sekunden lassen sich dagegen nur schwierig handhaben. Andererseits vermittelt aber allein das Verlesen solcher Koordinaten schon ein wenig das Gefühl von Abenteuer und kann z. B. bewirken, dass sich auch lernschwache Schüler begeistern lassen. Grundsätzlich steht solchen Konzepten zumindest auf größerem Terrain bei jüngeren Schülern das Problem der Aufsichtspflicht entgegen, weshalb von vorneherein einige Varianten ausscheiden oder es mehrerer Aufsichtspersonen bedarf.
Sportexkursionen und sportliche Aktivitäten auf Exkursionen: Sportliche Aspekte sind häufig ein gewollter Bestandteil unterschiedlicher Exkursionstypen. Besonders auf Klassenfahrten kommt ihnen eine gesteigerte Bedeutung zu, da Schüler dadurch zur Bewegung im Freien animiert werden. Möglich ist zum einen die Verknüpfung mit anderen Inhalten, z. B. in Form einer Wander- oder Radexkursion. Andererseits können sportliche Einlagen, wie Schwimmen, Ball- oder Fangspiele, zwischendurch für Auflockerung sorgen. Im Fach Sport stehen dagegen sportliche Aktivitäten im Mittelpunkt. Einen Sonderfall nehmen zudem Exkursionstypen ein, die von vorneherein mit einer bestimmten sportlichen Aktivität einhergehen, beispielsweise Segeltörns, Skifreizeiten, längere Radtouren oder Fernwanderungen. Aber auch bei nicht sportbezogenen Exkursionen kann es sinnvoll sein, einfach einen Ball für zwischendurch mitzunehmen.
Sprachreisen und interkultureller Kompetenzerwerb: Sprachreisen dienen meist nicht nur dem Fremdsprachenerwerb, sondern auch in starkem Maße dem Erwerb von interkulturellen Kompetenzen. Dies kann durch Kennenlernspiele und gemeinsame Aktivitäten, z. B. Stadtrallyes mit ausländischen Schülern und Studierenden, unterstützt werden. Eine Vorbereitung auf solche Exkursionen ist durch die Schaffung von Brief- und Mailfreundschaften möglich. Eine besondere Bedeutung kommt zudem dem Wohnen bei Gastfamilien zu. Bestehende Kontakte, wie Schul- oder Städtepartnerschaften, sollten genutzt werden.