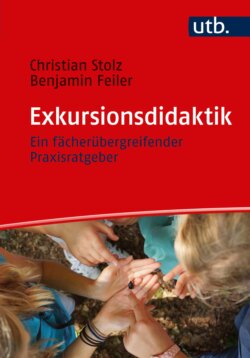Читать книгу Exkursionsdidaktik - Christian Stolz - Страница 13
3Die Entwicklung der Exkursion als methodische Großform
ОглавлениеEs ist unklar, ob die Exkursion als lernmethodische Großform eine Erfindung der Geographie ist. Zumindest aber wird sie in keinem anderen Fach derart intensiv eingesetzt. Denn „das Herz der Geographie schlägt im Gelände“ (Falk 2015). Die Wurzeln dazu sind im Zeitalter der Entdeckungen zu finden. Seither hat sich „der empirisch gestützte Erkenntnisgewinn im Gelände in der Geographie etabliert“ (Falk 2015). Von dieser Entwicklung können auch andere Fächer profitieren.
„Wenn wir also den Schülern wahres und zuverlässiges Wissen von den Dingen einpflanzen wollen, so müssen wir alles durch eigene Anschauung und sinnliche Demonstration lehren.“
Dieses Zitat des Pädagogen Johan Amos Comenius von 1657 (Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung München 1995: 3) ist bis heute gültig. Es betont die Notwendigkeit der Verlagerung des Unterrichts mit Schülern und Studierenden in außerschulische bzw. außeruniversitäre Kontexte und legitimiert damit die Exkursion als didaktische Methode. Dennoch ist der positive Effekt, den Exkursionen auf die Lernleistung von Schülern haben, kaum empirisch belegt. Er fußt vielmehr auf historisch gewachsener Erfahrung und ist daher unbestritten (Lößner 2011: 15).
Exkursionen und allgemein die Bildung durch Anschauung entwickelten sich erst seit der Renaissance, als langsam damit begonnen wurde, die Bildung aus rationaler Begründung heraus zu systematisieren (Lößner 2011: 17). Einer der Vorreiter des Lernens durch eigene Anschauung vor Ort war der Lübecker Pädagoge und Theologe August Hermann Francke (1663–1727). Er unterstrich die Bedeutung der Lehrmittelsammlungen, empfahl Naturkundestunden im Schulgarten und besuchte mit seinen Schülern Handwerker bei ihrer Arbeit (Lößner 2011). Weitere Vorreiter waren der englische Pädagoge John Locke (1632–1704) und der französische Aufklärer Jean Jaques Rousseau (1712–1778). Auch Johann-Heinrich Pestalozzi (1746–1827) kritisierte „den Verbalismus in der Schule“ (Reble 1995, vgl. Lößner 2011). Doch erst durch die Reformpädagogik Ende des 19. Jahrhunderts hielten Exkursionen unter Begriffen wie „Lehrwanderungen“ oder „Freiluftunterricht“ verstärkt Einzug in die Schule. Gestärkt wurde die Entwicklung durch die Jugend- und Wanderbewegung im beginnenden 20. Jahrhundert. Hervorzuheben ist außerdem die Idee der „originalen Begegnung“ des Pädagogen Heinrich Roth (1906–1983), der selbst Mitglied in einer Wandervogelgruppe war, jedoch heute wegen seiner Rolle im Nationalsozialismus umstritten ist (Harth-Peter 1997, Lößner 2011).
Die Geographie hat in den letzten 150 Jahren mehrere tief greifende Paradigmenwechsel erlebt, die sich in den einzelnen Teildisziplinen z. T. verzögert bemerkbar gemacht haben, was besonders in der Humangeographie zur parallelen Existenz unterschiedlicher Paradigmen geführt hat. Von einer deskriptiven, durch die Landschafts- und Länderkunde dominierten Wissenschaft entwickelte sich das Fach in den 1970er-Jahren zur quantitativ ausgerichteten raumanalytischen Geographie (Weichhart 2001). Heute stehen vor allem in der Humangeographie unterschiedliche Raumwahrnehmungskonzepte, qualitative Forschungsmethoden und Fragen der Globalisierung sowie des Global Change im Mittelpunkt. In der Physischen Geographie ist einerseits eine starke Hinwendung zu anderen physikalischen (Geo-)Wissenschaften zu beobachten, die mit einer großen Methodenvielfalt, Interdisziplinarität und Internationalisierung einhergeht. Auch hier stehen drängende Probleme, wie der Klimawandel, Bodenerosion und Desertifikation, im Vordergrund, aber auch Archiv- und Grundlagenforschung mit Schwerpunkten im Bereich Paläoklima und Geoarchäologie (Deutscher Arbeitskreis für Geomorphologie 2009). Andererseits treten auch in der Physischen Geographie bzw. in der angeschlossenen Mensch-Umwelt-Forschung verstärkt theoretische Konzepte und angewandte Fragestellungen in den Vordergrund. Eine ähnliche Entwicklung ist auch im Bereich der Regionalen Geographie zu beobachten. Gleichzeitig scheinen die Grenzen zwischen den traditionellen Teildisziplinen immer weiter zu zerfließen.
Daran anknüpfen lässt sich die Entwicklung in der Geographiedidaktik, die sich von der ursprünglichen rein deskriptiven und rezeptiven Wissensvermittlung nach länderkundlichen Aspekten seit den 1950er-Jahren auch zu theoriegeleiteten, kognitivistisch orientierten Lehrkonzepten hinwandte. Während die Bedeutung von Exkursionen im länderkundlich geprägten Erdkunde-Schulunterricht der 1950er- und 60er-Jahre im schulischen Kontext eher gering war, änderte sich das in der Zeit danach zusehends (vgl. Rinschede 2007: 251). In der Schule verlor das „Lernen vor Ort“ seit den 1970er-Jahren verstärkt an Bedeutung. In der Grundschule war dies vor allem mit der Einführung des Fachs Sachunterricht anstelle der Heimatkunde der Fall (Lößner 2011: 21). Gleichzeitig veränderten sich seitdem auch die Konzepte geographischer Exkursionen in Richtung der Angewandten Geographie und weg von der klassischen Landschaftskunde. Seit den 1980er-Jahren trat eine verstärkte Handlungsorientierung mit konstruktivistischen Konzepten in den Vordergrund. Welche Konzeption am besten dazu geeignet ist, Lernziele in Bezug auf Lerninhalte, Kompetenzen, aber auch Anwendungsnähe und Transferfähigkeit zu erreichen, wird in neuen Studien diskutiert und empirisch untersucht (vgl. Neeb 2011).
Seit den 2000er-Jahren setzte mit dem Bologna-Prozess und der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge an vielen Universitäten eine neue Zeitrechnung ein. Exkursionen wurden dabei in vielen Fächern nicht selten vom Lehrplan gestrichen oder verkürzt. Die Entwicklung traf auch das Fach Geographie. Teilweise wurde bei den ersten Reformen der neuen Studiengänge aber wieder zurückgerudert. In der Schule ist die Etablierung von Exkursionstagen nach wie vor ein schwieriges Unterfangen. Ihre Verankerungen in den Lehrplänen und Fachanforderungen ist in Deutschland bundeslandspezifisch geregelt. In den Bildungsstandards für das Fach Erdkunde werden Exkursionen in der Schule eindeutig empfohlen (Deutsche Gesellschaft für Geographie 2014).