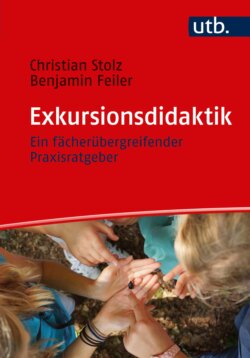Читать книгу Exkursionsdidaktik - Christian Stolz - Страница 8
1Einführung
ОглавлениеDie Aneignung unterschiedlicher Kompetenzen durch einen Menschen bezeichnet man als Lernen. Lernprozesse sind abhängig von der Lernumgebung und lassen grob eine Unterscheidung in schulisches und außerschulisches Lernen zu. Das „schulische“ Lernen steht in Bezug zu einer wie auch immer gearteten Bildungseinrichtung, wie einer Schule, Hochschule oder Volkshochschule, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Klassischerweise findet der „Unterricht“ in einem geschlossenen Raum statt, wobei unterschiedliche Lehr-/Lernmethoden zum Einsatz kommen und auch handlungsorientierte Elemente, wie z. B. Schülerversuche und -experimente, möglich sind. Im Gegensatz dazu stehen sogenannte außerschulische Lernorte, wobei der Unterricht in diesem Fall außerhalb der Schule, Hochschule oder Bildungseinrichtung stattfindet und der gewohnte Lernort für einige Zeit verlassen wird, er stellt damit den Rahmen für eine eigenständige Lehrveranstaltung dar (Abb. 1.1). In der Geographie, in der außerschulische Lernorte im Lehrprogramm traditionell fest verankert sind, aber auch in vielen anderen Disziplinen ist die Methode unter dem Begriff Exkursion (von lat. excursio, für Ausflug) bekannt. Der Duden definiert eine Exkursion als „Gruppenausflug zu wissenschaftlichen oder Bildungszwecken“. In Anlehnung an Haubrich (1997), Meyer (1996), Ohl & Neeb (2012) und Rinschede (2007) kann der Begriff Exkursion wie folgt definiert werden:
Eine Exkursion ist eine methodische Großform des Lernens, die in einer außerschulischen Lernumgebung angewendet wird und auf wenige Stunden bis mehrere Tage beschränkt ist. Ziel ist die Konfrontation mit Lerngegenständen in ihrer unmittelbaren Umgebung im fachlichen, methodischen und sozialen Kontext. Im Verlauf einer Exkursion werden unterschiedliche Lehr-/Lernmethoden in unterschiedlichen Sozialformen angewendet.
Begriffserklärung Exkursion – Lernmethode – Sozialform
(in Anlehnung an Rinschede 2007)
Methodische Großformen sind beispielsweise Exkursionen, Seminare, Vorlesungen oder Projekte.
Methodische Grundformen bzw. Lehr-/Lernmethoden sind die innerhalb einer methodischen Großform angewendeten Methoden (z. B. handlungsorientierte Übungen, Peer-Konzepte, Gruppenpuzzles u. Ä.)
Sozialformen sind Formen der Zusammenarbeit von oder zwischen Lernenden bei der Lösung von Fragestellungen (Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit). Auch der Klassen- bzw. Frontalunterricht (mit oder ohne Lehrer-Schüler-Interaktion) zählt zu den Sozialformen.
Abb. 1.1 Verortung von Exkursionen im Schulbetrieb (nach Lößner 2011; Rinschede 2007)
Nahezu jeder kennt Exkursionen aus seiner eigenen Schul- oder Studienzeit, auch wenn sie nicht immer so betitelt wurden. Rinschede (2007) zählt allein 47 verschiedene Bezeichnungen für Exkursionen (vgl. Klein 2015: 5). Bekannt sind klassische Tagesveranstaltungen, wie Schulausflüge, Wandertage, Museumsbesuche, Besichtigungen z. B. von Denkmälern, oder Unternehmen und Ausflüge mit sportlichem (z. B. Schwimmbadbesuch) bzw. sozialem Schwerpunkt. Auch mit handlungsorientierten Konzepten sind die meisten schon einmal in Berührung gekommen, so z. B. im Rahmen von Projekten im Schulgarten, Mitmachprojekten vor Ort, Wald- oder Stadtrallyes, Schnitzeljagden oder Geocaching. Auch mehrtägige außerschulische Lehreinheiten, wie Klassen-, Kurs-, Stufen-, Abschluss- und Studienfahrten, aber auch Sprachreisen oder sportlich orientierte Mehrtagesfahrten, wie Skifreizeiten, können als Exkursion bezeichnet werden. Die Vorteile solcher Exkursionen liegen auf der Hand. Sie bleiben häufig ein Leben lang in Erinnerung – das kann man vom Großteil des klassischen Schulwissens nicht unbedingt behaupten. So erinnern sich beispielsweise die Großeltern nicht mehr zwangsläufig an den Lösungsweg einer quadratischen Gleichung, dafür aber noch eher an den Schulausflug auf die Schwäbische Alb und den damals vor Ort gelernten Prozess der Verkarstung und Höhlenbildung im Kalkstein. Es fällt deutlich leichter, das im Gelände oder generell außerschulisch gelernte Fachwissen mithilfe der Erinnerung an unterschiedliche Erlebnisse und Gegebenheiten abzurufen. Die Behaltensleistung ist demnach deutlich erhöht, wovon lernstarke wie auch lernschwache Schüler profitieren können (vgl. Ohl & Neeb 2012; Wilhelmi 2012). Dennoch können Exkursionen durchaus auch Schwierigkeiten mit sich bringen (Tab. 1.1). Der Organisationsaufwand ist in der Regel höher als bei regulären Lehrveranstaltungen. Zeitfenster müssen gefunden werden und häufig entstehen Kosten, z. B. für die An- und Abreise. Der Besuch von Exkursionszielen im Freien ist außerdem wetterabhängig.
| Tab. 1.1 Vor- und Nachteile von Exkursionen | |
| Vorteile | Nachteile |
| Erleben der „realen Welt“ | (hoher) Organisationsaufwand |
| direkte Konfrontation mit Lerngegenständen | zeitlicher Aufwand, Finden von Zeitfenstern |
| höhere Lernmotivation und dadurch bessere Behaltensleistung | finanzieller Aufwand |
| kognitive Verknüpfung von Inhalten mit eigenen Erlebnissen | Verantwortung und Aufsichtspflicht |
| Stärkung der sozialen Kompetenz | mangelnde Verortung im Lehrplan, Fächerkonkurrenz |
| Zusammentreffen mit regionalen Akteuren und Experten | Entfernung zum Exkursionsziel |
| Wetterabhängigkeit |
Bei der Einordnung der aufgezählten Exkursionstypen in der Schule spielt es vor allem eine Rolle, ob die Exkursion einem bestimmten Fach zugeordnet ist und ob in erster Linie Fachkompetenzen vermittelt werden sollen oder ob sie im Klassenverband stattfindet und soziale Kompetenzen im Vordergrund stehen. Häufig dient der Abschluss einer Sekundarstufe als Anlass für eine derartige Klassenreise (Abschlussfahrt). Wenn ein Fachzusammenhang besteht, unterscheiden sich Exkursionen dennoch in der Regel sehr stark voneinander – je nachdem, welche Disziplin beteiligt ist. Dasselbe gilt für Exkursionen an Hochschulen und anderen stark nach Fächern gegliederten Bildungseinrichtungen. Die diesbezüglichen Unterschiede betreffen in erster Linie die Art der eingesetzten Methoden, den Selbstbestimmungsgrad der Lernenden, die Exkursionsdauer und die Entfernung zum Zielort (Tab. 1.2).
| Tab. 1.2 Unterscheidung von Exkursionen nach grundsätzlichen und theoriegeleiteten Gesichtspunkten | |
| Grundsätzliche Unterscheidung nach … | Theoriegeleitete Unterscheidung nach … |
| Dauer (wenige Stunden bis mehrere Wochen) | der lerntheoretischen Verortung |
| fachlicher Zuordnung, Themenbereich | den angewandten Lehr-/Lernmethoden |
| Selbst- bzw. Fremdbestimmungsgrad | der Konzeption und dem Lernprozess |
| sozialer Interaktion | den Lernzielen |
| Einbindung Dritter |
Besonders in der Geographie, aber auch in der Biologie, Geologie, Archäologie, Soziologie und in anderen Fächern, kommen häufig methodisch anspruchsvollere Exkursionskonzepte vor, die auch verstärkt auf handlungsorientierte Szenarien und die Erhebung empirischer Daten setzen. In anderen Fächern, z. B. im technischen Bereich und häufig auch in den Geschichts- und Wirtschaftswissenschaften, sind herkömmliche Besichtigungsexkursionen mit geringem Selbstbestimmungsgrad der Lernenden und zumeist externen Akteuren (Museums-, Stadt- oder Betriebsführer) nach wie vor am meisten verbreitet. Jedoch ist gerade dieser Aspekt stark von der verantwortlichen Lehrperson abhängig. Zum Teil bieten klassische Destinationen für Schul- oder Studienfahrten, wie Museen oder Naturschutzeinrichtungen, auch selbstständig pädagogisch anspruchsvollere Lernkonzepte an, die in der Regel dazu gebucht werden, aber häufig aus didaktischer Sicht durchaus kritikwürdig sein können.
An den Hochschulen verfügen in der Regel nur die Geographie und die mit ihr verwandten Fächer sowie in geringerem Maße auch die Biologie und die historischen Wissenschaften über eine feste Zahl an Exkursionstagen, die in den Modulplänen verankert sind. In anderen Fächern fehlen diese Vorgaben meist, wobei Exkursionen aber dennoch im Rahmen anderer Veranstaltungen stattfinden. Häufig wird zwischen Überblicksexkursionen („Exkursion“ im traditionellen Sinne, Geländeübung) und handlungsorientierten Veranstaltungen (Gelände- oder Methodenpraktikum, Projektstudie, Kartier- oder Bestimmungsübung u. a.) unterschieden. In der Schule werden Exkursionen in nahezu allen Fächern unternommen (häufig in Form eines Lehrausfluges oder Studientages). Diese sind teilweise verbindlich und teilweise fakultativ in den Kerncurricula bzw. den Lehrplänen oder Fachanforderungen verankert.
Da Exkursionen in der Regel organisationsaufwendig sind und aufgrund ihrer Alleinstellung schnell als überflüssig angesehen werden können, sind sie in den ersten Jahren nach der Bologna-Reform sogar aus den Lehrplänen vieler Institute verschwunden bzw. wurden zeitlich stark zusammengekürzt. Selbst geographische Exkursionen waren betroffen. Erfreulicherweise ist nach den ersten Revisionen der Bachelor- und Masterstudiengänge wieder eine gewisse Renaissance der methodischen Großform Exkursion zu erkennen.
Exkursionen lassen sich grundsätzlich nach dem Selbst- bzw. Fremdbestimmungsgrad des Lernprozesses gliedern. Weiterhin nach der Art der eingesetzten Methoden und ihrer lerntheoretischen Verortung, nach der sozialen Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden sowie den Lernenden untereinander und gegebenenfalls nach der Einbindung Dritter (Tab. 1.2). Außerdem danach, ob eher feststehende Lerninhalte vermittelt werden oder selbstständige Problemlösekompetenz und aktive Wissenskonstruktion gefördert werden sollen (Stolz 2016, Ohl & Neeb 2012). Unterschieden wird daher allgemein zwischen
thematisch ungebundenen oder problemorientierten Überblicksexkursionen mit geringem Selbstbestimmungsgrad und überwiegender Passivität der Lernenden (z. B. Wandertag oder Besichtigung),
handlungsorientierten Arbeitsexkursionen mit überwiegender Aktivität der Lernenden (z. B. Messtag oder Befragung) und
konstruktivistischen Konzepten mit hohem Selbstbestimmungsgrad (z. B. Erkundungsaufgaben und Spurensuche).
In der Praxis werden häufig Elemente aus allen drei Bereichen miteinander verknüpft.
Schlussendlich ist die Vorplanung einer Exkursion aber immer mit erheblichem Aufwand verbunden. Das kostet Zeit, und die Verknüpfung mit methodisch-didaktischen Konzepten kommt der Planung einer ausführlichen Unterrichtsreihe gleich (Hemmer & Uphues 2006: 72f.). Wer jedoch auf erfolgreich durchgeführte Exkursionen zurückblickt, weiß, dass der didaktische Mehrwert den Aufwand bei Weitem übersteigt.
Begeisterung erzeugen
Exkursionen sollen spannend sein – das kann niemand bestreiten. Die reale Begegnung mit dem Lerngegenstand soll die Exkursionsteilnehmer persönlich bewegen, beeindrucken und sie zum Nachdenken und zur selbstständigen Beschäftigung mit dem Thema anregen. Ein realer, fassbarer Inhalt wird mit einem außergewöhnlichen Erlebnis verknüpft. Auf diese Weise stellt sich der gewünschte Effekt einer effektiveren Lernleistung ein.
Im Idealfall tut es ein Exkursionsleiter daher seinen Schülern gleich: Er begeistert sich für den Lerngegenstand und zeigt selbst Gefühle. Er versprüht Euphorie oder Betroffenheit, je nachdem, wie das Thema gestrickt ist. Und er versteht es, diese Gefühle auf seine Schüler zu übertragen. Jeder kennt Menschen, die für ihre Leidenschaft, für ihr Fach, für ihren Beruf oder für ihr Hobby brennen. Es ist unübersehbar, dass sie voll hinter dem stehen, was sie vermitteln wollen. Wer will bestreiten, dass gerade solche Exkursionsleiter den größten Eindruck hinterlassen und mit ihnen auch die vermittelten Inhalte. Besonders bei schwierigen oder wenig motivierten Gruppen, bei schlechtem Wetter oder anderen widrigen Umständen wirkt es dagegen manchmal Wunder, ruhig mal ein wenig euphorischer, humorvoller oder lockerer aufzutreten. Wachsen Sie dabei über sich hinaus und sehen Sie begeistert zu, wie der Funke überspringt!