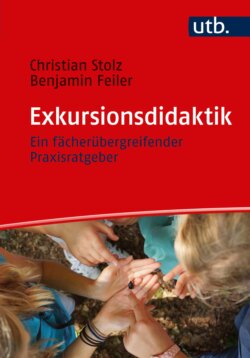Читать книгу Exkursionsdidaktik - Christian Stolz - Страница 16
4.2Die problemorientierte Überblicksexkursion
ОглавлениеEs erscheint generell sinnvoll, einer Exkursion oder einem Exkursionsstandort eine klar definierte Frage- oder Problemstellung zuzuordnen, die während der Exkursion bearbeitet und beantwortet wird. Diese Vorgehensweise sensibilisiert die Lernenden für das Thema und regt sie zur eigenen Beschäftigung mit den Inhalten an. Während der Wald-Exkursion könnte es z. B. explizit um die ökologischen Zusammenhänge in einem Wald gehen oder um die verschiedenen Nutzergruppen (z. B. Spaziergänger, Holzwirtschaft, Jagd und Naturschutz) und die Nutzungskonflikte, die sich daraus ergeben. Die Fragestellung hilft dabei, die deskriptiv vermittelten Inhalte in einen inhaltlichen Rahmen einzubinden und Querverbindungen aufzuzeigen. Sie kann zudem exemplarisch für ähnliche Räume sein, z. B. – im Falle des Waldes – für die Ökologie und die Nutzungsmuster einer Grünlandfläche oder eines Parks. Im Falle der Burg könnte es beispielsweise um das Leben im Mittelalter gehen und die Frage nach historischen Problemlösungsmechanismen und Unterschieden im Vergleich zu heute.
Auch die Ergebnissicherung in Form eines Exkursionsberichts muss in diesem Fall nicht mehr rein inhaltlich erfolgen, sondern kann thematisch und in verstärktem Maße auf die Fragestellung ausgerichtet sein. Sinnvoll ist es daher auch, Überblicksexkursionen möglichst nach thematischer Einführung inklusive Fragestellung, inhaltlichem Teil und Gesamtfazit zu gliedern; in Letzterem wird schlussendlich die Fragestellung mehr oder weniger ergebnisoffen beantwortet (vgl. Klein 2015: 51). Der inhaltliche Teil enthält eine Problemanalyse mit Hypothesenbildung, die in die eigentliche thematische Bearbeitung überleitet und sich nach den unterschiedlichen didaktischen Konzepten richtet (vgl. Haubrich et al. 1997: 210). Auf diese Weise ist eine Verknüpfung mit handlungsorientierten Phasen auch viel einfacher möglich, wobei sich die Schüler oder Studierenden bestimmte Inhalte selbstständig erarbeiten oder diese beobachten und sie später gemeinschaftlich interpretieren.
Wenn auf Exkursionen konfliktlastige Themen zur Sprache kommen, muss sich der Lehrende – wie auch sonst im schulischen Unterricht – grundsätzlich neutral verhalten und muss sich mit seiner eigenen Meinung oder Parteinahmen jedweder Art zurückhalten, um die Mündigkeit des Schülers zu wahren (vgl. Ohl & Neeb 2012: 277). Über allem steht das demokratische Grundprinzip. Persönliche Meinungen des Lehrenden zu politischen, weltanschaulichen oder religiösen Fragen sind daher in jedem Fall fehl am Platz. Vielmehr soll den Exkursionsteilnehmern die Fähigkeit vermittelt werden, zwischen unterschiedlichen Interessen verschiedener Akteure oder Gruppen abzuwägen (z. B. bei Nutzungskonflikten) und unstrittige Punkte herauszuarbeiten.
Wichtige Punkte bei Überblicksexkursionen sind:
Wenn möglich, sollte mit Frage- und Problemstellungen gearbeitet werden.
Mit den Lernenden in Interaktion treten und zu Gruppendiskussionen anregen.
Die Lehrveranstaltung sollte inhaltlich nicht überladen werden.
Eine Gliederung in Einführung, Verortung, inhaltlichen Teil, Zusammenfassung und Fazit darf nicht fehlen.
Nach Möglichkeit sollte die Vermittlung der Inhalte mit handlungsorientierten Methoden kombiniert werden.
Mögliche Methoden (Auswahl)
Problemorientierte Überblicksexkursion: Ein oder mehrere Räume werden durch die Gruppe besucht, der Exkursionsleiter erläutert bestimmte Sachverhalte und tritt mit den Lernenden durch Fragen und Diskussionen in Interaktion. Kleine Experimente u. Ä. sind möglich. Beispiele sind eine Wattwanderung mit einem Wattführer, eine naturkundliche oder geschichtsorientierte Wanderung.
Besichtigung: Ein Betrieb, eine öffentliche Einrichtung o. Ä. werden besucht und durch einen Dritten erläutert. Am Ende können die Lernenden Fragen stellen und Diskussionspunkte einwerfen. Fragen können auch bereits vor dem Besichtigungstermin formuliert werden.
Museumsbesuch: Ein Museum wird besucht, entweder selbst erkundet, durch einen Museumspädagogen erläutert oder beides. In der Regel hat vorher eine Beschäftigung mit den betreffenden Inhalten im Unterricht stattgefunden. In der Praxis hat es sich bewährt, die selbstständige Erkundung voranzustellen und dann erst die Führung mitzumachen. Durch die größere Neugierde am Anfang werden die Lernenden stärker dazu animiert, das Museum auf eigene Faust zu erkunden, als wenn sie vorher bereits alle Highlights des Museums gezeigt bekommen haben. Auf eine Fragerunde im Beisein des Experten sollte nicht verzichtet werden, ebenso wie auf eine nachträgliche Reflexion, die auch später im Unterricht erfolgen kann. Mittlerweile bieten aber auch viele Museen stärker handlungsorientierte Konzepte an, die sich insbesondere an jüngere Schüler richten.
Lehrpfade (vgl. Kremb 2003 und Meyer 2006): Auch Lehrpfade bieten die Möglichkeit einer problemorientierten Überblicksexkursion, indem sich die Lernenden selbstständig mithilfe von Schautafeln oder anderen Medien (z. B. über QR-Codes verlinkte Internetseiten oder Audioaufnahmen) über bestimmte Standorte informieren. Nicht selten leidet dabei die Motivation der Lernenden und der Lernerfolg bleibt überschaubar. Eine ausreichende inhaltliche Vorbereitung und die nachträgliche Reflexion sollten obligatorisch sein. Handlungsorientierte Lehrpfade hingegen greifen das Konzept der Stationsarbeit auf.
| Tab. 4.1 Kennzeichen einer Überblicksexkursion | |
| lerntheoretische Verortung | kognitivistisch |
| vorwiegende Methodik | Frontalunterricht, Gruppendiskussion |
| Lernprozess | gesteuert, hoher Fremdbestimmungsgrad, geringe Aktivität der Lernenden |
| Lernziele | Erlernen von feststehenden Lerninhalten |