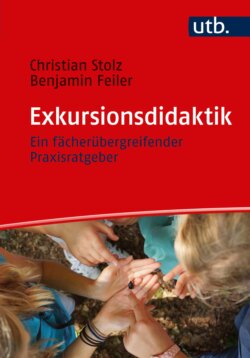Читать книгу Exkursionsdidaktik - Christian Stolz - Страница 14
4Methodische Grundtypen
ОглавлениеExkursionen können in mehrere methodische Grundtypen unterschieden werden (siehe Kap. 1), von denen alle ihre Vorzüge wie auch Nachteile haben und die sich am Beispiel der Regionalen Geographie in bestimmten historischen Strömungen verorten lassen. Die einzelnen Typen lassen sich grundsätzlich nach folgenden Gesichtspunkten unterscheiden:
nach dem Selbstbestimmungsgrad des Lernprozesses von stark fremdbestimmt bis vollkommen selbstbestimmt
nach dem Grad der Passivität bzw. Aktivität der Lernenden
nach ihrer lerntheoretischen Verortung von kognitivistisch bis konstruktivistisch
nach vorwiegend angewendeten Lehrformen (z. B. Frontalvortrag, Arbeitsaufträge)
nach beabsichtigten und eingesetzten Methoden (z. B. Gruppenpuzzle, Fotorallye)
nach den Lernzielen (werden feststehende Lerninhalte vermittelt oder erfolgt eine selbstständige Wissenskonstruktion)
Unterschieden werden demnach folgende Exkursionstypen (Abb. 4.2 und Abb. 4.3):
Die „Fahrt ins Blaue“ (in starkem Maße fremdbestimmt, stark deskriptiv und kognitivistisch, mit überwiegendem Frontalunterricht, hoher Passivität der Lernenden und feststehenden Lerninhalten und ohne eine genau festgelegte Problem- oder Fragestellung).
Die problemorientierte Überblicksexkursion (wie vorstehend, jedoch mit feststehender Problem- oder Fragestellung und u. U. verstärkter Interaktion zwischen dem Lehrenden und den Lernenden).
Die handlungsorientierte Arbeitsexkursion (höherer Selbstbestimmungsgrad und höhere Aktivität der Lernenden, feststehende Lerninhalte mit offenem Ergebnis und festgelegtem, handlungsorientiertem Methodenspektrum nach Art einer empirischen Untersuchung; vgl. Abb. 4.1).
Die gemäßigt oder radikal konstruktivistische Arbeitsexkursion (in starkem Maße selbstbestimmt, konstruktivistisch mit freiem oder nur vage festgelegtem Methodenspektrum, aktiver Wissenskonstruktion und offenem Ergebnis).
Die Zweckmäßigkeit der einzelnen Exkursionstypen richtet sich stark nach der thematischen Ausrichtung und dem Fachzusammenhang einer Exkursion, dem Exkursionsanlass, der Örtlichkeit, der Gruppenzusammensetzung, der Gruppengröße und den Lernzielen bzw. Kompetenzen. Dabei gilt der Grundsatz, dass es kein Patentrezept gibt und ein kreativer Methodenmix in der Regel die beste Wahl ist. Dazu kommt, dass die Vorbereitung handlungsorientierter Exkursionen in der Regel deutlich aufwendiger ist und die Gruppe in der Lage sein muss, selbstständig zu arbeiten. Bei Seminaren zum Thema fällt immer wieder auf, wie unterschiedlich die einzelnen Fachkulturen in dieser Hinsicht aufgestellt sind und wie wenig sich einige Exkursionsleiter mit den zur Verfügung stehenden methodischen Möglichkeiten auskennen. So ist es für Geographen, Geologen, Biologen und Archäologen gang und gäbe, mit ihren Studierenden und Schülern nach draußen in die Landschaft zu gehen und dort bestimmte Sachverhalte zu analysieren. Zudem sind Exkursionen in diesen Fächern häufig fest im Lehrplan verankert. Auch Historiker kennen didaktisch ausgefeiltere Exkursionskonzepte. In vielen anderen Fächern (Abb. 4.4) haben Exkursionen dagegen Seltenheitswert und beschränken sich auf den gelegentlichen Besuch außerschulischer Lernorte, bei denen es sich zumeist um Besichtigungsexkursionen handelt. Beispiele dafür sind Besuche in Betrieben (z. B. in den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften), Parlamenten, Behörden (z. B. in den Politikwissenschaften) oder in Museen. Solche Besuche laufen meist nach dem Schema einer themengebundenen Überblicksexkursion ab, bei der Dritte im Frontalunterricht bestimmte Sachverhalte erläutern. Fragen sind möglich, Diskussionen teilweise auch. Weiterführende Konzepte finden aber zumeist keine Anwendung, zumal es sich oft um Tagesexkursionen mit einem einzigen Programmpunkt handelt. Ähnlich verhält es sich auch mit klassischen Stadtführungen. In anderen Fächern stehen soziale Aspekte und die Förderung motorischer Fähigkeiten im Vordergrund. Besonders Exkursionen im Fach Sport zeichnen sich durch zahlreiche erlebnispädagogische Elemente aus, bei denen der Erwerb sozialer Kompetenzen eine wichtige Rolle spielt (vgl. Schwier 2016, Klein 2015: 7).
Abb. 4.1 Eine Arbeitsexkursion in der Physischen Geographie setzt in den meisten Fällen den Einsatz entsprechender fachspezifischer Arbeitsmethoden voraus. Das Beispiel zeigt die Arbeit mit einem Pürckhauer-Bohrstock zur Entnahme eines Sedimentprofils im nordfriesischen Wattenmeer mit Mainzer Studierenden.
Abb. 4.2 Exkursionstypen: Lernprozess und lerntheoretische Verortung
Abb. 4.3 Exkursionstypen: Methoden und Lernziele
Abb. 4.4 Exkursionen in anderen Fächern außerhalb der Geographie