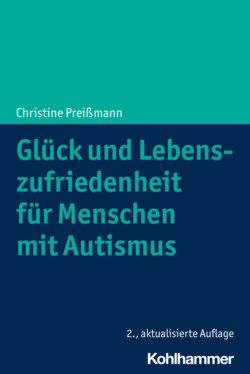Читать книгу Glück und Lebenszufriedenheit für Menschen mit Autismus - Christine Preißmann - Страница 10
Glücksforschung
ОглавлениеInzwischen hat sich eine ganze Forschungsindustrie etabliert, um der Frage nachzugehen, was Menschen glücklich macht. Ed Diener und Martin Seligman gelten als die Begründer der Glücksforschung. Sie formulierten erstmals die Notwendigkeit, nicht nur zu untersuchen, was Menschen unglücklich und krank macht, sondern auch die Faktoren herauszufinden, die ein glückliches Leben begünstigen.
Seither suchen Wissenschaftler unterschiedlicher Fachbereiche nach Sozialindikatoren, um die Voraussetzungen für Glück und Lebenszufriedenheit möglichst exakt zu bestimmen. Solche Indikatoren sind u. a.:
Wohnsituation
Sozialkontakte
Ehe, Familie
Haushalt
Einkommen
gesundheitlicher Zustand
Bildungsniveau und Erwerbsstatus (vgl. Stosberg 1994, 108).
Auch die Hirnforschung ist am Thema Glück beteiligt, denn all das, was wir als Glück erleben, entsteht im Gehirn durch ein sehr komplexes Zusammenspiel der unterschiedlichen Hirnregionen und durch körpereigene Botenstoffe, insbesondere Serotonin, Dopamin und Noradrenalin, die deswegen manchmal auch als »Glückshormone« bezeichnet werden (u. a. Walter 2014). Von der pharmazeutischen Industrie zu medizinischen Zwecken hergestellt, werden solche Substanzen als Medikamente etwa bei Depressionen verwendet.
Es ist nachgewiesen, dass das Gehirn mit seinen Aufgaben »wächst«, und zwar ganz im wörtlichen Sinne. Durch gezielte Anforderungen vergrößern sich tatsächlich die entsprechenden Hirnbereiche, um darauf angemessen reagieren zu können. So kann sich das Gehirn u. a. darauf einstellen, auch auf schwierige Situationen und Herausforderungen zu reagieren, sie gut zu verarbeiten und damit klarzukommen.
Das Glücksempfinden selbst scheint altersabhängig zu sein. Zwischen 20 und etwa 35 Jahren erfahren die meisten Menschen einen ersten Höhepunkt, das ist das junge Erwachsenenalter, in dem man frei zu sein scheint von Verpflichtungen und Unsicherheiten. Dann folgt ein »Glückseinbruch« mit einem Tiefpunkt im Alter von etwa vierzig Jahren. In dieser ersten Hälfte des Berufslebens muss eine Existenz aufgebaut werden, nicht alle Hoffnungen und Erwartungen lassen sich erfüllen. Außerdem kommt oft Stress in Partnerschaft und Familie hinzu. Aber schließlich, ein paar Jahre nach der berüchtigten »Midlife-Crisis«, kehrt das Glück langsam zurück, die Menschen werden gelassener und sind nach Ansicht der Forscher kurz vor der Rente wieder so glücklich wie einst mit zwanzig (Raffelhüschen & Güllner 2014).
In anderen Fragen der Glücksforschung sind sich die Wissenschaftler aber nicht einig. So glauben manche, vor allem die Gene seien entscheidend für das Erleben von Glück, andere sind überzeugt, es hänge vor allem von den ganz eigenen Erwartungen ab, also davon, was man sich vom Leben erhofft. Und wieder andere Forscher halten die Lebensumstände oder auch den Zufall für besonders wichtig. Gerade in den letzten Jahren aber haben sie entdeckt, dass Glück und Wohlbefinden in weit geringerem Ausmaß als zunächst gedacht von äußeren Einflüssen abhängen. Viel wichtiger für das Wohlergehen sind erfüllte Erwartungen, gute zwischenmenschliche Beziehungen, ein Ziel im Leben und ein positives Selbstwertgefühl. Heidl et al. (2012) definierten als Determinanten von Lebenszufriedenheit den Gesundheits- und Erwerbsstatus sowie die Häufigkeit von Glücksgefühlen. Sie stellten zudem die Vermutung auf, dass die psychische Gesundheit einen höheren Einfluss hat als die körperliche. Fahrenberg et al. (2000) beschreiben insbesondere den positiven Einfluss einer aktiven Gestaltung der Freizeit (Hobbys, Veranstaltungen, Vereine, körperliche Aktivitäten) auf die Lebenszufriedenheit, und nach Mayring (1991) spielt der Familienstand eine große Rolle, so sind verheiratete oder in einer Partnerschaft lebende Menschen signifikant zufriedener als Alleinstehende. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass diese Signifikanz schwindet, hier zeigten sich in einer festen Beziehung lebende Menschen nur noch leicht glücklicher, allerdings gaben die alleinstehenden Befragten hier an, dass sie ersatzweise viele Freunde hätten und deshalb partnerschaftliche Kontakte nicht vermissten (Hartmann-Wolff & Reinhard 2015).
Sehr wichtig sind auch die Erwartungen, die eine Person an ihr Leben hat. Menschen, die die Möglichkeiten, die ihnen selbst nicht offenstehen, bei anderen erfüllt sehen, hadern offenbar besonders stark mit ihrem Schicksal. Diese Überlegungen wurden schon vor Jahrzehnten als Hypothese formuliert. Erkenntnisse hinsichtlich des Einkommens stützen diese; ab einem Einkommen von etwa 30 000 Euro entsteht plötzlich Raum für unerfüllte Wünsche und Neid – man will noch mehr verdienen, ein noch besseres Auto oder ein ebenso großes Haus wie die Nachbarn haben. Und in Skandinavien sind die Menschen vermutlich auch deshalb so glücklich, weil es hier weit flachere Hierarchien gibt als in anderen Ländern. »Rangordnungen« kennt man hier kaum, die Menschen müssen sich nicht mit den anderen vergleichen, sie können sich als gleichwertig betrachten und fühlen sich deshalb glücklicher.
Insgesamt bezeichnen sich die meisten Menschen der westlichen Länder als glücklich, wenn sie (u. a. Bormans 2012, Frank 2007)
in einer stabilen Beziehung leben
nur einige wenige, dafür aber enge und vertraute Freunde haben
eine angemessene (Aus-) Bildung erlangen können und schließlich eine Arbeitsstelle finden, die ihre Fähigkeiten berücksichtigt und die ihnen Wertschätzung vermittelt
mit ihrer Arbeit etwas Nützliches tun können
eigene Ziele haben, selbst Einfluss nehmen können auf die Gestaltung ihres Lebens und einen Sinn in ihrem Dasein sehen
die Anforderungen des Alltags bewältigen können
sich selbst als Person akzeptieren und auch von anderen akzeptiert werden
genug Geld haben, um ihre Grundbedürfnisse zu stillen
in Gesundheit und Freiheit leben können.