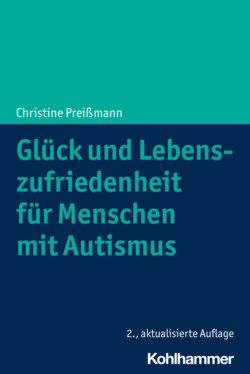Читать книгу Glück und Lebenszufriedenheit für Menschen mit Autismus - Christine Preißmann - Страница 9
Begriffsdefinitionen
ОглавлениеDie Begriffe Glück und Zufriedenheit werden häufig synonym gebraucht. Wenn man es genau nimmt, gibt es aber durchaus Unterschiede. »Glück ist immer etwas Flüchtiges. Ein Zustand, der in Erwartung von etwas entsteht, der uns zu einer Handlung bewegen soll. Im Gehirn wird dazu ein Bereich aktiviert, in dem der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet wird. Es kommt zu einem Feuerwerk, das aber schnell abbrennt. Zufriedenheit ist etwas völlig anderes. Sie entsteht, wenn die Bedürfnisse, die wir haben, auf Dauer weitgehend befriedigt werden«, erklärt der Psychoanalytiker und Kunsthistoriker Hans-Otto Thomashoff, dessen Buchtitel »Ich suchte das Glück und fand die Zufriedenheit« genau das verdeutlicht (Thomashoff 2014). Glück bezeichnet also das augenblicklich erlebte intensive Hochgefühl und findet daher immer nur im Jetzt statt. Zufriedenheit dagegen ist eher so etwas wie eine Bilanz über das Erlebte (u. a. Walter 2014). Sie resultiert aus dem Vergleich der aktuellen Lebenssituation mit der Vergangenheit bzw. dem »subjektiven Abwägen der eigenen Ziele und Ansprüche mit dem davon Erreichten« (Mayring 2000, zit. nach Bundschuh & Dworschak 2003, 34). Wenn also Menschen gefragt werden, wie glücklich sie sind, dann ist eigentlich die Zufriedenheit gemeint, und diese ist im Gegensatz zum Glück auch eine relativ stabile Eigenschaft. Die objektiven Lebensbedingungen haben natürlich durchaus einen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit, aber sie können auch im völligen Gegensatz dazu stehen.
In diesem Buch soll nicht so scharf unterschieden werden zwischen den einzelnen Begriffen, zumal auch in vielen Berichten der betroffenen Menschen »Glück« im Sinne von »Zufriedenheit« oder »Lebensqualität« beschrieben wird. Die exakte Definition ist hier letztlich nicht so entscheidend, viel wichtiger ist es, Menschen mit Autismus ein Leben zu ermöglichen, das sie als »glücklich« oder »zufrieden« bezeichnen können.
Es werden in der Literatur unterschiedliche psychologische Betrachtungsweisen im Hinblick auf die Lebensqualität vorgestellt (z. B. Osterrieder 2010, 87):
Lebensqualität als Abwesenheit von Belastung, Beeinträchtigung, Krankheit
Lebensqualität als positive Affektbilanz (Fokussierung auf die emotionale Facette)
Lebensqualität als Grad der Zielerreichung bzw. als individuelles Befriedigungsniveau (Fokussierung auf die motivationale Facette)
Lebensqualität als Resultat individueller Bewertungs- und Urteilsprozesse (Fokussierung auf die kognitive Facette)
Lebensqualität als Persönlichkeitsmerkmal im Sinne einer Glücksfähigkeit, gekoppelt mit einer positiven Grundeinstellung
Lebensqualität als »Glück von innen« im Sinne des »Mit-sich-im-Reinen-Seins«.
Die Beurteilung der Lebenszufriedenheit und Lebensqualität eines jeden Menschen kann nach diesen Betrachtungsweisen nur von ihm selbst vorgenommen werden.
Anders verhält es sich bei dem Modell des »positiven Funktionierens« von Ryff (1989, zitiert in Frank 2007, 6), das einen der inzwischen zahlreichen Versuche darstellt, objektive Faktoren zu ermitteln, die die Lebensqualität eines Menschen messen sollen. Sie wird hier anhand folgender Kriterien beurteilt:
Selbstakzeptanz
positive Beziehungen zu anderen
Autonomie
Umweltbewältigungen
Lebenssinn
persönliches Wachstum.
Deutlich wird dabei jedoch bereits an dieser Stelle, dass hier die ganz eigenen innerpsychischen Aspekte, die subjektive Beurteilung und vor allem auch die unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten bezüglich der Ausdrucksfähigkeit fehlen. Ähnlich sieht es aus bei den standardisierten Fragebögen, die zur Erfassung der Lebenszufriedenheit zur Verfügung stehen, etwa dem Fragebogen zu Lebenszielen und zur Lebenszufriedenheit (FLL) von Kraak und Nord-Rüdiger (1989) oder dem Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) von Fahrenberg et al. (2000), der zehn Lebensbereiche erfasst: Arbeit und Beruf, finanzielle Situation, Freizeit, Ehe und Partnerschaft, eigene Kinder, eigene Person, Sexualität, sonstige Kontakte und Wohnung.
Bislang liegen keine Erfahrungen vor, ob sich solche Verfahren auch bei autistischen Menschen anwenden lassen und welche Aussagekraft sie dabei haben können. Weiter unten (S. 175ff) soll noch eine Diskussion angeregt werden, ob und ggf. wie sich Lebenszufriedenheit und Glück bei Menschen mit Autismus anhand objektiver Kriterien ermitteln lassen.