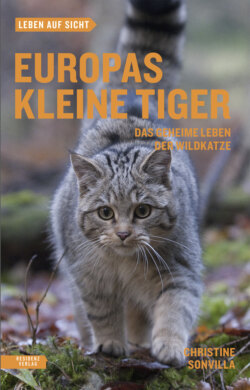Читать книгу Europas kleine Tiger - Christine Sonvilla - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Rückkehr mit Starthilfe
ОглавлениеDie Zeit der massiven Verfolgung der Wildkatze ebbte im Verlauf des 20. Jahrhunderts ab, zumindest weitgehend. Vielerorts erholen sich die Wildkatzenbestände langsam, aber stetig. Und mancherorts – in Bayern und der Schweiz – erhalten die heimlich lebenden Katzen sogar Unterstützung beim Neustart. Während Felis silvestris in ein paar Gegenden in Mittel- und Südwestdeutschland überdauern konnte, fehlt seit 1930 jede Spur von ihr in Bayern. Um diese Lücke zu schließen, wird der BN, der Bund Naturschutz in Bayern, 1984 aktiv, beginnt – unter der Leitung von Günther Worel – Wildkatzen nachzuzüchten, auf das Leben in der Natur vorzubereiten und freizulassen. An der Zucht beteiligen sich mehr als 30 Zoos und Wildtierparks quer durch Europa.77 Bis 2008 gelangen auf diese Weise 580 junge Wildkatzen in den Vorderen Bayerischen Wald, den Steigerwald, den Spessart und die Haßberge.78 Ein Jahr und noch einige Freilassungen später wurde die Auswilderungsaktion für abgeschlossen erklärt.79
Wie es bei so vielen Wiederansiedlungen der Fall ist, gab es auch in Bayern eine steile Lernkurve. Die Tiere wurden zunächst im Herbst freigelassen, in den Folgejahren dann aber überwiegend im Frühjahr und Sommer. Dadurch vergrößerten sich die Überlebenschancen der Neuankömmlinge, mit der erfreulichen Konsequenz, dass wiederholte Sichtungen gelangen, die das Vorkommen in allen Ansiedlungsgebieten und auch die Ausbreitung in neuen Bereichen bestätigten.80 Um noch genauer über den Verbleib der Neubesiedler Bescheid zu wissen, gab es außerdem drei Studien, bei denen in Summe 28 Katzen mit Halsbandsendern ausgestattet wurden.81 Im Spessart etwa musste man jedoch feststellen, dass von elf im Jahr 1999 freigelassenen und besenderten Tieren gleich drei im Straßenverkehr ums Leben gekommen waren und sich zwei weitere – wegen ausgefallener Sender – nicht mehr aufspüren ließen. Das klingt nach einem mächtigen Dämpfer. Die restlichen sechs Tiere überlebten aber, und das mindestens so lange, wie die Batterien ihrer Halsbandsender funktionierten. In zwei Fällen waren das immerhin elf Monate.82 Wer sich die hohe Jungensterblichkeit aus dem Südharz vergegenwärtigt, kommt zu dem Schluss, dass mehr als 50 Prozent durchkommender Wildkatzen in der Tat kein schlechter Schnitt ist. Die besenderten Pionierkatzen hatten außerdem keine Probleme damit, ausreichend Beute zu machen, und möglicherweise sorgten sie auch für Nachwuchs. Schon in den Jahren zuvor gelang es Forschern, mehrere Nachweise von erfolgreichen – und vermutlich auch sehr mutigen – Wildkatzenmamas sowohl aus dem Spessart als auch aus dem Vorderen Bayerischen Wald zu erbringen.83
Ist die Wiederansiedlung damit geglückt? Nicht alle würden das unterschreiben. Kritiker monieren, dass es keine ordentliche Zuchtplanung gegeben habe, dass genetische Proben erst Anfang der Nullerjahre genommen worden seien und dass vor allem Unklarheit herrsche, wo die Tiere überhaupt herkämen. Bei Auswilderungen ist es wichtig, Tiere für die Nachzucht heranzuziehen, die geografisch dem Gebiet, in das sie freigelassen werden, am nächsten sind.84 Das war in Bayern der Fall. Etwa 70 Wildkatzen – und damit drei Viertel aller Zuchttiere – waren verletzte Wildfänge aus dem Harz und damit aus Mitteldeutschland. Diese Tiere wurden an die zoologischen Gärten in Magdeburg und Thale abgegeben und bildeten den bayerischen Zuchtstamm.85 Nur etwa 15 Prozent der nachgezüchteten Tiere dürften ihren Ursprung weiter östlich gehabt haben und kamen aus dem Erzgebirge, aus Tschechien und der Slowakei.86 Die Abkömmlinge letzterer Gruppe und ihre »fremden« genetischen Anteile lassen sich heute ganz gut auf der Wildkatzenlandkarte Deutschlands abbilden, vor allem im Spessart. Kritiker meinen, dies wären die einzigen, fragmentierten Hinweise auf die einstige Auswilderung. Die genetische Linie aus dem Harz, die sich ebenfalls in Bayern nachweisen lässt, soll dagegen von selbst, unabhängig von der Wiederansiedlung, eingewandert sein.
Günther Worel, der in Bayern den Ruf hat, der »Vater der Wildkatzen« zu sein und das Projekt von Anbeginn leitete, können wir dazu nicht mehr befragen. Im Hauptberuf Schafzüchter, verstarb er bereits 2018 bei einem landwirtschaftlichen Unfall.87 Zehn Jahre zuvor, im Zuge eines Symposiums über die Zukunft der Wildkatze in Deutschland, resümierte er, dass die Wiederansiedlung geglückt sein dürfte. Er räumte aber auch ein, dass die bisherigen Erfolgskontrollen nicht ausreichend gewesen seien.88 Fest steht: Die Wildkatze, wenn auch noch vereinzelt, ist zurück in Bayern und die Wiederansiedlung hatte zweifelsohne ihren Anteil daran. Ach ja: Ordentliche Tests zur genetischen Bestimmung von Wildkatzen waren übrigens erst im Laufe der Nullerjahre verfügbar.
Anstatt strukturiert vorzugehen, setzten die Eidgenossen eher auf aktionistische Guerillamethoden. Aber der Reihe nach. Immerhin gab es auch ein paar offizielle Freilassungen in der Schweiz, in den 1960er-Jahren etwa durch das Jagdinspektorat Bern, das 19 Wildkatzen am Brienzersee freiließ. 1971 folgten vier Wildkatzen aus dem Zoo La Garenne, die bei La Sarraz am Jurasüdfuß in die Natur entlassen wurden, und sieben weitere übersiedelten 1974 und 1975 aus dem Tierpark Dählhölzli ebenfalls in den Jura.89 Parallel kam es aber auch zu einigen Freestyle-Aktionen. »Es war einfach eine andere Zeit, heute wäre das nicht mehr möglich«, gibt Wildkatzenfachmann Darius Weber zu bedenken. Einige Schweizer Naturschützer, darunter der bereits verstorbene Kunstmaler Robert Hainard, setzten auf Eigeninitiative und machten sich den Umstand zunutze, dass das benachbarte Frankreich Wildkatzen zur damaligen Zeit noch immer als »nuisible«, also als schädlich einstufte und Prämien auf den Fang der Tiere auszahlte.90 Erst 1979 wurden sie auch in Frankreich unter Schutz gestellt. Davor aber fädelten die Schweizer ein Abkommen mit den Wildhütern im Burgund ein. Sie boten ihnen höhere Prämien, als es der Staat tat, woraufhin rund 30 Tiere in den 70er-Jahren vom Département Côte-d’Or in den Schweizer Jura wechselten.91 Ob sich die Burgunder Katzen in der neuen Umgebung behaupten konnten, bleibt freilich ungeklärt. Heute ist der Jura – auch unabhängig von den französischen Importen – wieder gut mit Wildkatzen besetzt.
Die beste Wiederansiedlung ist die, die es nicht braucht. Als letzter Ausweg stellt die Methode aber eine hoffnungsvolle Chance dar, der Naturvielfalt, die wir Menschen an den Rand gedrängt haben, wieder auf die Sprünge zu helfen, und sie wird deshalb auch von der IUCN, der Weltnaturschutzunion, als wertvolle Artenschutzmaßnahme anerkannt. Doch selbst gewissenhaft durchgeführte Wiederansiedlungen kämpfen heute noch oft mit Anfeindungen. Ein Argument, das von den Kritikern gerne ins Feld geführt wird, skizziert Richard Zink von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, der seit 2009 die Rückkehr des Habichtskauzes in Österreich vorantreibt: »Bei manchen Projekten werden Tiere falsch aufgezogen und zur falschen Zeit ins Freiland entlassen. Im Fall der Habichtskäuze beispielsweise ist es wichtig, die Tiere möglichst früh, um den 90. Lebenstag, freizulassen. Bis dahin müssen sie alle wichtigen Verhaltensweisen, die sie brauchen, um sich in der Natur zu behaupten, erlernt haben.« Dagegen verhält es sich bei Wildkatzen ganz anders. Um den 90. Lebenstag wären sie allein keinesfalls in der Lage zu überleben. Die Schweizerin Marianne Hartmann hat jahrzehntelange Erfahrung in der Aufzucht von Wildkatzen und weiß, worauf es ankommt: »Die Tiere werden im Alter von fünfeinhalb bis sechs Monaten selbstständig und können frühestens zu diesem Zeitpunkt für eine Wiederansiedlung freigelassen werden. Bis dahin müssen sie in der Gehegehaltung alle Reize und Strukturen angeboten bekommen, um ihre Verhaltensentwicklung abschließen und das Jagen erlernen zu können.«
Was viele nicht bedenken: Selbst bei bester Vorbereitung sind Wiederansiedlungen immer Pionierarbeit, es gibt ein Auf und Ab und stets neue Erkenntnisse. Nur wer einen langen Atem hat, gewillt ist, über Jahrzehnte Extrastunden und Wochenenden zu opfern, langfristige finanzielle Mittel und zahlreiche engagierte Helfer mobilisieren kann sowie Expertise und Herzblut gleichermaßen einbringt, erntet am Ende – vielleicht – die Früchte.
Die prinzipielle Entscheidung, ob eine Wiederansiedlung überhaupt infrage kommt, ist bei Weitem keine beliebige, sondern orientiert sich an den konkreten Kriterien der IUCN.92 Hier die wichtigsten Punkte von deren Checkliste: Die Art muss in dem für die Wiederansiedlung bestimmten Gebiet tatsächlich gelebt haben. Die Ursachen, die einst zum Aussterben führten, müssen beseitigt sein. Und es braucht genügend passenden Lebensraum sowie ausreichende Nahrungsquellen. Sollten Tiere aus wilden Beständen eingefangen werden, um sie andernorts anzusiedeln, darf das außerdem keine bestehende Population gefährden. Alternativ können Zootiere für die Zucht herangezogen werden, wie das etwa bei den Wildkatzen in Bayern der Fall war. Dabei ist es freilich nötig, die genetischen Eigenschaften der Tiere genau im Auge zu behalten.
Wer all das auf dem Radar hat, schafft es schließlich auch, sich selbst erhaltende Bestände von einst ausgerotteten Wildtierarten wiederaufzubauen. Mit den aktuell etwa 30 von Habichtskauzpaaren besetzten Revieren im Norden Österreichs ist das ambitionierte Eulenprojekt auf einem guten Weg. Die Steinböcke sind mit rund 40 000 Tieren quer durch die Alpen wieder repräsentativ vertreten und das Comeback der einst als Kindsräuber verschrienen Bartgeier gilt überhaupt als eines der erfolgreichsten europäischen Artenschutzprojekte. Heute segeln wieder rund 220 Bartgeier in den Alpen durch die Lüfte.
Wenn es jedoch um große Raubtiere geht, begibt man sich leicht auf gesellschaftliches Glatteis. Ein Versuch, Braunbären ab den späten 1980er-Jahren wieder im niederösterreichischen Ötschergebiet anzusiedeln, scheiterte spätestens 2011, als auch der letzte Bär der einst über 30 Individuen starken Population auf mysteriöse Weise verschwand. Ein kleines Raubtier wie die Wildkatze, die sich über die Jahrhunderte vom erbarmungslosen Killer zum Sympathieträger vieler Naturschutzorganisationen gemausert hat, dürfte mit weniger Gegenwind zu rechnen haben. Zumindest denkt man in Österreich bereits darüber nach, den Wildkatzen die Rückkehr ein wenig zu erleichtern. Die Unterstützung durch die Jagd scheint ihr sicher. Oder?