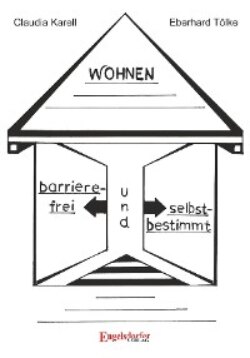Читать книгу Barrierefrei und selbstbestimmt Wohnen - Claudia Karell - Страница 16
Оглавление3. Mobilität – Definition
Das Adjektiv „mobil“ bedeutet so viel wie „beweglich“ bzw. „nicht an einen festen Standort gebunden“. Es wurde erstmals im 18. Jahrhundert in der Militärsprache – aus dem Französischen „mobile“ (= beweglich, marschbereit) stammend – benutzt. Dabei handelt es sich um eine Wortbildung, die auf das lateinische Wort „mobilis“ zurückgeführt werden kann.
Die Bewertung von Prozessen mit Hilfe dieser „Beweglichkeit“ – Mobilität – wurde seither verallgemeinert. Entsprechend groß ist die Vielzahl von Facetten der Mobilität. So stellen für uns heute beispielsweise die Bezeichnungen
geistige Mobilität
räumliche Mobilität
persönliche Mobilität
physische Mobilität
Umzugsmobilität
Wochenendpendlermobilität
Tagespendlermobilität oder
berufliche Mobilität
schon längst keine Abstrakte mehr dar.
Im sich eingebürgerten Sprachgebrauch wird unter der Mobilität behinderter Menschen, deren Möglichkeiten einer individuellen „physisch-räumlichen“ Fortbewegung/(Mobilität), verstanden.
3.1 Physisch-räumliche Mobilität
Unter der physisch-räumlichen Mobilität versteht man die Bewegung von Gütern und Menschen. Sie findet auf vielfältigste Weise, wie z. Bsp.: auf der Straße, der Schiene, über dem Wasser oder in der Luft statt.
In der Privatsphäre von Menschen mit Handicap bildet die physischräumliche Mobilität eine wesentliche Voraussetzung für die selbstbestimmte Lebensqualität. Die physisch-räumliche Mobilität von Senioren und Menschen mit Handicap erfolgt häufig per
Fuß und
ÖPNV.13
Zur Unterstützung der physisch-räumlichen Mobilität werden je nach Schweregrad der Beeinträchtigung und Fähigkeiten, Mobilitätshilfen eingesetzt. Diese können u. a. sein:
Gehhilfen/Unterarmstützen
Blindenlangstock
Blindenführhund
Auto
Fahrrad
Rollator oder
Rollstuhl
Persönliche, wie auch äußere Faktoren nehmen einen wesentlichen Einfluss auf die „physisch-räumliche“ Mobilität. Sie entscheiden über deren Umgang und Qualität. Einflussfaktoren auf die „physisch-räumliche“ Mobilität können sein:
persönliche Einflussfaktoren
Kognitive Fähigkeiten
Wahrnehmbarkeit der Umwelt (visuell, akustisch, taktil)
Orientierungsfähigkeit
Fähigkeit im Umgang mit der Mobilitätshilfe
äußere Einflussfaktoren
Barrieren (z. Bsp. baulich, kommunikativ)
Bereitstellung von Mobilitätshilfen (z. Bsp. durch Krankenkassen)
finanzielle Ausstattung
soziale, berufliche und gesellschaftliche Integration
3.1.1 Wer ist in seiner „physisch-räumlichen“ Mobilität eingeschränkt?
Zu den Personen, die in ihrer physisch-räumlichen Mobilität eingeschränkt sind, werden nicht nur Senioren oder Menschen mit Handicap gezählt. Die Palette der Personengruppen reicht durch die gesamte Gesellschaft. Zu ihnen gehören u. a.:
Rollstuhlbenutzer
Personen mit Gebrechen der Gliedmaßen
Personen mit Gehproblemen
Personen mit Kindern
Personen mit schwerem oder sperrigem Gepäck
Senioren
Schwangere
sehbehinderte und blinde Menschen
hörbehinderte und gehörlose Personen
Personen mit beeinträchtigter Kommunikationsfähigkeit, d. h. mit Schwierigkeiten beim Verständnis geschriebener und gesprochener Sprache
ausländische Mitbürger
Personen mit psychischen und geistigen Behinderungen
kleinwüchsige Menschen
Kinder
3.1.2 Sind blinde Menschen in ihrer physisch-räumlichen Mobilität eingeschränkt?
Die Grundlagen für die Erfüllung einer barrierefreien Mobilität dürfen nicht nur auf motorische Behinderungen (Gehbehinderung, Rollstuhlfahrer) beschränkt werden. Für eine eigenständige Mobilität ist die räumliche Orientierung – übrigens u. a. auch für gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer – unabdingbare Voraussetzung. Diese kann jedoch durch den Verlust des Sehvermögens nicht im erforderlichen Maß erfolgen. Somit können sich blinde und sehbehinderte Menschen nicht ohne weiteres (ohne Hilfen, wie Blindenlangstock, Blindenführhund, akustische Informationen) selbständig fortbewegen und sind daher in ihrer Mobilität wesentlich eingeschränkt und behindert. Die sich daraus ergebenden notwendigen baulichen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und Erleichterung der Mobilität blinder und sehbehinderter Menschen müssen in diesem Zusammenhang ebenfalls zu den Mobilitätsgrundlagen gerechnet werden.
Die Tatsache, dass Blindheit und Sehbehinderung eine Mobilitätsbehinderung darstellen, wird vom Gesetzgeber nicht nur anerkannt, sondern auch in vielfacher Weise Rechnung getragen. Nach dem Gesetz bekommen hochgradig sehbehinderte Personen im Schwerbehindertenausweis14 die Merkzeichen G (erhebliche Gehbehinderung) und B (Die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson ist nachgewiesen.) eingetragen. Hier wird also die hochgradige Sehbehinderung vom Gesetzgeber klar einer Gehbehinderung (und somit einer Mobilitätsbehinderung) gleichgesetzt. Bei blinden Personen wird das Merkzeichen G durch H (hilflos) ersetzt, wodurch der Gesetzgeber die Bedeutung der Blindheit als Behinderung der Mobilität sogar noch einmal erhöht hat.
„Die Bezeichnung „mobilitätseingeschränkte bzw. mobilitätsbehinderte Personen" schließt die große Gruppe der seh- und hörgeschädigten Personen ein. Dies ist insofern von Bedeutung, als fachgesetzliche Bestimmungen oder Festlegungen in Technischen Regelwerken, die die Berücksichtigung von Anforderungen mobilitätseingeschränkter Menschen beinhalten, damit auch die Berücksichtigung von Belangen sensorisch geschädigter Menschen vorgeben.“15