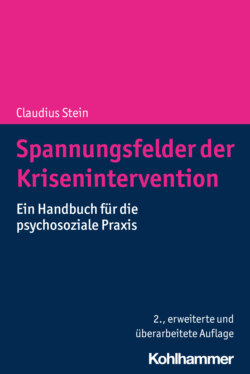Читать книгу Spannungsfelder der Krisenintervention - Claudius Stein - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Abwehr
Оглавление»Jeder psychische Vorgang und jedes Verhalten, welches das Ziel erreicht, etwas Gefürchtetes oder Verpöntes in Schach zu halten, kann zur Abwehr herangezogen werden« (Mentzos 2005, S. 59).
Abwehr ist von Coping zu unterscheiden. Gelegentlich bleibt die Abgrenzung wie beim Mechanismus der Verleugnung unscharf. Während Coping ein mehr oder weniger bewusster Prozess ist, stellt Abwehr einen überwiegend unbewussten Vorgang dar, der einsetzt, wenn ein Betroffener mit einem derzeit unlösbaren Konflikt konfrontiert ist, vor einer momentan unlösbaren Aufgabe steht oder überwältigende Erfahrungen macht. Abwehr stellt einen Versuch dar, die dadurch entstehende Angst und seelische Spannung zu vermeiden (Mentzos 2005). Sie führt nicht zu einer bewussten Lösung des Problems, sondern dazu, dass Erinnerungen, Phantasien, Impulse, Gefühle und Konflikte aus der bewussten Wahrnehmung und Reflexion ausgeschlossen werden. Abwehr und Coping sind lebenswichtige Funktionen des »Ich« (Ermann 2007) und nicht primär pathologisch. Abwehr kommt ständig vor und ist teilweise zur Erhaltung der Ökonomie des täglichen Lebens unverzichtbar (Mentzos 2005). Sie hat somit eine wichtige Schutzfunktion. Bestimmte Formen finden sich mit großer Regelmäßigkeit wieder, sie sind offenbar besonders effektiv. Man spricht von Abwehrmechanismen ( Kasten 2.4).
Kasten 2.4: Wichtige Abwehrmechanismen (Ermann 2007, Mentzos 2005)
• Verdrängung: Vergessen, d. h. Unbewusstmachen von Affekten, Absichten, Vorstellungen, Impulsen oder Wahrnehmungen
• Reaktionsbildung: Ein verpönter Impuls wird durch sein Gegenteil ersetzt (»ich bin besonders freundlich zu jemandem, auf den ich eigentlich wütend bin«).
• Intellektualisierung: Der unerwünschte Impuls wird aus dem emotionalen Bereich in den intellektuell theoretischen verschoben (»ich habe keine Suizidimpulse, aber das Thema interessiert mich theoretisch«).
• Identifikation: Dies ist ein wichtiger Grundmechanismus der Entwicklung, der für die Aneignung von Eigenschaften und Modelllernen unerlässlich ist
• Identifizierung mit dem Aggressor: Um unerträgliche Angst erträglicher zu machen, stellt sich das Opfer quasi auf die Seite des Angreifers, z. B. bei andauernder Gewalt in Beziehungen: das Opfer quält sich mit Selbstanklagen, demütigt und entwertet sich oder verletzt sich selbst und behandelt sich gleichsam so wie es der Täter tat oder noch tut.
• Gefühlsabspaltung: Trennung von Erlebnis und begleitender emotionaler Tönung (jemand erzählt ganz nüchtern von einem schwerwiegenden Verlust ohne dass der Kummer spürbar wird)
• Rationalisierung: Das durch ein abgewehrtes Motiv veranlasste Handeln wird im Nachhinein durch eine andersartige Begründung ersetzt oder umgedeutet (»ich konnte mit dem Chef nicht über meine Überforderung sprechen, weil so viel zu tun war – nicht weil ich Angst vor ihm habe«)
• Regression: Einem Konflikt oder einem unlustvollen Impuls wird durch eine Wiederbelebung früherer Erlebnisweisen und Verhaltensmuster ausgewichen, man verhält sich wie ein Kind (z. B. Nägelbeißen während der Adoleszenzkrise)
• Verleugnung: Ein Konflikt, eine Bedrohung oder Beeinträchtigung wird einfach nicht anerkannt, obwohl der Betroffene darüber Bescheid weiß. Er verhält sich so, als ob er nichts davon wüsste.
• Verschiebung von Bedeutendem auf weniger Bedeutendes: Beispiel: Die Wut auf eine bestimmte Person (z. B. den Chef) wird auf andere (meist unterlegene) Personen verschoben, dies ist dann weniger bedrohlich und einfacher zu handhaben (z. B. Aggression im Straßenverkehr).
• Wendung gegen das Selbst: Ein aggressiver Impuls wird nicht auf eine andere Person sondern auf sich selbst gerichtet (Suizidimpuls in Trennungssituationen).
• Spaltung: Widersprüchliche Wahrnehmungen, Bewertungen und Erlebnisweisen wechseln einander ab und bilden polare Erlebnis- und Reaktionsmuster (»nur gut/nur schlecht«). Beide Pole können einander im Erleben abwechseln. An der Umschlagstelle steht meist ein starkes affektives Erleben, z. B. eine massive Kränkung (Narzisstische Krise, Kap. 3.3.4, Fall Christa). Eine Person wird also nicht mit ihren positiven und negativen Seiten als Ganzes wahrgenommen, sondern einmal als ein idealer Mensch ohne Fehler gesehen und dann z. B. in Folge einer Kränkung vollkommen abgelehnt.
• Idealisierung / Entwertung: Ähnlicher Mechanismus wie bei der Spaltung, aber weniger Polarisierung des ursprünglich ganzheitlichen Erlebens und weniger Realitätsverzerrung.
• Projektion: Ein unerwünschter eigener Impuls wird in die Außenwelt verschoben und einem anderen zugeschrieben (»nicht ich bin aggressiv, sondern du bedrohst mich ständig mit deiner Wut«)
• Projektive Identifizierung: Andere Personen werden durch manipulierendes Verhalten dazu gebracht, sich so zu fühlen, wie man sich selbst fühlt. Man kann sich damit von unerträglichen Gefühlen oder eigenen Anteilen distanzieren (z. B. durch Suiziddrohungen entstehen im Gegenüber Hilflosigkeit und Ohnmacht).
Abwehr beeinflusst auch den Bewältigungsprozess in einer Krise – manchmal durchaus in einer positiven Weise. So ist das Verdrängen oder Verleugnen der Realität in der Schockphase einer Verlustkrise ( Kap. 3.1.1 und Kap. 3.1.2) ein sinnvoller Mechanismus, um sich zunächst vor der momentan nicht verarbeitbaren Mitteilung oder Wahrnehmung und den damit verbundenen überwältigenden Gefühlen zu schützen. Durch Verleugnung wird die Bedrohung oder Beeinträchtigung einfach nicht anerkannt, obwohl der Betroffene darüber Bescheid weiß. Er verhält sich so, als ob er nichts davon wüsste.
Zum Problem wird nur der übermäßige Einsatz von Abwehr oder eine ausgeprägte Starre der Abwehrmechanismen. Auch die Folgen von Abwehrprozessen, meist in Form von Symptombildungen können schädlich für das Individuum sein. Das könnte z. B. heißen, dass nach einem schmerzhaften Verlust die Verleugnung beibehalten wird, dadurch eine depressive Entwicklung einsetzt und in der Folge den notwendigen Trauerprozess verunmöglicht.
In Krisen können aufgrund der massiven innerseelischen Labilisierung Abwehrmechanismen aller Strukturniveaus, also auch solche, die man normalerweise nur bei schweren psychischen Störungen findet, vorkommen.