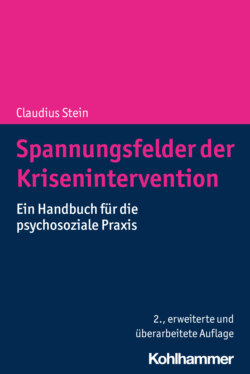Читать книгу Spannungsfelder der Krisenintervention - Claudius Stein - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.5 Diagnostik
ОглавлениеEine akute psychosoziale Krise ist primär kein krankhafter Zustand. Daher findet sich der Begriff auch nicht in den gängigen Diagnosemanualen, wie dem ICD-10 (Dilling et al. 1993) oder dem DSM IV. Auf der deskriptiven Diagnoseebene im ICD-10 werden krisenhafte Zustände noch am ehesten durch die Kategorien akute Belastungsreaktion (F43.0) und Anpassungsstörung (F43.2) erfasst. Entscheidend für die Diagnosestellung ist der zeitliche Zusammenhang zwischen einem außergewöhnlich belastenden Lebensereignis oder einer besonderen Veränderung im Leben und der Symptomentstehung. Unter belastenden Lebensereignissen werden neben Verlusten auch überwältigende traumatische Erlebnisse subsumiert. Die Diagnosekriterien für die Posttraumatische Störung werden in Kapitel 3.3.2 beschrieben ( Kap. 3.3.2). Die Autoren des ICD weisen auch auf die Bedeutung von individueller Vulnerabilität und den zur Verfügung stehenden Copingstrategien für das Auftreten und den Schweregrad der Belastungsreaktion hin. Deutlich abweichend von der Krisentheorie ist der enge zeitliche Rahmen, der für das Abklingen der Symptome mit maximal drei Tagen angenommen wird. Hier lässt sich am ehesten eine Parallele zur Schockphase, wie wir sie bei der Verlustkrise und nach akuter Traumatisierung finden, herstellen (Krisenmodelle Kap. 3).
Kasten 2.7: Akute Belastungsreaktion F 43.0 (ICD-10 1993)
• Es muss ein unmittelbarer und klarer zeitlicher Zusammenhang zwischen einer ungewöhnlichen Belastung und dem Beginn der Symptome vorliegen. Die Reaktion beginnt innerhalb weniger Minuten, wenn nicht sofort.
• Es tritt ein gemischtes und gewöhnlich wechselndes Bild auf; nach dem anfänglichen Zustand von »Betäubung« werden Depression, Angst, Ärger, Verzweiflung, Überaktivität und Rückzug beobachtet. Kein Symptom ist längere Zeit vorherrschend.
• Die Symptome sind rasch rückläufig, längstens innerhalb von wenigen Stunden, wenn eine Entfernung aus der belastenden Umgebung möglich ist. In den Fällen, in denen die Belastung weiter besteht, oder in denen sie naturgemäß nicht reversibel ist, beginnen die Symptome in der Regel nach 24 bis 48 Stunden abzuklingen und sind gewöhnlich nach 3 Tagen nur noch minimal vorhanden.
Auch für die Anpassungsstörung gilt, dass es einen nachvollziehbaren Grund für die Annahme geben muss, dass die Störung ohne äußere Belastung nicht aufgetreten wäre. Der Beginn der Störung sollte definitionsgemäß innerhalb eines Monats nach dem belastenden Ereignis liegen. Die Symptome sind vielfältig, je nach vorherrschendem klinischem Bild werden Unterkategorien beschrieben (z. B. kurze depressive Reaktion F 43.20).
Kasten 2.8: Anpassungsstörung F 43.2 (ICD-10 1993)
• Hier handelt es sich um Zustände von subjektivem Leiden und emotionaler Beeinträchtigung, die soziale Funktionen und Leistungen behindern und während des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden Lebensveränderung, nach einem belastenden Lebensereignis oder auch nach schwerer körperlicher Krankheit auftreten.
• Die Belastung kann die Unversehrtheit des sozialen Netzes betroffen haben (bei einem Trauerfall oder Trennungserlebnis), das weitere Umfeld sozialer Unterstützung oder sozialer Werte (wie bei Emigration oder nach Flucht).
• Die individuelle Disposition oder Vulnerabilität spielt bei dem möglichen Auftreten und bei der Form der Anpassungsstörung eine größere Rolle als bei den anderen Krankheitsbildern von F43; es ist aber dennoch davon auszugehen, dass das Krankheitsbild ohne die Belastung nicht entstanden wäre. Die Anzeichen sind unterschiedlich und umfassen depressive Stimmung, Angst, Besorgnis (oder eine Mischung von diesen), ein Gefühl, unmöglich zurechtzukommen, vorausplanen oder in der gegenwärtigen Situation fortfahren zu können, ferner eine Einschränkung bei der Bewältigung der alltäglichen Routine. Der Betreffende kann sich so fühlen als stehe er kurz vor darmatischem Verhalten oder Gewaltausbrüchen, wozu es aber selten kommt.
• Die Störung beginnt im Allgemeinen innerhalb eines Monats nach dem belastenden Ereignis oder der Lebensveränderung. Die Symptome halten meist nicht länger als sechs Monate an, außer bei der längeren depressiven Reaktion« (F43.21).
Ergänzend zu diesen Diagnosen sind die Kategorisierungen von psychosozialen Problemstellungen nach Kapitel XXI des ICD-10 zu sehen: »Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten führen (Z-Diagnosen)« (Dilling et al. 1993, S.339) Dabei werden verschiedenste Belastungssituationen wie z. B. normale Trauerreaktionen (Z 63.4 Verschwinden oder Tod eines Familienmitgliedes) erfasst, die zu Kontakten mit Kriseninterventionseinrichtungen oder anderen medizinischen Diensten führen können.
Möglich ist natürlich auch, dass sich in Folge einer unbewältigten Krise sowohl psychische als auch psychosomatische krankheitswertige Störungen entwickeln. Die Diagnose ist dann in Übereinstimmung mit dem klinischen Bild zu ändern. Etwas willkürlich wird dabei für das Andauern der Symptome eine zeitliche Grenze von sechs Monaten festgelegt.
Das grundsätzliche Problem, die Abgrenzung zwischen der normalen Reaktion auf außergewöhnliche Ereignisse und dem Übergang in ein psychisches Störungsbild, wird auch im ICD-10 nicht gelöst. Es bleibt dabei, dass sich der Mensch in der Krise letztlich an einer nicht exakt festzulegenden Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit bewegt. Die Übergänge sind fließend und selten genau definierbar. Vielfältige Faktoren bestimmen darüber, auf welcher Seite der Grenze sich der Betroffene nach der Krise wiederfindet.