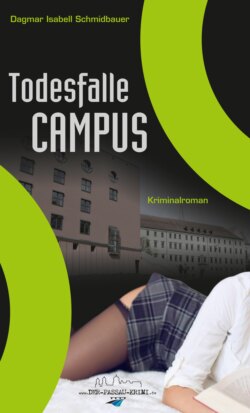Читать книгу Todesfalle Campus - Dagmar Isabell Schmidbauer - Страница 13
Оглавление„Wir müssen unbedingt wissen, mit wem Ihre Tochter befreundet war“, erkundigte sich Franziska bei Jens und Mandy Auerbach, nachdem sie den beiden die traurige Nachricht vom Tod der Tochter überbracht hatte. Sie versuchte, sich nicht zu sehr vom Anblick der abgewetzten Sofalehnen, des verschlissenen Teppichs und der angestoßenen Kaffeebecher auf dem Tisch gefangen nehmen zu lassen.
Gleich nach der Besprechung waren sie ins rund fünfzig Kilometer entfernte Deggendorf gefahren, wo die Eltern in einem zum Sofa passenden Wohnblock lebten. Oder vielmehr ihre Zeit totschlugen.
„Das wissen wir nicht“, erklärte die Mutter mit noch immer zitternder Stimme. Unter Schluchzen nickte sie ihrem Mann zu. „Sie war … Wir kamen ja gar nicht mehr an sie heran, und sie wollte auch nichts mehr mit uns zu tun haben.“
„Sie hielt uns für Spießer, nein, eigentlich für Loser“, erklärte Vanessas Vater. „Sie meinte, wir wären ja selber schuld an unserer Situation. Wir hätten unser Leben verpfuscht. Ihr könnte so etwas nicht passieren, glaubte sie.“ Resigniert nickte er seinen eigenen Worten nach.
Franziska wechselte einen schnellen Blick mit Hannes und mutmaßte dann vorsichtig: „Sie hatten nicht sehr viel Kontakt zu Ihrer Tochter?“
„Unsere Tochter war auf der Suche nach einem besseren Leben. Aber vor allem wollte sie es ganz anders machen als wir.“ Wieder lachte der Vater bitter auf. „Nun, wie es aussieht, hat sie das ja jetzt geschafft.“
„Jens, wie kannst du so etwas sagen!“ Vanessas Mutter konnte ihre Tränen nicht zurückhalten.
„Ist doch wahr!“ Er sah sich im Wohnzimmer um, als müsse er selbst erst begreifen, wie er hierher gekommen war. „Auch wir haben doch immer von einem besseren Leben geträumt.“
Nach einer kurzen Pause sah er erst Hannes und dann Franziska an. „Wir stammen von Drieben“, erklärte er und verfiel tatsächlich noch ein wenig mehr in seinen sächsischen Heimatdialekt. „Zunächst kannten wir es nicht anders, wir sind ja in das System hineingewachsen.“
„Es war ja auch nicht alles schlecht“, kommentierte die Mutter und lächelte wie ertappt, weil dieser Satz schon so häufig dafür hatte herhalten müssen, wenn Menschen versuchten, die eigene Vergangenheit nicht zu sehr abwerten zu lassen.
„Es wurde ja erst mit den Jahren immer enger, immer aussichtsloser. Oder vielleicht haben wir erst mit der Zeit kapiert, dass wir keine Perspektiven hatten, dass es um uns herum nur noch ein Verwalten des Untergangs gab. 1989, kurz vor der tatsächlichen Wende, träumte fast jeder … wenn nicht von der Flucht, so doch vom Leben im goldenen Westen.“
Jens Auerbach nahm seine Tasse und trank einen Schluck Kaffee. Keiner der anderen im Raum sagte etwas. „Wir kamen mit einem Urlaubsvisum nach Ungarn und flohen dann über Österreich nach Westdeutschland. Im Sommer 89 war das wie ein Virus. Die Ungarn hatte ihre Grenzen geöffnet, und wir DDR-Bürger sahen das Wunder.“
„Das wirkliche Wunder war, dass wir ein Visum bekommen haben“, mischte sich seine Frau ein. Ein kleines Lächeln huschte über ihr Gesicht.
„Ja, alle wollten weg, und es schien dem Regime trotzdem nicht aufzufallen, dass ein Urlaub in Ungarn der beste Weg dafür war. Als wir Mitte Oktober in Budapest ankamen, war die Botschaft der Bundesrepublik schon überfüllt, und so mussten wir in Zelten im Garten unterkommen. Wir hatten fast alles zurückgelassen und konnten, nachdem uns die Stasi fotografiert und damit aktenkundig gemacht hatte, ja auch nicht mehr zurück.“
Er nahm noch einen Schluck von seinem mittlerweile kalten Kaffee. „Es sollten drei lange, zähe Wochen werden, bis eines Abends die Botschaft verkündet hat, dass wir rausdürfen. Und auf einmal ging alles ganz schnell. Wir wurden über die Grenze nach Österreich gebracht, in einen Bus gesetzt und erst nach Passau und dann nach Deggendorf gefahren. Dort landeten wir dann in der Turnhalle der Kaserne des Bundesgrenzschutzes zusammen mit hundertfünfzig anderen Flüchtlingen. Das war dann zwar auch nicht besser als in Budapest, aber es fühlte sich sehr gut an, denn immerhin waren wir jetzt im Westen. Da wo wir hingewollt hatten. Nach zwei weiteren Wochen fanden wir Unterkunft und Arbeit und konnten das enge Lager verlassen. Erst bekamen wir Arbeit, dann kam Vanessa auf die Welt, und schließlich bauten wir uns ein Häuschen in Fischerdorf.“
„Wir hatten alles erreicht, was wir uns gewünscht hatten. Wir waren frei und es ging uns gut …“
„Aber da konnte Ihre Tochter doch stolz auf Sie sein“, bemerkte Franziska und verstand einfach nicht, was daran schlecht war.
„Ja, bis das Hochwasser kam und uns in wenigen Stunden alles nahm. Auf dem Haus waren noch Schulden, und mein Betrieb machte kurz danach auch noch dicht.“
„Diesmal mussten wir fliehen, und als wir zurückgehen konnten, war alles kaputt. Zerstört vom Wasser und vom Öl“, ergänzte die Mutter. „Seither leben wir im Sozialbau. Keine Arbeit, keine Perspektive.“
„Vanessa sagte, ihr habt es geschafft, aus dieser beschissenen DDR zu fliehen und dann hängt ihr in diesem Kaff fest, baut euch ein Häuschen ins Überschwemmungsgebiet und jammert, wenn das Wasser kommt und euch alles nimmt!“
Beim Erzählen hatte die Mutter den Ton angenommen, in dem Vanessa vermutlich mit ihren Eltern gesprochen hatte. „Sie wollte studieren und dann hinaus in die Welt. Etwas sehen, etwas verändern, flexibel sein und vor allem etwas für sich tun.“
Und dann schluchzte die Mutter so laut auf, dass es Franziska ein wenig mit der Angst zu tun bekam. „Wir haben alles verloren, und jetzt auch noch unser Kind.“ Sie sprang auf und rannte aus dem Zimmer. Dann war aus dem Nachbarraum die schlagende Tür zu hören.
„Und wir sind schuld. Wir haben sie verzogen. Wir haben eine Egoistin aus ihr gemacht“, fasste Jens Auerbach nüchtern zusammen.
Dann stand auch er auf, ging mit seiner Kaffeetasse zum Schrank und schenkte sich aus einer großen Schnapsflasche reichlich ein. Franziska sah ihm zu und hoffte, dass zuvor tatsächlich Kaffee in der Tasse gewesen war.