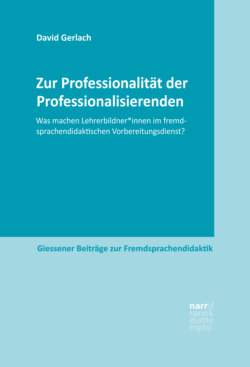Читать книгу Zur Professionalität der Professionalisierenden - David Gerlach - Страница 12
2.1.1 Strukturtheoretischer Bestimmungsansatz
ОглавлениеStrukturtheoretische Deutungsansätze professionellen Handelns sehen als Aufgabe, eine Struktur bzw. die einzelnen Ebenen und Akteure sowie ihr Verhältnis zueinander innerhalb einer Struktur zu verstehen und zu deuten, auf Basis theoretischer Konzepte dieses Handeln zu interpretieren. Handlungen und Spannungen in der Praxis sind hier also daher nicht als intentional zu sehen, sondern als Folge bestimmter Strukturen, wie es soziologisch z.B. von Parsons mit der struktur-funktionalen Theorie (z.B. 1968) beschrieben wurde. In einer Struktur wie der Schule, die für Parsons ein soziales System darstellt, erlernen die (inter-)agierenden Personen bestimmte Rollen, die mit bestimmten Erwartungen konnotiert sind, welche wiederum an die Struktur und die Funktionen der einzelnen Elemente des Systems gebunden sind.1
Einer der bekanntesten Vertreter dieser Position ist Oevermann (1996, 2008), der Lehrerhandeln begründet auf Basis eines therapeutischen, d.h. der Automieförderung zugewandten Professionsverständnisses. Lehrende bauen demnach in ihrer spezifischen Rolle ein diffuses Verhältnis zu ihren Klienten auf, den Lernenden als ganze Personen. In dieser Beziehung sind letztere noch nicht voll in ihrer Rolle entwickelt, nicht autonom und selbstbestimmt, sodass dieses Arbeitsbündnis neben der ohnehin stattfindenden Vermittlung von Wissen und Normen ständig reflektiert und neu definiert werden muss. Die Interaktion von Lehrkräften und Lernenden ist dann durch Routinen dieser Wissens-, Normen- und/oder Kompetenzförderung geprägt. Dieses Verhältnis gerät dann in eine „Krise“, wenn Routinen unterbrochen werden oder in einer bestimmten Situation fehlen bzw. nicht anwendbar sind. Oevermann (2008) versteht in diesem Zusammenhang, dass „die Krise der Normalfall ist und die Routine der Grenzfall“ (ebd.: 57), sodass ein analytisches Vorgehen z.B. durch eine Fallanalyse im pädagogischen Alltag Bestandteil professionellen Handelns wird bzw. im Sinne einer Professionalisierung werden sollte. Eine Krise kann somit als Anlass genommen werden, die Situation auf Basis des persönlichen Deutungswissens zu interpretieren und im Rahmen des „Arbeitsbündnisses“ – eines bewusst psychosozialen/-analytisch gewählten Begriffes des Verhältnisses zwischen Lehrendem und Lernendem, das zudem durch die Schulpflicht „erzwungen“ wird – zwischen den beiden Agierenden eine neue Routine zu entwickeln.
Tritt z.B. in einer – hier zum Zwecke der beispielhaften Darstellung unspezifizierten Unterrichtssituation – ein Mangel an Wissen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler zu Tage, kann die Lehrperson in dieser Krise Lösungsmöglichkeiten anbieten, um diese zu bewältigen. Die Krise besteht in diesem Zusammenhang aber auch in dem Widerspruch diffuser und spezifischer Sozialbeziehungen (vgl. Oevermann 1996), die zwischen Lehrperson und Schülerin/Schüler bestehen und damit einer Professionalisierung bedürfen: Inwieweit kommt die Lehrperson dem/der Lernenden entgegen? Entmündigt die Lehrperson den Schüler/die Schülerin möglicherweise in seiner Selbständigkeit und lebenspraktischen Autonomie als Individuum, indem das Wissen direkt vorgelegt wird, ohne vielleicht ein selbständiges, methodisches Lösen des Wissensdefizits zu evozieren?
Oevermann unterscheidet hier zwischen ingenieuralem Wissen, das in der pädagogischen Arbeit deduktiv Lösungen anbietet und begründet, sowie interventionspraktischem Wissen, welches sowohl standardisiertes Methodenwissen einbezieht (äußert sich in „Routine par excellence“ im alltäglichen Unterricht; vgl. Oevermann 2008: 59) wie auch das eher therapeutisch-intervenierende Wissen, das primär klientenzentriert ist und „die konkrete historische Lage und Situation des Klienten … rekonstruieren muss“ (ebd.). In diesem Zusammenhang definiert und unterscheidet Oevermann die Begriffe Lernen und Bildung, sodass ersteres auf der Vermittlung standardisierten Wissens fußt („Primat der Wissensvermittlung“, Oevermann 1996: 142), während „Bildung immer Krisenlösung und damit das Gegenteil von Routine“ (Oevermann 2008: 59) ist. Neben dem Primat der Wissensvermittlung beinhalte pädagogisches Handeln allerdings auch immer „Erziehen“,
weil die anlässlich der Wissens- und Normenvermittlung notwendig werdenden Lehrer-Schüler-Beziehungen angesichts … der Ungefestigtheit von Autonomie und Rollenhandlungsfähigkeit des Schülers in dieser Phase immer auch folgenreich sind für die Entwicklung des Schülers als ganzer Person. (Oevermann 1996: 147)
Bezugnehmend auf die Tatsache, dass ein therapeutisch-professionelles Handeln voraussetzt, dass vom Klienten eine gewisse „Freiwilligkeit“ ausgeht, sich therapieren zu lassen – d.h. dass Schülerinnen und Schüler von sich aus lern- und bildungswillig sind –, ist Oevermanns zentraler Kritikpunkt die deutsche Schulpflicht. Diese sieht er als mittlerweile obsolet an, da sie Pädagoginnen/Pädagogen und Kinder in ein erzwungenes Arbeitsbündnis bringt mit der Folge, „dass dem Kind die Neugierde als Hauptmotiv dafür, in der Schule zu sein, aberkannt wird“ (ebd.: 66). Darüber hinaus sieht er es als soziologisch und gesellschaftlich begründet an, dass spätestens zum aktuellen Grundschulalter der Kinder bereits in der Familie quasi automatisch die Krise entsteht, dass die Kinder die hochkomplexen Prozesse des Lesens, Schreiben und Rechnens erlernen müssen, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Da die Struktur der Familie dies nicht alleine bewerkstelligen kann, benötigt man ab diesem Zeitpunkt Lehrerinnen und Lehrer, die dieses Wissen vermitteln. In diesem Zusammenhang spricht Oevermann von Experten, was jedoch noch keine Professionalität ausmache. Diese sei erst durch eine fallorientiert-hermeneutische Lösungserarbeitung von Krisen und z.B. pädagogisch-erzieherischen Herausforderungen in der (Wieder-)Herstellung von Autonomie gegeben (1996, 2008).
Helsper (2004b) vertieft Oevermanns Grundidee als „strukturtheoretisch-rekonstruktiv“, indem das Unterbrechen der Routinen („ständige Drohung des Scheiterns“) vor allem durch situative Fallarbeit zu einem professionelleren Lehrer*innenhandeln führt. Zentral sieht Helsper damit einige unüberwindbare Antinomien in der Struktur des Lehrerhandelns (vgl. ebd.; vgl. auch Terhart 2011):
1 Begründungsantinomie entsteht dadurch, dass Lehrer*innenhandeln begründet Wissen und Lebenspraxis vermitteln soll, die entstehende Ungewissheit bzw. Unplanbarkeit im Unterricht diese Begründung aber erschwert.
2 Praxisantinomie meint, dass theoretisches Wissen nicht unmittelbar in der Praxis umgesetzt werden kann, dies aber für ein wissenschaftliches (= professionelles) Handeln nötig wäre.
3 Subsumtionsantinomie steht für die Schwierigkeit, Fälle pädagogischen Handelns wissenschaftlich zu typisieren bzw. zu hierarchisieren, dann allerdings wiederum durch die Subsumtion die Einzelfälle aus dem Blick zu verlieren.
4 Ungewissheitsantinomie bezieht sich auf die Tatsache, dass mit dem Lehrerhandeln der Anspruch verbunden ist, dass Schülerinnen und Schülern Wissen vermittelt wird, durch die Unplanbarkeit pädagogischen Handelns dies aber kaum garantiert werden kann.
5 Symmetrieantinomie (Machtantinomie) steht für die unterschiedlichen Positionen, die Lehrende und Lernende in ihrer Interaktion einnehmen, ein Arbeitsbündnis bedarf jedoch eines symmetrischen Verhältnisses der Agierenden.
6 Vertrauensantinomie: Das Arbeitsbündnis muss von gegenseitigem Vertrauen geprägt sein, allerdings muss ständig die mögliche Abhängigkeit des Kindes betrachtet sowie die jeweils von Lernenden als auch Lehrenden bestehende Persönlichkeit („persönliche Integrität“) gewahrt werden.
Auf eine zweite Ebene „der diffus-spezifischen Lagerung“ (Helsper 2001: 87) positioniert Helsper:
1 Näheantinomie beschreibt – und hängt damit nah mit der Vertrauensantinomie zusammen – das Verhältnis von Nähe und Distanz in der Interaktion von Lehrenden und Lernenden.
2 Sachantinomie als die Forderung eines Lebensweltbezugs der Unterrichtsgegenstände bei gleichzeitiger Vermittlung von „lebensweltlich gültigen, biografisch unterlegten Rahmungen der unterrichtlich behandelten Gegenstände auf dem Hintergrund der konkreten Individualität von Schülern“ (Helsper 2004b: 78).
3 Organisationsantinomie ist gemeinhin der organisatorisch-strukturelle Zwang von z.B. Räumlichkeiten, Stundenplänen und Lehrplänen, in denen Lehrerhandeln eingebettet wird.
4 Differenzierungsantinomie meint den gesellschaftlich-politischen Anspruch einer offenen Allgemeinbildung für alle Schülerinnen und Schüler, gleichzeitig aber die Herausforderung Bildung in individualisierter Form, d.h. individuelle Lernprozesse, anzustoßen.
5 Autonomieantinomie beschreibt letztlich die Aufgabe einer Lehrkraft, Grundlagen dafür zu legen, dass die Schülerinnen und Schüler autonome, mündige Bürgerinnen und Bürger werden, allerdings kann dies in der Schule nur im strukturell begrenzten Rahmen des Systems geschehen.
Auf den nächsthöheren Ebenen sammeln sich nach Helsper (2001) auflösbare organisationsbedingte Widersprüche, welche die Antinomien aufgrund der institutionalisierten Schulbildung begünstigen2, Dilemmata als Folge „der fallspezifischen und berufsbiographischen Auseinandersetzung mit diesen Antinomien und Widersprüchen“ (ebd.: 88) in Wechselwirkung der Lehrpersonen z.B. einer Schule sowie zuletzt Handlungsparadoxien, in denen professionelles Handeln zunehmend unmöglich wird aufgrund einer immer ungünstiger liegenden, unüberwindbaren Verquickung der auf den unteren Ebenen diametral gegenüberstehenden Antinomien, Widersprüchen und Dilemmata.
Helsper (2001, 2004b, 2007) versucht mittels dieser unterschiedlichen, hierarchisch zusammenhängenden Ebenen von Antinomien bis Paradoxien, das „Scheitern“ im Unterrichts- und Bildungsprozess zu begründen und gleichzeitig aufzuzeigen, dass diese Antinomien jederzeit bestehen, aber oft im Wesentlichen strukturimmanent und damit zwar nicht auflösbar sind, mit ihnen aber z.B. durch Fallarbeit reflexiv beim Vorkommen eines Routinebruchs oder Scheiterns umgegangen werden kann und dies auch in der Erwartungshaltung ungewisser Folgen im Lehrerhandeln bewusst sein sollte: „Vor diesem Hintergrund zeigt sich Professionalität in der Fähigkeit, die vielfachen Spannungen und genannten Antinomien sachgerecht handhaben zu können.“ (Terhart 2011: 206)
Die im Lehrerhandeln implizierte, durch die Struktur des schulischen Unterrichtens entstehende „Ungewissheit“ thematisieren sowohl Helsper (2008) als auch Combe (2005). Letzterer spricht dann von Irritationen und dem „Entstehen von Neuem“ in Unterrichtsprozessen und sieht Professionalisierung von Lehrpersonen im reflexiven Umgang damit: „Solche Erfahrungskrisen nicht abzuwehren, sondern für die eigene Entwicklung und Erkenntnis zu nutzen und mit ihnen umzugehen lernen, wäre eine zentrale Kompetenz eines lernenden Lehrers.“ (Combe 2005: 82) Combe und Buchen (1996) beziehen sich strukturtheoretisch in ihrer Deutung von Unterrichtsprozessen nicht nur auf die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden, sondern verknüpfen in ihrer Sichtweise die Sachinhalte und Unterrichtsgegenstände, welche ursächlich Brüche in den Interaktionsprozessen bewirken und Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler in ihrer Rolle haben können. Hericks (2009) bewertet es daher als „nur konsequent, auch die Professionalisierungsbedürftigkeit des Lehrerhandelns an dessen primäre Funktion, d.h. an die Wissens- und Normenvermittlung, selbst anzubinden“ (ebd.: 67). Wagner (1998) vertritt ebenfalls eine strukturtheoretische Sichtweise professionellen Lehrerhandelns und sieht zentral eine „Verflechtung von diffusen und spezifischen Sozialbeziehungen“ (ebd.: 159), stellt allerdings zudem die Sachinhalte des Unterrichtsprozesses in den Mittelpunkt, dessen professionelle Aufarbeitung den „Erwerb eines pädagogischen Habitus [erfordert], in dem Fallverstehen, Wissenschaftswissen, professionelle Deutungsschemata und das intuitive Verstehen feldspezifischer pädagogischer Probleme verbunden werden“ (Helsper 2014: 223, in Rückgriff auf Oevermann 2002).
Insbesondere die strukturtheoretische Deutung der Lehrerprofessionalität Oevermanns war wiederholt Gegenstand der Kritik, am weitreichendsten wohl durch den offenen Streit in der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, in der Baumert und Kunter (2006) den strukturtheoretischen Ansatz grundlegend kritisieren3, Helsper (2007) ein Jahr später dann diesen Ansatz (und Oevermann) jedoch dezidiert verteidigt. Die Kritik Baumerts und Kunter zielt primär auf die psychoanalytisch-therapeutische Komponente des strukturtheoretischen Ansatzes ab4, da er ihnen zum einen nicht weit genug geht und darüber hinaus eine diffuse Sozialbeziehung zwischen Lehrkräften und einzelnen Schülerinnen und Schülern überbetont, ohne zu beantworten,
wie Unterricht möglich ist und auf Dauer gestellt werden kann, systematisches und kumulatives Lernen über Kindheit und Jugend hinweg erreichbar und die kognitiven und motivationalen Voraussetzungen beruflicher, politischer, kultureller und zivilgesellschaftlicher Teilhabe für die gesamte nachwachsende Generation zu sichern sind und welche Anforderungen sich daraus für das Kompetenzprofil einer Lehrkraft ergeben. (Baumert/Kunter 2006: 472)
Auch die von Helsper zentral diskutierte Antinomie von Nähe und Distanz relativieren Baumert und Kunter, indem pädagogisches Handeln und Fürsorge für sie keinen Bezug zu therapeutischen Ansätzen und Konzepten oder gar Intimität bedeuten. Sie sehen strukturell in „der Organisation systematischen Lernens und des langfristigen Wissenserwerbs eine … bemerkenswerte Erfolgsgeschichte“ (ebd.: 473) und beziehen sich hier auf Prange (2000) und Tenorth (2006), kritisieren dabei gleichzeitig die von Oevermann und Helsper postulierten Elemente bzw. Momente des Scheiterns, der Krisen oder Brüche im Lehrer*innenhandeln, welche in ihren Augen eine zu negative Sicht einnehmen.
In seiner Replik auf Baumert und Kunter (2006) verteidigt Helsper (2007) den strukturtheoretischen Ansatz und relativiert unter anderem das sogenannte „Scheitern“ der Lehrperson, dass dieses von Baumert und Kunter zu drastisch dargestellt worden sei, es lediglich bedeute, dass aus strukturtheoretischer Sicht professionelles Handeln wie das einer Lehrperson „anfällig für Verwicklungen ist und dass es gerade einer gelassenen, reflexiven Haltung im Umgang damit bedarf“ (Helsper 2007: 570). Diese reflexive Haltung dürfe dann aber nicht nur allgemeinen Kriterien folgen, sondern müsse von Einzelfall zu Einzelfall neu betrachtet, individuell bestimmt werden und sei demnach nicht generalisierbar.
Helsper (2007) nimmt auch Stellung zu Baumert und Kunters zentraler Kritik des vermeintlichen Therapieverständnisses von Unterricht bzw. des „therapeutisch-prophylaktischen“ (Oevermann 1996: 142) Ansatzes, räumt Lehrpersonen ebenfalls (wie Baumert/Kunter 2006) eine hohe Bedeutung im Rahmen von schulischer Wissensvermittlung ein, stellt aber dennoch klar, dass Lehrende außerdem dafür verantwortlich seien, einen Bildungsprozess zu begleiten, bei dem die Schülerinnen und Schüler „noch nicht zwischen diffuser und spezifischer Handlungslogik unterscheiden und die Bedeutung des Lehrers nicht spezifisch eingrenzen“ (Helsper 2007: 568). Gleichzeitig vertrete der strukturtheoretische Ansatz „keine generalisierten Erziehungserwartungen“ (ebd.: 569), dennoch müsse das diffuse Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden, die nach Helsper nicht strukturbedingt, sondern pädagogisch sei (ebd.: 569), ständig „reflektiert und begrenzt werden“ (ebd.: 569). Daher sei das Fallverstehen im strukturtheoretischen Verständnis keine grundlegend therapeutische, d.h. biographisch-individuelle Aufarbeitung, sondern „die Rekonstruktion konkreter Schul- und Unterrichtsszenen“ (ebd.: 571).
Helspers Replik unterstellt Baumert/Kunter (2006) ein weitreichendes Missverständnis und eine falsche Darstellung des strukturtheoretischen Ansatzes sowie wenig Innovation in der Darstellung ihres eigenen Ansatzes (s. kompetenztheoretischer Bestimmungsansatz im nächsten Kapitel), der nach Helsper primär „Ansätze der Expertise- und Lehrerforschung [systematisiert]“ (Helsper 2007: 574). Er sieht im Versuch eines Vergleichs in diesem Modell verschiedener Konzeptionierungen von Wissen auch durchaus Anknüpfungspunkte für die strukturtheoretische Position, welche von anderen bereits aufgezeigt wurden, „von Baumert und Kunter aber weitgehend übergangen [werden]“ (ebd.: 574). Trotzdem empfiehlt Helsper auf Grundlage von Baumert/Kunter (2006) eine Erweiterung der strukturtheoretischen Position insbesondere dahingehend, „die Antinomie von Person und Sache“ (ebd.: 576), d.h. das eigentliche Unterrichten, sowie „den Erwerb und die Handlungsrelevanz ‚kasuistischen Wissens‘“ (ebd.) stärker in den Fokus zu stellen, was bis zu dem Zeitpunkt nur in geringem Maße umgesetzt worden sei.
Trotz der Kritik an Oevermanns strukturtheoretischer Sichtweise und Helspers Unternehmung, die in seinen Augen oft falsch rezipierten Grundannahmen in ein rechtes Licht zu rücken, verstehen viele weitere Pädagoginnen und Pädagogen schulisches und unterrichtliches Handeln als durch Strukturen bestimmt, schwächen Oevermanns und Helspers möglicherweise drastische Sichtweise aber ab, integrieren besonders Sachinhalte oder sehen andere Aspekte des Lehrerhandelns strukturtheoretisch als professionalisierungsbedürftiger als die Lehrer-Schüler-Interaktion. Professionelles Handeln im Rahmen eines strukturtheoretischen Ansatzes ist folglich zwar primär mit Wissens- und Normenvermittlung verknüpft, versteht sich in der pädagogischen Praxis aber auch in der Diskussion und Interpretation der durch die vorgegebene Struktur und den dadurch vorliegenden Antinomien entstehende Interaktion zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen/Schülern sowie den Unterrichtsgegenständen. Die Rollen, die die Akteure im Unterrichtsgeschehen einnehmen, sind hier zentral und daher von den Positionen und ihren Begründungen oft auf zwei Personen (Lehrperson – Lerndende/r) beschränkt, während Unterrichtsalltag meist die Interaktion einer Gruppe oder der Lehrperson mit einer Gruppe darstellt. Der strukturtheoretische Ansatz verfolgt demnach hier einen ständigen Dialog zwischen den handelnden Personen auf verschiedenen Ebenen und sieht Professionalisierungsbedürftigkeit darin, die persönliche Integrität der Klienten im Bildungsprozess – oder trotz des Bildungsprozesses – insbesondere auch durch Zwänge und Vorbestimmungen der Institution Schule und anderer formaler Vorgaben zu wahren (vgl. Hericks 2009).