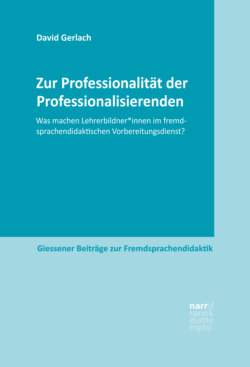Читать книгу Zur Professionalität der Professionalisierenden - David Gerlach - Страница 18
3.1.1 Standards und domänenspezifisches Professionswissen
ОглавлениеIn einer auch durch den „PISA-Schock“ bedingten und – ebenfalls dadurch – verstärkten empirischen Bildungsforschung im quantitativen Paradigma sind neben qualitätsoptimierenden und länderübergreifend verbindlichen Bildungsstandards für Schülerinnen und Schülern parallel Lehrerbildungsstandards entstanden, die hier zunächst zusammengefasst dargestellt werden sollen, um sie dann in Bezug mit der empirischen Forschung zum domänenspezifischen Professionswissen von Fremdsprachenlehrkräften in Beziehung zu setzen.1
In ihrem Dokument Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung formuliert die KMK (2017)2 im Anschluss an die vorher bereits für die Bildungswissenschaften festgelegten Standards (KMK 2014) untergliedert in einzelne Fachprofile je spezifische Wissensbestände und Kompetenzen, die die Lehramtsstudierenden zum Ende ihres Studiums vorweisen sollen.3 Für die Gestaltung der Studieninhalte werden wiederum spezifische Inhalte als Vorgaben für jedes Fach bzw. jeden Fachbereich – hier: Neue Fremdsprachen (KMK 2017: 44-46) – zusammengestellt. Für die modernen Fremdsprachen gilt dabei: „Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen über Kompetenzen in der Fremdsprachenpraxis, der Sprachwissenschaft, der Literaturwissenschaft, der Kulturwissenschaft sowie in der Fachdidaktik.“ (KMK 2017: 44) Dabei sind umfassende Kompetenzen im Bereich der Sprachpraxis und der Fachdidaktik zu erwerben, für die Fachwissenschaften wird für das Gymnasium bzw. die Sekundarstufe II noch eine Erweiterung und Vertiefung der jeweiligen Studieninhalte der Sekundarstufe I erforderlich. Das Fachprofil der Neuen Fremdsprachen kennzeichnet sich durch die folgenden Anforderungen an die Lehramtskandidatinnen und -kandidaten. Diese
verfügen über ein vertieftes Sprachwissen und „nativnahes“ Sprachkönnen in der Fremdsprache; sie sind in der Lage, ihre fremdsprachliche und interkulturelle Kompetenz auf dem erworbenen Niveau zu erhalten und ständig zu aktualisieren,
können auf vertieftes, strukturiertes und anschlussfähiges Fachwissen in den Teilgebieten der Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft zugreifen und grundlegende wie aktuelle Fragestellungen und Methoden erkennen und weiterentwickeln,
verfügen über Erkenntnis- und Arbeitsmethoden im jeweiligen Fach sowie über einen Habitus des forschenden Lernens,
besitzen die Fähigkeit zur Analyse und Didaktisierung von Texten, insbesondere von literarischen, Sach- und Gebrauchstexten sowie von diskontinuierlichen Texten,
können fachliche und fachdidaktische Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlich adäquat und reflektiert darstellen sowie die gesellschaftliche Bedeutung der Disziplin und des Fremdsprachenunterrichts in der Schule analytisch beschreiben,
kennen die wichtigsten Ansätze der Sprach-, Literatur-, Kultur- und Mediendidaktik und können diese für den Unterricht nutzen,
verfügen über ausbaufähiges Orientierungswissen und Reflexivität im Hinblick auf fremdsprachliche Lehr- und Lernprozesse auch unter dem Gesichtspunkt von Mehrsprachigkeit, Heterogenität und inklusiven Unterricht,
kennen Möglichkeiten der Gestaltung von Lehr- und Lernarrangements insbesondere unter Berücksichtigung heterogener Lernvoraussetzungen und Inklusion,
verfügen über vertieftes Wissen zur Entwicklung und Förderung von kommunikativer, interkultureller und textbezogener fremdsprachlicher Kompetenz, methodischer Kompetenz und Sprachlernkompetenz von Schülerinnen und Schülern,
verfügen über erste reflektierte Erfahrungen in der kompetenzorientierten Planung und Durchführung von Fremdsprachenunterricht in heterogenen Lerngruppen z.B. im Hinblick auf zieldifferenten und zielgleichen Unterricht und kennen Grundlagen der Leistungsdiagnose und -beurteilung im Fach,
können auf der Grundlage ihrer fachbezogenen Expertise hinsichtlich der Planung und Gestaltung eines inklusiven Unterrichts mit sonderpädagogisch qualifizierten Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Personal zusammenarbeiten und mit ihnen gemeinsam entsprechende Lernangebote entwickeln,
sind sensibilisiert für den Bedarf an barrierefreien Lernmedien von Lernenden mit Behinderungen. (KMK 2017: 44)
Es fällt auf, dass ein Teil der Facetten sowie auch die hier nicht näher vorgestellten Studieninhalte nicht immer rein fremdsprachendidaktischer Natur sind. So sind insbesondere die Anforderungen für inklusives Unterrichten nicht im Besonderen fachdidaktisch geprägt, Aspekte von Textarbeit spielen neben den Fremdsprachen logischerweise auch im Besonderen im Fach Deutsch eine gewichtige Rolle, allerdings scheint die Forderung „ein Habitus des forschenden Lernens“ (s.o.) auf den ersten Blick ebenso für andere Fächer relevant, taucht in den KMK-Standards in der Tat allerdings in dieser Explizitheit nur bei den Neuen Fremdsprachen auf, ansonsten in keinem anderen Fachprofil. Auch die Anforderungsniveaus innerhalb des Profils unterscheiden sich teilweise: Während ein „nativnahes“ Sprachvermögen bzw. die Fähigkeit zur Didaktisierung literarischer Texte deutlich hohe Anforderungen an die Fähig- und Fertigkeiten der Studienabsolventinnen und -absolventen stellen, werden andere Wissensbestände häufig als „vertieft“, zumindest „anschluss- oder ausbaufähig“ charakterisiert, im Hinblick auf einen kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht reichen „erste reflektierte Erfahrungen“ aus. Die Abstraktion von Lehrkompetenzen in dieser Form ist aus fremdsprachendidaktischer Perspektive kritisiert worden: „Sie beruht auf der Annahme, dass die Gemeinsamkeiten beim Fremdsprachenlernen und -lehren groß genug sind, um die Kompetenzen (sprach)übergreifend formulieren zu können.“ (Lütge 2012: 192) Neben einer mangelhaften Ausschärfung fachdidaktischer Konzepte, d.h. dem Verbleib auf einer dort sehr allgemeinen Ebene, wird als Kritik ebenfalls aufgeführt, dass kaum konkrete Studieninhalte für die Literatur- und Kulturwissenschaften sowie die Linguistik ausformuliert wurden (Deutscher Anglistenverband/Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien 2009), was in späteren Fassungen jedoch zumindest in Teilen ergänzt wurde.4 Wie Dausend (2017) noch dazu richtigerweise – hier im Kontext von Primarenglischlehrkräften – darstellt, sind die KMK-Vorgaben zwar als solche zu verstehen, allerdings finden sie aufgrund des deutschen Bildungsföderalismus selten eine vollständige Entsprechung in den innerhalb der einzelnen Länder festgelegten Standards.5 Dennoch: Die KMK-Standards zu den Bildungswissenschaften bzw. auch die frühen Entwürfe zu fachwissenschaftlichen sowie fachdidaktischen Studienanteilen bilden für die größeren empirischen Untersuchungen der Folgejahre wie TEDS-LT und PKE eine bedeutende Grundlage hinsichtlich der Entwicklung von Testitems und anzuwendender Konstrukte, weswegen sie hier wiederum besondere Bedeutung erlangen.
Während die im vorherigen Kapitel bereits vorgestellte COACTIV-Studie verschiedene Dimensionen des Lehrerwissens untersucht, ist der Ansatz der TEDS-LT-Studie (Teacher Education and Development Study: Learning to Teach; Blömeke 2013) von den theoretischen Grundannahmen – trotz fachlicher Ausschärfungen – durchaus vergleichbar und in der Tradition von Shulman (1986) und seiner Unterscheidung der Wissensformen und im Anschluss an Weinerts Kompetenzdefinition (2001b) zu sehen.6 TEDS-LT erhebt das Wissen bzw. Kompetenzen angehender Mathematik-, Deutsch- und Englischlehrkräfte zum Zeitpunkt des Bachelor- und Masterabschlusses, für Englischlehrkräfte im Besonderen dargestellt in Roters et al. (2011), auch in Reaktion zu den mittels der KMK-Standards angelegten Anforderungen. Diese Grundüberlegungen und Konstrukte werden vom Projekt Professionelle Kompetenz angehender Englischlehrkräfte (PKE) aufgegriffen mit dem Ziel, mittels quantitativer Verfahren und Tests verschiedener Konstrukte und Dimensionen in Schulmanscher Tradition allgemeinpädagogisches Wissen, Fachwissen sowie fachdidaktisches Wissen von (angehenden) Englischlehrerinnen und -lehrern über die beiden ersten Phasen hinweg zu erfassen und zu modellieren (vgl. König et al. 2016/2017). Die Analyse der Testitems7 von ca. 440 Englischlehrkräften in beiden Phasen sowie unterschieden in Sekundarstufe I und II ergeben Zusammenhänge zwischen fachdidaktischem und jeweils Fach- und allgemein-pädagogischem Wissen, jedoch korrelieren das Fachwissen und das pädagogische Wissen in geringerem Maße als in der vergleichbaren COACTIV-Studie zu Mathematiklehrkräften, was die Autorinnen und Autoren auf die große Bedeutung von z.B. zu vermittelnder literatur- und kulturwissenschaftlicher Inhalte in der Sekundarstufe II zurückführen. Nicht überraschend ist die Tatsache, dass das fachdidaktische und pädagogische Wissen der Referendarinnen und Referendare im Sample stärker ausgeprägt ist als dasjenige der Studierenden, jedoch scheint sich bezüglich des Fachwissens keine Veränderung, sprich: Zunahme, von der ersten zur zweiten Phase ausmachen zu können. Dies lässt sich in der Tat anknüpfen an Erkenntnisse aus TEDS-LT (vgl. Blömeke et al. 2013, für Englisch: Jansing et al. 2013), wo auch zwischen den beiden Studierendenkohorten keine signifikante Steigerung des Fachwissens im Studienverlauf nachgewiesen werden konnte, jedoch im Bereich des fachdidaktischen Wissens ein Zuwachs auftrat (vgl. Roters et al. 2011). König et al. (2016) merken im Rahmen der Diskussion von Grenzen ihrer Untersuchung an, dass sie in ihrem Projekt lediglich die kognitive Dimension von Lehrerwissensbeständen prüfen, dabei aber andere Dispositionen vernachlässigen:
[Such] dispositions are relevant, but should be extended theoretically and empirically with respect to the situation-specific skills of perception, interpretation, and decision-making to adequately model proximal indicators for teacher performance in class. (König et al. 2016: 12)
Das im Verfahren abgeprüfte fachdidaktische Wissen bzw. die konkreten Items werden in den Publikationen zwar auszugsweise aufgeführt, jedoch nur grob in den Dimensionen „Knowledge of curriculum“, „Knowledge of teaching strategies and representations“ sowie „Knowledge of students“ zusammengefasst (vgl. ebd.: 8). Für das Fachwissen wird in Kontrastierung zum mathematischen verschiedentlich angemerkt, dass es von anderer Qualität und „akademischer“ sei. Literatur- und Kulturwissenschaften seien daher eher „the academic foundation for the EFL [English as a Foreign Language; Anmerkung D.G.] teacher to become a cultural expert in English and to develop the competences of an intercultural speaker, not a native speaker“ (ebd.).
Diese Schwerpunkte bilden auch einen der zentralen Kerne des Projekts FALKO-E (vgl. Kirchhoff 2017). Ausgehend von den zentralen Erkenntnissen der vorliegenden empirischen Studien, insbesondere der Tatsache, dass das Fach Englisch als gering strukturierte Wissensdomäne zu fassen ist (vgl. Roters et al. 2011, Blömeke 2014a), unternimmt FALKO-E als Baustein des an der Universität Regensburg interdisziplinär angelegten Vorhabens FALKO – Fachspezifische Lehrkompetenzen (vgl. Krauss et al. 2017) den Versuch, fachdidaktisches Professionswissen sowie Fachwissen von Englischlehrkräften der Sekundarstufe I zu erfassen und greift dabei „teilweise auch auf qualitative und hermeneutische Forschungsarbeiten zurück“ (Kirchhoff 2016: 76), die im Feld vorliegen und unten noch detaillierter vorgestellt werden. Für Kirchhoff (2016) ist im Sinne eines englischdidaktisch spezifischen Professionswissens nicht nur deklaratives Wissen zentral, sondern auch ein Erfahrungswissen „im Sinne der Erfahrung im fachspezifischen unterrichtlichen Handeln“ (ebd.: 76). In FALKO-E (FALKO-Englisch) zeigen sich die Facetten englischdidaktisch-spezifischen Professionswissens unterteilt in „Wissen um schülergerechtes Erklären und Repräsentieren“, „Wissen um Schülerkognitionen“, „Wissen um Lehr-/Lernpotential von Aufgaben und Texten“ sowie Fachwissen als „[vertieftes] Hintergrundwissen über Fachinhalte des Curriculums der Sekundarstufe“ (Kirchhoff 2017: 120). Sie stellt die besonderen Schwierigkeiten beim Herausarbeiten und Zusammenstellen vor allem der fachdidaktischen, normativ geprägten Items heraus, welche durch empirische Erkenntnisse sowie Augenscheinvalidität in Pretests entwickelt und begutachtet werden (vgl. Kirchhoff 2016). Ebenfalls im Zusammenhang der Entwicklung eines Testverfahrens zur Messung des Professionswissens angehender Spanischlehrkräfte, welches in seiner Itementwicklung stark an die KMK-Standards für Lehrpersonen wie Lernende angelegt ist, zeigt sich, „dass das geplante Testverfahren in der Praxis auf Grenzen stößt“ (Hoinkes/Weigang 2016: 71). Dies scheint daher, primär aufgrund der geringen Strukturiertheit der fremdsprachendidaktischen Wissensdomäne, ein durchaus generelles Problem hinsichtlich dieser Forschungsansätze darzustellen.
Auch innerhalb des qualitativen Forschungsparadigmas liegen einschlägige Arbeiten zum Professionswissen von Fremdsprachenlehrpersonen vor, welche international häufig mit Konstrukten der Expertiseforschung z.B. im Anschluss an Berliner (1988) und Dreyfus et al. (1986) arbeiten, im deutschsprachigen Kontext häufig vom Forschungsprogramm Subjektive Theorien (s.u.) und wissenssoziologischer Forschung beeinflusst wurden. Tsui (2003), beispielhaft für den internationalen Kontext, untersucht in ausführlichen Falldarstellungen von vier Englischlehrkräften in Hong Kong deren Unterrichtserleben und vergleicht Unterschiede zwischen Novizen und Experten, welche sie am kritisch-reflexiven Umgang und progressivem Problemlösen von pädagogischen und fachdidaktischen Herausforderungen herausarbeitet. Während Novizen – wie auch in anderen Kontexten beschrieben – in gewissem Maße ein „Überleben“ beschreiben, gelingt es Fremdsprachenlehrkräften, die als Experten bezeichnet werden können, schneller, Unterricht von den Lernenden aus zu planen, verschiedene theoretische, allgemeinpädagogische wie fachdidaktische Konzepte im Unterricht zu verschränken und situativ reflektiert zu agieren (vgl. Tsui 2003, Borg 2006): „Kurz gesagt verfügen erfahrene Lehrende über ein größeres Instrumentarium, um die Komplexität des Unterrichts zu handhaben.“ (Schart 2014: 45)8 Trotz dass davon ausgegangen werden kann, dass explizit vorliegendes Expertenwissen Lehrerhandeln z.B. für Unterrichtsplanung beeinflussen kann, ist unter wissenssoziologischer Perspektive, wie auch im vorigen Kapitel angemerkt, die konkrete Offenbarung als Performanz von Wissen und Kompetenzen, die sich z.B. in der Planungs- oder Unterrichtspraxis zeigt, forschungsmethodologisch und -pragmatisch häufig nicht ohne größeren Aufwand erhebbar. Diesem Desiderat kam die DESI-Studie (Deutsch Englisch Schülerleistungen International) insofern basal nach, als dass sie neben Testungen von Lernendenleistungen sowie der Videographie von Unterrichtsstunden und deren Analyse auch mittels (quantitativer) Fragebögen Aspekte von Lehrerwissen erhob, zu Aussagen über Prozessqualität und Unterrichtspraxis in unterschiedlicher Hinsicht kommt und damit einen Zusammenhang zwischen Expertenwissen der Lehrkräfte und guten Leistungen der Lernenden herausgearbeitet hat (vgl. DESI-Konsortium 2008).
| Wissensdomänen Englischunterricht | Sub-Dimensionen | |
| Fachwissen | Wissen über das Sprachsystem | Phonologie Lexis Grammatik Diskursfähigkeit |
| Wissen über Literatur und Kultur | Kulturelle Diskursfähigkeit Literarische Analysefähigkeit | |
| Fachdidaktisches Wissen | Sprachverarbeitung und -produktion | Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben + Integration der vier Fertigkeiten |
| Wissen um Lernstrategien | Risk-taking Ambiguitätstoleranz Self-monitoring Kommunikationsstrategien | |
| Wissen um Lehrstrategien | Unterschiedliche Typen von Aktivitäten Unterschied zwischen fluency- und accuracy-basierenden Aktivitäten Adaptation von Materialien für unterschiedliche Anforderungsbereiche | |
| Wissen über Lernende | Lernerkognitionen und falsche Auffassungen über Lernen/Lehren Vorwissen Entwicklung von Lernen Motivation | |
| Wissen um interkulturelle Interaktion | Lernerwissen, Fähigkeiten und Strategien, um interkulturell kommunizieren zu können | |
| Kontext- und Curriculumwissen | Wissen über den Bildungskontext, Absichten, Ziele und Zweck Materialien und Programme als Handwerkszeug der Lehrkraft Verstehen des Lernpotentials von Heranwachsenden, Bildungsstandards, Curricula, (interne) Schulentwicklungsabsichten/-programme | |
| Allgemein-pädagogisches Wissen | Lernmanagement | Motivation der Lernenden Empowerment von Lernenden Classroom management |
| Ressourcenmanagement | Authentizität Verfügbarkeit Angemessenheit der verwendeten Materialien |
Tab. 1:
Wissensdomänen von Englischlehrpersonen (Roters 2017: 171; eigene Übersetzung).
In einer Zusammenschau überwiegend internationaler Studien zum Wissen von Englischlehrkräften9 stellt Roters (2017), unterteilt nach den Oberkategorien Shulmans (1986), Domänen und Subdomänen zusammen, die in Tabelle 1 dargestellt werden. Sie erklärt, dass die einzelnen Dimensionen als interdependent zu verstehen sind, was auch PKE und FALKO-E zeigen können, gleichzeitig diese Einteilung keineswegs einen Vollständigkeitsanspruch erheben kann und weiterer Ausschärfung bedarf. Insbesondere Aspekte des über die Zeit formaler (Aus-)Bildung und Lehrtätigkeit generierten Erfahrungswissens, der „apprenticeship of observation“ (Lortie 1975) anderer professionell Agierender (auch der eigenen Schulzeit), des Reflektierens theoretischer Wissensbestände sowie die eigenen Beliefs spielen eine besondere Rolle, die mit quantitativen Erhebungen nur schwer ermittelbar erscheinen. Mit diesen, in der Tendenz anderen Formen von Wissen, „the hidden side of work“ wie Freeman (2002) es in einem vielzitierten Aufsatz bezeichnet, beschäftigt sich Joachim Appel (2000), der als einer der ersten im deutschsprachigen Raum dezidiert das Erfahrungswissen von Fremdsprachenlehrer*innen untersucht. Er fokussiert hier im Besonderen auf inkorporierte Alltagserfahrungen innerhalb einer Kultur des Fremdsprachenunterrichts danach fragend, wie kollektive Werte und Lehrer*innenwissen aus der Praxis durch Lerngelegenheiten geformt, berufsbiographisch bestimmt und zu theoretischem Wissen reflexiv in Beziehung gesetzt werden. Dazu interviewt er teilstrukturiert-narrativ 20 Lehrerinnen und Lehrer auf Grundlage kognitiver theoretischer Konstrukte wie Subjektive Theorien und Beliefs (s.u.), personenbezogenen Aspekten von Erfahrungswissen im Sinne eines Personal Practical Knowledge (Elbaz 1983) und des Pedagogical Content Knowledge in Anschluss an Shulman (1986). Zum einen werden verschiedene Kontexte herausgearbeitet, die eher personaler oder interaktionaler Natur mit Lernenden und Kolleg*innen sind wie beispielsweise der Umgang mit administrativen Vorgaben, Unabwägbarkeiten bei der Unterrichtsplanung oder die Beziehungsebene. Zum anderen extrahiert Appel Dimensionen fremdsprachendidaktischen Erfahrungswissens, das u.a. den Wert von Auslandserfahrungen sowie die Bedeutung des Lehrwerks als zentral darstellt und methodisch-didaktische Grundannahmen von Grammatik sowie Unterrichtskommunikation der untersuchten Lehrerinnen und Lehrer zusammenzustellen vermag.10