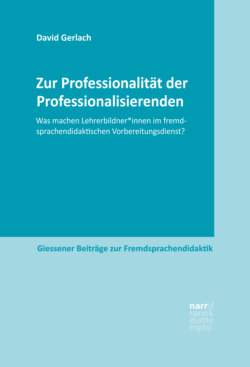Читать книгу Zur Professionalität der Professionalisierenden - David Gerlach - Страница 17
3.1 Forschung zu Fremdsprachenlehrerprofessionalität
ОглавлениеEs lässt sich für die deutsche Fremdsprachenforschung durchaus unterstellen, dass eine domänenspezifisch breite Professionsforschung von Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrern bis in die Anfänge dieses Jahrtausends kaum vorhanden war. Roters und Trautmann (2014) sowie Königs (2014) sehen hier insbesondere die starke Lernerorientierung der vorhergehenden Jahrzehnte als eine der Hauptursachen, welche sich primär mit den – nicht minder wichtigen – Lernprozessen der Schülerinnen und Schüler beschäftigte, was jedoch dazu führte, dass die Lehrperson zunehmend in den Hintergrund rückte. Königs (2014) geht sogar so weit zu fragen: „War die Lernerorientierung ein Irrtum?“ (ebd.: 66) und diagnostiziert ein Zurückbleiben der fremdsprachendidaktischen gegenüber der schulpädagogischen Forschung (möglicherweise ebenso anderer Fachdidaktiken) im Hinblick auf den Einfluss und die Rolle der Lehrkraft im (Fremdsprachen-)Unterricht. Auch Viebrock (2014) stellt – beispielhaft für das Feld des bilingualen Unterrichts – ein recht geringes Interesse fremdsprachendidaktisch motivierter Professionsforschung fest und begründet dies mit dem eher auf Lernprozesse eingeschränkten Fokus:
Ein Grund hierfür mag sein, dass sich die Fremdsprachendidaktik … in erster Linie mit einem begrenzten, wenn auch zentralen Ausschnitt der Tätigkeit von Lehrer*innen befassen, nämlich der Inszenierung und Reflexion fachlicher und sprachlicher Lernprozesse, weniger aber mit den allgemeinpädagogischen und administrativen Aufgabenfeldern, welche der Lehrberuf darüber hinaus umfasst. (ebd.: 73)
Die Fokussierung auf Lernprozesse führte ebenfalls international zum Ende des vergangenen Jahrhunderts eher zu methodisch-didaktischen Ratgebern – oder eher: Rezeptgebern – für Unterricht, die konzeptionell durchdacht, aber nur selten empirisch angebunden waren:
The literature on teacher education in language teaching is slight compared with the literature on issues such as methods and techniques for classroom teaching. Few of the articles published in the last twenty years are data-based, and most consist of anecdotal wish lists of what is best for the teacher. (Richards/Nunan 1990: XI)1
Die empirische Wende im Feld der Fremdsprachenlehrerbildung diskutiert für den internationalen Kontext Freeman (2009) und stellt diese bildlich als Wirbel dar, der sich weiter ausbreitet und damit immer mehr Felder und Fragestellungen abdeckt (s. Abbildung 5): Nach separater Betrachtung von Lehrkräftetraining im Sinne universitärer bzw. institutionalisierter Ausbildung und dem Einsetzen der Idee von beruflicher und professioneller Weiterentwicklung (Development) seit den 80er Jahren treten das Aufbauen einer Forschungsbasis und weitergehender, umfassenderer Konzeptualisierungsansätze in den 90er Jahren in den Vordergrund, während diese seit den 2000er Jahren um operationale, primäre soziologische Fragestellungen ergänzt werden, die sich um Fremdsprachenlehreridentität, -sozialisation und situierte Praxis drehen (vgl. Freeman 2009).
Abb. 5:
The Widening Gyre of Second Language Teacher Education (Freeman 2009: 14).
Im Forschungsüberblick zeigt sich dem folgend, dass Lehrerinnen und Lehrer immer wieder (und zunehmend) eine Rolle in fremdsprachendidaktischen Publikationen spielen und natürlicherweise bei der Implementation innovativer Lehr- und Lernmethoden sowie konzeptionell-explorativen Vorhaben z.B. zu (inter-)kulturellen Aspekten als bedeutsam herausgestellt werden (vgl. zur Übersicht Caspari 2016). Jedoch wurden empirisch dann häufig nur Effekte auf Seiten der Lernenden gemessen, während die Lehrkraft eine untergeordnete, gleichsam instrumentalisierte Rolle spielt, obwohl ihr – auch medienwirksam durch Hattie (2009) – ein deutlich größerer und unmittelbarerer Einfluss auf Lernprozesse eingeräumt wird als bestimmte Methoden oder Medien. Caspari (2016) sieht als einen Grund für einen starken Fokus auf beide Perspektiven bzw. ein weitgehendes Fehlen von reinen Wirksamkeitsstudien zu Fremdsprachenlehrkräften die hohe Komplexität des Unterrichts und dessen Interaktionsprozesse sowie das, insbesondere im deutschsprachigen Kontext, vorherrschende Menschenbild, welches Lehrkräfte als Subjekte wahrnimmt und sich damit häufig in der Beforschung seiner Glaubenssätze und Überzeugungen, der „Innensicht“ (Caspari 2016: 45), widmet, was unten auch noch ausführlicher dargestellt werden wird.
Es lassen sich bei der Durchsicht der einschlägigen Publikationen der letzten zwei Jahrzehnte im deutschsprachigen Raum, auf die und den hier fokussiert werden soll, insbesondere drei Forschungsschwerpunkte ausmachen: Zum einen ist in den vergangenen Jahren, vorrangig beeinflusst durch die empirische Bildungsforschung und die Entwicklungen um die COACTIV-Gruppe, eine deutliche Verschiebung der Forschungsaktivität hin zu 1) domänenspezifischem Professionswissen zu beobachten. Innerhalb dieses Feldes herrscht dann vorwiegend ein quantitatives Forschungsparadigma. In den beiden anderen Schwerpunkten findet man tendenziell eher qualitative Ansätze, die sich 2) mit Fremdsprachenlehrerkognitionen, Beliefs und Reflexivität beschäftigen sowie 3) Forschungsprojekte, die bestimmte Interventionen z.B. in Form von Praktika oder Aktionsforschungsprojekten hinsichtlich ihres Professionalisierungspotentials betrachten. Interessanterweise lassen sich internationale Forschungsberichte, die sich schlagwortartig im Feld (Foreign) Language teacher (professional) development zeigen, in ähnlicher Weise in diese drei thematischen Unterthemen eingruppieren, weswegen sie hier auch gemeinsam mit der Forschung aus dem deutschsprachigen Raum ergänzend einbezogen werden, sofern es sinnvoll erscheint. Crandall und Christison (2016) identifizieren beispielsweise beginnend mit den 90er Jahren die folgenden fünf Schwerpunkte in der internationalen Forschung zur (Englisch-)Fremdsprachenlehrerbildung:
Language teacher cognition, teacher expertise, and novice teacher development
Teacher identity, globalization, and non-native English-speaking teachers (NNESTs)
Reflection and reflective teaching
Classroom research, action research, and teacher research
Language teacher learning, collaboration, communities of practice (CoPs), and professional learning communities (PLCs) (ebd.: 6)
Diese Forschungsfelder finden sich ebenso in der nun avisierten Unterteilung in drei Schwerpunkten wieder, wenn auch im deutschen Diskurs – und das mag vorangestellt sein – die Stellung von Nicht-Muttersprachler*innen2 sowie Globalisierung nicht vorhandene bis eher untergeordnete Rollen zu spielen scheinen. Die übrigen Items internationaler Forschungsschwerpunkte hingegen lassen sich unproblematisch in die nun folgende Unterteilung nach 1) Standards und domänenspezifischem Professionswissen, 2) Beliefs, Subjektive Theorien und Reflexivität sowie 3) Aktionsforschung und Interventionen eingliedern, welche oben bereits schwerpunktmäßig für den deutschsprachigen Raum identifiziert wurden, nun dezidiert mitsamt ihrer Forschungsansätze und -richtungen aufgeführt werden und dann im Anschluss in ihrer Gesamtschau und den im einleitenden Abschnitt dieses dritten Kapitels aufgeworfenen Fragen bewertet werden sollen.