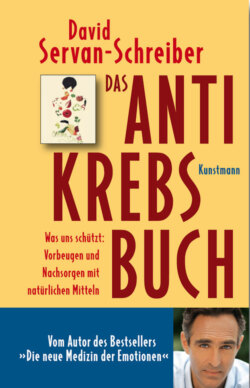Читать книгу Das Antikrebs-Buch - David Servan-Schreiber - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 3
GEFAHR UND CHANCE Ich werde »Patient«
ОглавлениеALS ICH ERFUHR, dass ich einen Hirntumor hatte, geriet ich über Nacht in eine Welt, die mir zwar bekannt vorkam, von der ich tatsächlich aber kaum etwas wusste: die Welt des Patienten.
Den Neurochirurgen, an den ich sofort überwiesen wurde, kannte ich flüchtig. Wir hatten gemeinsame Patienten, und er interessierte sich für meine Forschungen am Gehirn. Doch nach der Entdeckung meines Tumors veränderten sich unsere Gespräche völlig. Von meinen wissenschaftlichen Experimenten war nicht mehr die Rede. Ich musste mich buchstäblich entblößen, die intimsten Details meines Lebens offenbaren, meine Symptome ausführlich schildern: Wir sprachen über meine Kopfschmerzen, meine Übelkeit, die Möglichkeit epileptischer Anfälle. Meiner beruflichen Attribute beraubt, wurde ich zum gewöhnlichen Patienten. Ich hatte das Gefühl, mir würde der Boden unter den Füßen weggezogen.
Und ich klammerte mich an meinen Status als Mediziner. Zu meinen Arztterminen trug ich meinen weißen Kittel mit dem Schild, das meinen Namen und Titel angab – was ziemlich kläglich gewirkt haben muss. In meinem Krankenhaus legte man Wert auf Hierarchien, und die Schwestern und Pfleger nannten die Ärzte respektvoll »Doktor«. Doch auf der Untersuchungsliege und ohne meinen weißen Kittel wurde ich zu »Mr. Soundso«, oder wurde sogar mit »Honey« angesprochen. Wie alle anderen saß ich im Wartezimmer, das ich als Arzt im Eilschritt durchmessen hatte, mit erhobenem Kopf, jeden Blickkontakt mit Patienten meidend, um nur nicht aufgehalten zu werden. Wie alle anderen wurde ich nun im Rollstuhl ins Untersuchungszimmer geschoben. Was zählte es jetzt, dass ich in der übrigen Zeit durch die Flure eilte? »Das ist nun einmal so üblich«, sagten die Pfleger. Ich fügte mich und ließ mich behandeln wie jemand, dem man nicht einmal mehr zutraute, selbst zu laufen.
Ich geriet in eine graue Welt, in der die Patienten keinen Titel, keine Qualifikation, keinen Beruf hatten. Hier interessierte sich niemand dafür, was man im Leben machte oder was einem durch den Kopf ging. Das einzig Interessante an mir war oft nur die neueste Aufnahme meines Gehirns. Ich musste feststellen, dass die meisten Ärzte nicht wussten, wie sie mich als Patienten und Kollegen in einer Person behandeln sollten. Bei einer Einladung zum Abendessen traf ich zufällig meinen damaligen Onkologen, einen brillanten Spezialisten, den ich sehr schätzte. Er war der Situation offensichtlich nicht gewachsen, stand auf, wurde blass und ging unter einem fadenscheinigen Vorwand. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass es einen Club der Lebenden gab und man mir signalisierte, dass ich nicht mehr Mitglied war. Ich bekam es mit der Angst zu tun; Angst, dass man mich einer anderen Kategorie zuordnete, der Kategorie von Menschen, die sich durch ihre Krankheit definieren. Ich hatte Angst, allmählich unsichtbar zu werden. Angst, nicht mehr richtig zu existieren, obwohl ich noch gar nicht tot war. Vielleicht würde ich bald sterben, aber bis dahin wollte ich mein Leben wie ein ganz normaler Mensch leben.
Einige Tage nach den Scanner-Aufnahmen mit Jonathan und Doug kam mein Bruder Édouard geschäftlich nach Pittsburgh. Ich hatte noch niemandem außer Anna von meiner Krankheit erzählt. Mit einem Kloß im Hals weihte ich Édouard ein, so gut ich konnte. Ich hatte Angst, ihm wehzutun, und fürchtete seltsamerweise, damit das Verhängnis erst recht heraufzubeschwören. Édouards schöne blaue Augen füllten sich mit Tränen, aber er wurde nicht panisch. Er nahm mich einfach in den Arm. Wir weinten zusammen und sprachen dann über Behandlungsmöglichkeiten, Statistiken und das, was mir nun bevorstand. Und dann brachte er mich zum Lachen, wie er es so gut konnte, indem er mich daran erinnerte, dass ich mit kahl rasiertem Kopf doch noch wie ein Punk aussehen würde – damals, mit achtzehn, hatte ich es nicht gewagt … Zumindest für ihn zählte ich noch zu den Lebenden.
Am nächsten Tag gingen Anna, Édouard und ich in der Nähe des Krankenhauses zusammen Mittag essen. Wir verließen das Restaurant in bester Laune, ich lachte so sehr über die alten Geschichten von früher, dass ich mich an einem Laternenpfahl festhalten musste. In dem Augenblick kam Doug über die Straße auf uns zu. Er wirkte düster und verblüfft, und sogar eine Spur Missbilligung lag in seinem Blick. Als ob er mich fragen wollte: Wie kannst du nur lachen, wo du gerade eine so schlechte Nachricht bekommen hast?
Bestürzt begriff ich, dass die meisten Leute es offenbar für falsch hielten, fröhlich zu lachen, wenn man eine schwere Krankheit hat, und mir wurde klar, dass ich für den Rest meines Lebens als ein Mensch gelten würde, der nicht mehr lange zu leben hatte.