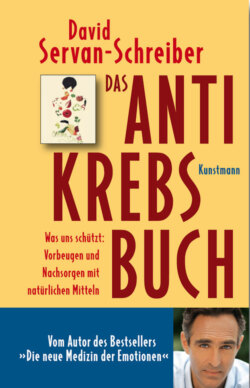Читать книгу Das Antikrebs-Buch - David Servan-Schreiber - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1
MEINE GESCHICHTE
ОглавлениеDAMALS LEBTE ICH SEIT SIEBEN JAHREN in Pittsburgh, zehn Jahre zuvor war ich aus Frankreich weggegangen. Ich machte meine Facharztausbildung in Psychiatrie und setzte gleichzeitig Forschungen fort, die ich für meine Promotion in den neurokognitiven Wissenschaften begonnen hatte. Zusammen mit meinem Freund Jonathan Cohen leitete ich ein Labor für Abbildungen der Gehirnfunktion (Funktionelle Bildgebung), das vom amerikanischen National Institute of Health finanziert wurde. Wir wollten die Mechanismen des Denkens besser verstehen, indem wir dem Gehirn beim Denken zusahen. Nie hätte ich mir vorgestellt, dass diese Forschungen meine eigene Krankheit an den Tag bringen würden.
Jonathan und ich waren eng befreundet. Wir waren beide Ärzte mit der Fachrichtung Psychiatrie und hatten uns gemeinsam für das neurowissenschaftliche Promotionsprogramm in Pittsburgh eingeschrieben. Jonathan kam aus dem kosmopolitischen San Francisco, ich via Montreal aus Paris. Und nun waren wir in Pittsburgh gelandet, mitten in der amerikanischen Provinz – unbekanntes Terrain für uns beide. Kurz zuvor hatten wir in der renommierten Zeitschrift Psychological Review einen Aufsatz über die Rolle des präfrontalen Kortex veröffentlicht, einen bis dahin kaum erforschten Bereich des Gehirns, der eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft herstellt. Mit Hilfe unserer Computersimulationen der Gehirnfunktionen entwickelten wir eine neue Theorie in der Psychologie. Der Artikel sorgte in Fachkreisen für einigen Wirbel und brachte uns, obwohl wir damals noch Studenten waren, in den Genuss staatlicher Fördergelder, mit denen wir ein eigenes Forschungslabor einrichten konnten.
Jonathan meinte, dass Computersimulationen nicht mehr genügten, wenn wir mit unseren Untersuchungen weiterkommen wollten. Wir mussten unsere Theorie in der Praxis überprüfen und die Gehirnfunktionen direkt beobachten, und zwar unter Einsatz der neuesten Technologie: der funktionellen Magnetresonanztomografie (MRT). Damals steckte die Technik noch in den Kinderschuhen. Nur besonders innovative Forschungszentren besaßen die neuen Hochleistungsscanner; in den Krankenhäusern standen meist nur die normalen, längst nicht so leistungsfähigen Geräte. Vor allem hatte man noch nie mit einem Krankenhausgerät die Aktivität im präfrontalen Kortex – die Gegenstand unserer Forschung war – messen können. Im Gegensatz zum visuellen Kortex (der Sehrinde), dessen Aktivitäten man leicht messen kann, lässt sich der präfrontale Kortex nur sehr schwer in Aktion beobachten. Damit wir auf den MRT-Bildern etwas sehen konnten, mussten wir den präfrontalen Kortex mit komplizierten Aufgaben »reizen«. Doug, ein Physiker in unserem Alter, dessen Spezialgebiet die MRT-Technik war, hatte ein neues Verfahren entwickelt, das uns vielleicht helfen konnte, diese Schwierigkeiten zu überwinden und Bilder aufzuzeichnen. Unser Krankenhaus stellte uns den Scanner nach den Sprechstunden für die Zeit zwischen 20 und 23 Uhr zur Verfügung, damit wir unsere neue Methode ausprobieren konnten.
Doug nahm ständig technische Verbesserungen vor, während Jonathan und ich uns Aufgaben überlegten, die diesen Bereich des Gehirns maximal stimulierten. Nach mehreren Misserfolgen konnten wir schließlich auf unseren Bildschirmen den berühmten präfrontalen Kortex bei der Arbeit beobachten. Es war ein ganz besonderer Augenblick, der Höhepunkt einer Zeit intensiver Forschung, und umso aufregender, weil wir ihn als Freunde erlebten.
Ich muss zugeben, wir waren ein bisschen arrogant. Wir waren alle drei Anfang dreißig, hatten gerade unseren Doktortitel erworben und besaßen schon ein eigenes Labor. Mit unserer neuen Theorie, die überall auf großes Interesse stieß, standen Jonathan und ich am Beginn einer vielversprechenden Karriere in der amerikanischen Psychiatrie. Wir beherrschten die neueste Technologie, mit der bis jetzt noch kaum jemand arbeitete. Unter den Psychiatern an den Universitäten waren Computersimulationen neuronaler Netze und die funktionelle Bildgebung mit Hilfe der Magnetresonanztomografie noch kaum bekannt. In jenem Jahr erhielten Jonathan und ich sogar eine Einladung von Professor Widlöcher, damals die große Kapazität in der französischen Psychiatrie. Wir sollten nach Paris kommen und dort ein Seminar am Hôpital de la Pitié-Salpêtrière leiten, der Klinik, wo Freud als Assistent von Charcot gearbeitet hatte. Zwei Tage lang erläuterten wir vor französischen Psychiatern und Neurowissenschaftlern, wie unsere Computersimulationen neuronaler Netze zu einem besseren Verständnis psychologischer und pathologischer Mechanismen beitrugen. Mit dreißig konnte man darauf durchaus stolz sein.
Ich genoss mein Leben in vollen Zügen – ein Leben, das mir heute ein bisschen seltsam vorkommt. Ich war mir meines Erfolgs sicher, setzte großes Vertrauen in die Naturwissenschaften und hatte am Kontakt zu Patienten nicht viel Interesse. Da mich meine Facharztausbildung in der Psychiatrie und mein Forschungslabor voll beanspruchten, versuchte ich, möglichst wenig klinisch zu arbeiten. Deshalb war ich wie die meisten Ärzte nicht begeistert, als ich im Zuge des Ausbildungsprogramms auf eine andere Stelle wechseln sollte, denn das bedeutete eine höhere Arbeitsbelastung, und außerdem ging es dabei nicht um Psychiatrie im eigentlichen Sinn. Ich sollte sechs Monate lang auf der allgemeinmedizinischen Station arbeiten und mich um die psychischen Probleme von Patienten kümmern, die eine Bypassoperation oder eine Lebertransplantation hinter sich hatten oder an Krebs, Lupus, Multipler Sklerose und Ähnlichem litten. Meiner Meinung nach hielt mich diese Arbeit nur von meiner Forschung ab. Außerdem interessierten mich die Patienten mit ihren medizinischen Problemen nicht sonderlich. Ich wollte am Gehirn forschen, Aufsätze schreiben, auf Kongressen Vorträge halten und zum Fortschritt der Wissenschaft beitragen.
Ein Jahr zuvor war ich als Freiwilliger mit »Ärzte ohne Grenzen« im Irak gewesen. Ich hatte das Elend dort miterlebt und meine ganze Energie darauf verwandt, Tag für Tag das Leid vieler Menschen zu lindern. Doch das hatte in mir nicht die Lust geweckt, diese Art von Arbeit in Pittsburgh fortzusetzen. Für mich waren das zwei völlig verschiedene Welten. Ich war in erster Linie jung und ehrgeizig.
Die große Bedeutung, die ich meiner Arbeit in meinem Leben einräumte, trug sicher auch zu der schmerzhaften Trennung bei, die ich gerade hinter mir hatte. Neben anderen Unstimmigkeiten konnte meine Frau es nicht ertragen, dass ich meiner Karriere zuliebe weiter in Pittsburgh leben wollte. Sie wäre gern nach Frankreich zurückgekehrt oder zumindest in eine Stadt wie New York gezogen, die mehr Abwechslung versprach. Für mich jedoch bedeutete Pittsburgh eine Möglichkeit, schneller ans Ziel zu kommen, außerdem wollte ich nicht auf mein Labor und meine Kollegen verzichten. Schließlich landeten wir vor dem Scheidungsrichter, und ich lebte ein Jahr allein in meinem kleinen Haus, von dem ich ohnehin nur das Schlaf- und das Arbeitszimmer sah.
Und dann fiel eines Tages, als das Krankenhaus praktisch verwaist war – es war die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, die ruhigste Woche des Jahres –, mein Blick auf eine junge Frau, die in der Cafeteria saß und Baudelaire las. In den USA ist es ein seltener Anblick, dass jemand beim Mittagessen einen französischen Dichter des 19. Jahrhunderts liest. Ich setzte mich an ihren Tisch. Anna war Russin, hatte hohe Wangenknochen und große dunkle Augen. Sie wirkte zurückhaltend, aber gleichzeitig sehr intelligent. Gelegentlich hörte sie mitten im Satz auf zu reden. Als ich sie verwirrt fragte, was sie tue, antwortete sie: »Ich prüfe das, was du gerade gesagt hast, auf seine Aufrichtigkeit.« Das brachte mich zum Lachen, denn es gefiel mir, wie sie mich in Schach hielt. So begann unsere Beziehung. Sie brauchte Zeit, sich zu entwickeln. Ich hatte es nicht eilig, und Anna auch nicht.
Sechs Monate später ging ich an die University of California in San Francisco und arbeitete dort den Sommer über in einem Labor für Psychopharmakologie. Der Leiter des Labors wollte in den Ruhestand gehen und hätte mich gerne als seinen Nachfolger gesehen. Ich sagte Anna, dass ich mich nicht binden wolle, möglicherweise würde ich in San Francisco eine andere Frau kennenlernen. Natürlich würde ich es auch verstehen, wenn sie sich in einen anderen Mann verlieben sollte. Ich glaube, das verletzte sie, aber ich wollte ganz offen sein. Zum Abschied schenkte ich ihr einen Hund.
Als ich im September nach Pittsburgh zurückkehrte, zog Anna zu mir in mein Puppenhaus. Ich spürte, dass sich zwischen uns etwas entwickelte, und war glücklich. Noch wusste ich nicht, wohin diese Beziehung führen würde, daher blieb ich auf der Hut – ich hatte meine Scheidung noch nicht verwunden. Aber in meinem Leben ging es bergauf. Im Oktober verbrachten wir zwei traumhafte Wochen. Es war Indian Summer. Ich war gebeten worden, ein Drehbuch über meine Erfahrung bei »Ärzte ohne Grenzen« zu verfassen, und Anna schrieb Gedichte. Ich war verliebt.
Und dann geriet ohne Vorwarnung alles ins Wanken.
Ich erinnere mich noch gut an jenen strahlenden Oktoberabend in Pittsburgh, als ich auf dem Weg zum MRT-Zentrum mit dem Motorrad durch Straßen fuhr, die von Bäumen in leuchtendem Herbstlaub gesäumt waren. Jonathan, Doug und ich wollten wieder einmal Experimente an studentischen »Versuchskaninchen« durchführen. Gegen eine geringe Aufwandsentschädigung legten sich die Studenten in den Scanner und lösten für uns mentale Aufgaben. Sie fanden unsere Forschungen ebenso aufregend wie die Aussicht, dass sie im Anschluss eine digitale Aufnahme ihres Gehirns erhielten, die sie sich daheim auf dem Computer ansehen konnten. Der erste Student kam wie verabredet um 20 Uhr. Mit dem zweiten hatten wir 21 Uhr vereinbart, doch er erschien nicht. Daraufhin fragten Jonathan und Doug, ob ich einspringen könnte, denn von uns dreien war ich derjenige mit der geringsten technischen Begabung. Bereitwillig legte ich mich in die enge Röhre, die Arme dicht an den Körper gepresst; es fühlte sich ein bisschen an wie in einem Sarg. Viele Menschen ertragen die Enge in der Röhre nicht: 10 bis 15 Prozent der Patienten sind so klaustrophobisch, dass eine Magnetresonanztomografie für sie nicht infrage kommt.
Da liege ich nun, und wie üblich zeichnen wir zuerst die Gehirnstruktur des Versuchskandidaten auf. Gehirne sind wie Gesichter – keines gleicht dem anderen. Bevor wir Messungen durchführen, muss das Gehirn im Ruhezustand aufgenommen werden. Dieses sogenannte anatomische Bild wird dann mit den Aufnahmen des aktiven Gehirns verglichen, den funktionellen Bildern. Während des Vorgangs ist ein lautes Klopfen zu hören, wie wenn man mit einem Metallstab wiederholt auf den Boden schlagen würde. Das Geräusch kommt von den Bewegungen des Elektromagneten, der durch schnelles Ein- und Ausschalten Variationen im Magnetfeld des Gehirns erzeugt. Die Geschwindigkeit des Klopfens hängt davon ab, ob es sich um eine anatomische oder funktionelle Aufnahme handelt. Nach dem zu schließen, was ich höre, machen Jonathan und Doug anatomische Aufnahmen von meinem Gehirn.
Nach zehn Minuten ist die anatomische Phase abgeschlossen. Ich warte darauf, dass auf den kleinen Monitoren über meinen Augen die von uns programmierte »mentale Aufgabe« erscheint, mit der die Aktivität im präfrontalen Kortex angeregt werden soll, denn Ziel unseres Experiments soll ja die Abbildung dieser Aktivität sein. Bei der Aufgabe leuchten in rascher Abfolge Buchstaben auf. Jedes Mal, wenn zwei aufeinanderfolgende Buchstaben identisch sind, soll ich einen Knopf drücken (der präfrontale Kortex wird aktiviert, weil ich mich ein paar Sekunden lang an die Buchstaben erinnern muss, die nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen sind, um sie mit den nachfolgenden zu vergleichen). Ich warte auf die Aufgabe, die Jonathan mir schicken soll, und das typische schnelle Klopfen des Scanners bei der Aufnahme der funktionellen Hirntätigkeit. Aber nichts passiert. Ich verstehe nicht, was los ist. Jonathan und Doug sitzen hinter einer Scheibe im Kontrollraum, wir können nur über eine Sprechanlage miteinander kommunizieren. Endlich höre ich über den Kopfhörer: »David, wir haben ein Problem. Mit den Bildern stimmt etwas nicht. Wir müssen sie noch mal machen.« Gut. Ich warte.
Wir fangen noch einmal von vorn an. Wieder machen wir zehn Minuten lang anatomische Bilder, dann ist es Zeit für die mentale Aufgabe. Doch ich warte vergeblich. Schließlich meldet sich Jonathan: »Hör zu, da stimmt etwas nicht. Wir kommen zu dir.« Die beiden betreten den Scanner-Raum, und als sie mich aus der Röhre ziehen, registriere ich ihren merkwürdigen Gesichtsausdruck. Jonathan legt mir die Hand auf den Arm und sagt: »Wir können das Experiment nicht machen. Da ist etwas mit deinem Gehirn.« Dann zeigen sie mir auf dem Monitor die Bilder, die sie gerade zweimal mit dem Computer aufgenommen haben.
Ich war weder Radiologe noch Neurologe, hatte aber viele Aufnahmen von Gehirnen gesehen; das gehörte zu unserer täglichen Arbeit. In der rechten Region meines präfrontalen Kortex war eindeutig ein rundes, walnussgroßes Gebilde zu erkennen. An dieser Stelle war das kein gutartiger Hirntumor, wie beispielsweise ein Meningeom oder ein Adenom (Geschwulst) an der Hirnanhangdrüse, die man operieren kann und die nicht zu den aggressiven Tumoren gehören. Es konnte eine Zyste sein oder ein infektiöser Abszess, ausgelöst durch bestimmte Krankheiten wie Aids. Aber mein Gesundheitszustand war ausgezeichnet, ich trieb viel Sport und war sogar Kapitän meiner Squashmannschaft. Damit war eine gutartige Geschwulst ausgeschlossen.
Es ließ sich nicht leugnen, dass es sich um eine schwerwiegende Entdeckung handelte. In fortgeschrittenem Stadium kann ein Hirntumor ohne Behandlung innerhalb von sechs Wochen zum Tod führen, mit Behandlung innerhalb von sechs Monaten. Ich wusste nicht, in welchem Stadium ich mich befand, aber ich kannte die Statistik. Wir schwiegen, wir wussten alle drei nicht, was wir sagen sollten. Jonathan schickte die Aufnahmen an die Radiologieabteilung, damit ein Spezialist sie am nächsten Tag auswerten konnte. Dann verabschiedeten wir uns.
Ich lenkte mein Motorrad zu unserem Häuschen am anderen Ende der Stadt. Es war elf Uhr nachts; am klaren Himmel leuchtete ein prächtiger Mond. Als ich ins Schlafzimmer trat, schlief Anna schon. Ich legte mich neben sie und starrte an die Decke. Wie seltsam, dass mein Leben so enden sollte. Es war unvorstellbar. Zwischen dem, was ich gerade erfahren hatte, und dem, was ich über so viele Jahre aufgebaut hatte, tat sich eine tiefe Kluft auf. Ich hatte einen langen Anlauf genommen und wollte jetzt gerade zum Sprung ansetzen, wollte etwas erreichen. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch ganz am Anfang stand und gerade erst begonnen hatte, einen nützlichen Beitrag zu leisten. Für meine Ausbildung und meine Karriere hatte ich viele Opfer gebracht, viel in die Zukunft investiert. Und plötzlich sah es so aus, als ob es womöglich gar keine Zukunft für mich geben würde.
Mir wurde bewusst, dass ich ganz allein war. Meine Brüder hatten eine Zeit lang in Pittsburgh studiert, waren aber nach ihren Examen weggezogen. Ich hatte keine Frau mehr, und meine Beziehung mit Anna war noch ganz frisch; sie würde mich sicher verlassen, denn wer wollte schon einen Partner, der mit 31 Jahren zum Sterben verurteilt ist? Ich sah mich selbst als ein Stück Holz, das den Fluss hinuntertrieb und plötzlich ans Ufer geschwemmt wurde, in einer Pfütze stehenden Wassers liegen blieb. Ich würde es nie bis zum Ozean schaffen. Durch einen Schicksalsschlag saß ich an einem Ort fest, mit dem mich nichts verband. Ich würde mutterseelenallein in Pittsburgh sterben.
Während ich dalag und grübelnd dem Rauch meiner kleinen indischen Zigarette nachsah, geschah etwas Merkwürdiges. Ich wollte nicht schlafen. Ich hing meinen Gedanken nach und hörte, wie sich in meinem Hinterkopf plötzlich eine leise Stimme zu Wort meldete – ruhig und bestimmt, voller Überzeugung und Klarheit, mit einer Gewissheit, die ich von mir nicht kannte. Das war nicht ich, aber es war definitiv meine Stimme. Gerade, als ich mir immer wieder sagte: »Das kann nicht sein, das kann mir unmöglich passieren«, erklärte die Stimme: »Weißt du was, David? Natürlich ist es möglich, und es ist nicht so schlimm.« Etwas geschah mit mir, etwas Erstaunliches und Unbegreifliches. Von diesem Augenblick an war ich nicht mehr wie gelähmt. Es lag doch auf der Hand: Ja, es war möglich. Wir alle müssen sterben. Viele andere hatten diese Erfahrung vor mir gemacht, es war nichts Besonderes. Es war nichts falsch daran, menschlich und damit sterblich zu sein. Mein Gehirn hatte ganz allein einen Weg gefunden, mich zu beruhigen und zu trösten. Später, als mich wieder Angst überkam, musste ich lernen, meine Gefühle im Zaum zu halten. Aber in jener Nacht konnte ich einschlafen, und am nächsten Tag war ich in der Lage, zur Arbeit zu gehen und die notwendigen Schritte einzuleiten, um mich meiner Krankheit und meinem Leben zu stellen.