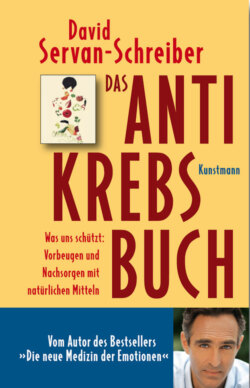Читать книгу Das Antikrebs-Buch - David Servan-Schreiber - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 2
WIE ENTKOMMT MAN DER STATISTIK?
ОглавлениеSTEPHEN JAY GOULD WAR PROFESSOR für Zoologie, ein Spezialist für Evolutionstheorie an der Harvard University. Er war außerdem einer der einflussreichsten Wissenschaftler seiner Generation und galt bei vielen wegen seiner umfassenden Theorien zur Entwicklung der Arten als »zweiter Darwin«.
Im Juli 1982 erfuhr er im Alter von 40 Jahren, dass er ein Mesotheliom in der Bauchhöhle hatte, eine seltene und bösartige Krebsform, deren Entstehung man vor allem dem Kontakt mit Asbest zuschreibt. Nach der Operation bat er seine Ärztin, ihm die besten Fachartikel über Mesotheliome zu nennen. Bis dahin war die Onkologin immer sehr offen zu ihm gewesen, doch jetzt antwortete sie ausweichend, die medizinische Literatur biete nichts wirklich Stichhaltiges zum Thema. Aber einen Wissenschaftler von Goulds Format daran hindern zu wollen, die Veröffentlichungen zu einem Thema zu studieren, das ihn selbst betrifft, ist ein wenig so, wie Gould später schrieb, als würde man »dem Homo sapiens, dem Primaten mit dem stärksten Geschlechtstrieb, empfehlen, keusch zu leben«.
Gould ging schnurstracks vom Krankenhaus zur Universitätsbibliothek und setzte sich mit einem Stapel aktueller medizinischer Fachzeitschriften an einen Tisch. Eine Stunde später verstand er, warum die Ärztin ihm ausgewichen war. Die wissenschaftlichen Studien ließen keinen Zweifel: Ein Mesotheliom war »unheilbar«, die mediane Überlebenszeit lag bei acht Monaten ab Diagnose, das heißt, dass die Patienten durchschnittlich noch acht Monate lebten. Wie ein Tier, das plötzlich in die Klauen eines Raubtiers geraten ist, spürte Gould Panik in sich aufsteigen. Eine gute Viertelstunde lang waren Körper und Geist wie betäubt.
Schließlich gewann seine naturwissenschaftliche Ausbildung die Oberhand und rettete ihn vor der Verzweiflung. Immerhin hatte er fast sein ganzes Leben damit verbracht, Naturphänomene zu studieren und in Zahlen auszudrücken. Und eins hatte er dabei gelernt: In der Natur gibt es kein Gesetz, das universell gültig ist; Abweichung ist die Grundlage allen Lebens. In der Natur ist ein Median (oder Zentralwert) eine Abstraktion, ein »Gesetz«, das der Mensch auf eine Vielzahl von Einzelfällen anwendet. Aber für Gould als Individuum stellte sich die Frage, wo er selbst in der Variationsbreite der Zahlen lag.
Die Tatsache, dass der Median der Überlebensdauer acht Monate betrug, bedeutete, so überlegte Gould, dass die Hälfte der Personen mit Mesotheliom schon vor Ablauf der acht Monate starb. Damit lebte die andere Hälfte länger als acht Monate. Aber zu welcher Hälfte gehörte er? Er war jung, rauchte nicht, war (abgesehen vom Krebs) bei guter Gesundheit, sein Tumor war in einem frühen Stadium diagnostiziert worden, und er konnte auf die beste medizinische Versorgung zählen. Erleichtert kam Gould zu dem Schluss, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach zur vielversprechenden Hälfte gehörte. So weit, so gut.
Dann fiel ihm noch etwas viel Wichtigeres auf. Alle Kurven, mit denen man die Lebenserwartung eines Patienten darstellt (die sogenannten »Überlebenskurven«), haben die gleiche asymmetrische Form: Laut Definition konzentriert sich die Hälfte der Fälle auf die linke Kurvenseite mit einer Überlebenszeit von null bis acht Monaten, während die andere Hälfte auf der rechten Seite natürlich über die acht Monate hinausreicht. Die Kurve, die »Verteilung«, wie es in der Statistik heißt, hat einen langen Schwanz, der sich über eine erhebliche Zeitspanne erstrecken kann.
Fieberhaft suchte Gould in den Zeitschriften nach einer vollständigen Überlebenskurve für Patienten mit Mesotheliom. Als er schließlich fündig wurde, stellte er fest, dass sich die Verteilung über mehrere Jahre hinzog. Das hieß, selbst wenn der Median der Sterblichkeit bei acht Monaten lag, gab es am Ende der Verteilung eine kleine Zahl Patienten, die jahrelang mit der Krankheit gelebt hatten. Gould sah keinen Grund, warum er nicht in den hinteren Bereich der Verteilung fallen sollte, und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus.
Abbildung 1: Überlebenskurve bei einem Mesotheliom, wie sie Stephen Jay Gould vor sich sah.
Diese Entdeckung verlieh Gould neuen Mut, und der Biologe in ihm kam zu einer dritten Schlussfolgerung, die genauso wichtig wie die beiden vorherigen war: Die vorliegende Überlebenskurve berücksichtigte Personen, die 10 oder 20 Jahre zuvor behandelt worden waren. Sie hatten die damals zur Verfügung stehende Therapie erhalten, unter den damaligen Bedingungen. Doch auf einem Gebiet wie der Krebsforschung sind zwei Faktoren einem ständigen Wandel unterworfen: die üblichen Behandlungsformen und unser Wissen darüber, was der Patient zur Unterstützung der Therapie tun kann. Wenn sich die Bedingungen ändern, ändert sich auch die Überlebenskurve. Mit einer neuen Behandlungsmethode und ein bisschen Glück würde Gould vielleicht zu einer neuen Kurve mit einem höheren Median gehören, die viel weiter nach rechts gehen würde, vielleicht bis zu einem natürlichen Tod im hohen Alter.I
Stephen Jay Gould starb 20 Jahre später an einer anderen Krankheit. Er hatte Zeit gehabt, eine bewundernswerte wissenschaftliche Karriere zu verfolgen, und erlebte zwei Jahre vor seinem Tod noch die Veröffentlichung seines Opus magnum, The Structure of Evolutionary Theory. Er hatte 30-mal länger gelebt, als die Onkologen vorhergesagt hatten.
Aus der Geschichte dieses großartigen Naturwissenschaftlers lässt sich eine ganz einfache Schlussfolgerung ziehen: Statistiken sind Informationen, kein Todesurteil. Wenn man Krebs hat und gegen sein Schicksal kämpfen will, sollte man den Blick auf den hinteren, vielversprechenderen Teil der Kurve richten.
Niemand kann den Verlauf einer Krebserkrankung vorhersagen. Professor David Spiegel von der Stanford University organisiert seit 30 Jahren Selbsthilfegruppen mit psychologischer Betreuung für Frauen mit metastasierendem Brustkrebs. Bei einem Vortrag vor Onkologen in Harvard (der im Journal of the American Association of Medicine erschien) schilderte er seine Ratlosigkeit: »Krebs ist eine rätselhafte Krankheit. Wir hatten Patientinnen, bei denen sich vor acht Jahren Metastasen im Gehirn bildeten [Anmerkung des Autors: eine besonders bedrohliche Entwicklung bei Brustkrebs] und denen es heute gut geht. Wie kommt das? Niemand weiß es. Es ist eines der großen Geheimnisse der Chemotherapie, dass die Tumoren manchmal verschwinden und sich die Überlebenszeit trotzdem kaum verlängert. Die Verbindung zwischen somatischer Resistenz und einem Fortschreiten der Krankheit ist selbst aus rein onkologischer Sicht immer noch schwer zu erklären.«1
Wir alle haben schon von Wunderheilungen gehört, von Menschen, denen die Ärzte nur noch wenige Monate gaben und die trotzdem noch jahre-, sogar jahrzehntelang lebten. »Aber das sind Einzelfälle«, werden wir gewarnt. Oder man sagt uns, dass es sich bei diesen Fällen vermutlich gar nicht um Krebs gehandelt habe, sondern um eine Fehldiagnose. In den Achtzigerjahren gingen zwei Wissenschaftler von der Erasmus-Universität in Rotterdam der Sache nach und untersuchten systematisch Fälle von Spontanheilungen bei Krebs, bei denen die Diagnose nicht infrage gestellt werden konnte. Nachdem sie 18 Monate lang recherchiert hatten, zählten sie zu ihrer großen Überraschung allein in ihrer kleinen Region in den Niederlanden sieben Fälle, die so eindeutig wie unerklärlich waren.2 Es gibt daher guten Grund zu der Annahme, dass solche Fälle viel häufiger sind, als allgemein eingeräumt wird.
Organisationen und Einrichtungen wie das Commonweal Center in Kalifornien bieten Kurse an (darauf gehe ich später noch genauer ein), bei denen die Patienten versuchen, ihr Leben und ihre Krankheit in die Hand zu nehmen. Sie lernen, in größerer Harmonie mit ihrem Körper und ihrer Vergangenheit zu leben und durch Yoga und Meditation ihr inneres Gleichgewicht zu finden. Sie ernähren sich mit Lebensmitteln, die helfen, den Krebs zu bekämpfen, und meiden solche Lebensmittel, die sein Wachstum fördern. Ihre Krankheitsgeschichten zeigen, dass sie zwei- bis dreimal so lange leben wie ein durchschnittlicher Patient mit der gleichen Krebsart im gleichen Stadium.II3
Ein befreundeter Onkologe von der University of Pittsburgh, mit dem ich über diese Zahlen sprach, wandte ein: »Das sind keine gewöhnlichen Patienten. Sie sind besser ausgebildet, motivierter und in besserer gesundheitlicher Verfassung. Die Tatsache, dass sie länger leben, beweist gar nichts.« Aber genau darauf kommt es an: Wer besser über seine Krankheit informiert ist, auf Körper und Seele achtet und sie mit dem versorgt, was die Gesundheit verbessert, kann die Schutzmechanismen seines Körpers gegen Krebs mobilisieren. Diese Patienten leben besser, und sie leben länger.
Inzwischen hat Dr. Dean Ornish, Professor für Medizin an der University of California in San Francisco und Vorkämpfer der ganzheitlichen Medizin, weitere Nachweise erbracht. 2005 veröffentlichte er die Ergebnisse einer bis dahin einmaligen onkologischen Studie.4 Sie begleitete 93 Männer mit Prostatakrebs im Frühstadium (bestätigt durch eine Biopsie), die sich gegen eine Operation entschieden hatten. Daraufhin wurde der Verlauf der Krankheit von ihrem Onkologen beobachtet und in regelmäßigen Abständen der PSA-Wert im Blut gemessen. Das Prostataspezifische Antigen (PSA) ist ein Eiweiß, das in den Zellen der Prostata gebildet wird und im Blut nachweisbar ist. Ein Anstieg des PSA-Werts deutet darauf hin, dass sich die Krebszellen vermehrt haben und der Tumor wächst.
Da die Männer für den Beobachtungszeitraum eine schulmedizinische Behandlung abgelehnt hatten, konnte man die Wirkung eines natürlichen Therapieansatzes untersuchen. Per Losverfahren wurden sie in zwei Gruppen eingeteilt, um von Anfang an vergleichbare Bedingungen zu schaffen. Bei der Kontrollgruppe wurden nur der PSA-Wert ermittelt und der Krankheitsverlauf kontrolliert. Für die andere Gruppe entwickelte Dr. Ornish ein umfassendes Programm für Körper und Seele. Ein Jahr lang ernährten sich die Patienten vegetarisch und nahmen Nahrungsergänzungsmittel zu sich (die Antioxidantien Vitamin E und C und Selen, dazu noch ein Gramm Omega-3-Fettsäuren pro Tag), sie bewegten sich regelmäßig (ein 30-minütiger Spaziergang an sechs Tagen die Woche), lernten Entspannungstechniken (Yoga, Atemübungen, autogenes Training oder progressive Muskelentspannung) und trafen sich einmal in der Woche in einer Selbsthilfegruppe mit anderen Patienten aus dem Programm.
Das Programm bedeutete eine radikale Veränderung des Lebensstils, vor allem für gestresste Führungskräfte und Familienväter mit vielen Verpflichtungen. Ornishs Methoden hatten lange als sonderbar und irrational gegolten, Erfolge waren als Einbildung abgetan worden. Doch schon nach 12 Monaten beseitigten die Ergebnisse der Studie alle Zweifel.
Bei den 49 Patienten, die ihren Lebensstil nicht geändert und auf eine regelmäßige Überwachung der Krankheit vertraut hatten, verschlechterte sich der Krebs in sechs Fällen; diese Männer mussten sich einer Operation unterziehen, gefolgt von einer Chemotherapie und Bestrahlung. Von den 41 Patienten, die an Ornishs Pogramm teilgenommen hatten, benötigte dagegen kein Einziger eine derartige Behandlung. In der ersten Gruppe war der PSA-Wert (der Auskunft über das Wachstum des Tumors gibt) im Schnitt um 6 Prozent gestiegen, und dabei wurden die Männer, die aus der Studie ausscheiden mussten, weil ihre Krankheit zu weit fortgeschritten war (ihr PSA-Wert war beunruhigend gestiegen), gar nicht berücksichtigt, sonst wäre der durchschnittliche PSA-Wert noch höher ausgefallen. Die Entwicklung in der ersten Gruppe wies darauf hin, dass die Tumoren zwar langsam, aber stetig wuchsen. Bei der zweiten Gruppe dagegen war der PSA-Wert im Durchschnitt um 4 Prozent gesunken, was auf eine Rückbildung der Tumoren bei den meisten Patienten hindeutet.
Aber noch beeindruckender waren die allgemeinen Vorgänge im Körper der Männer, die ihren Lebensstil geändert hatten. Als man ihr Blut typischen Krebszellen der Prostata aussetzte (Zellen der LNCaP-Zelllinie, an denen die bei einer Chemotherapie verwendeten Medikamente getestet werden), war dessen Fähigkeit, das Wachstum der Krebszellen zu hemmen, siebenmal höher als beim Blut der Männer, die ihren Lebensstil nicht geändert hatten. Das heißt, je sorgfältiger die Männer Dr. Ornishs Ratschläge befolgten und ihren Lebensstil entsprechend veränderten, desto aktiver wehrte ihr Blut die Krebszellen ab!
In der Wissenschaft spricht man von »Dosis-Wirkung-Verhältnis«, und es ist ein wichtiges Argument dafür, dass eine kausale Beziehung zwischen Lebensstil und Krebs besteht.
Um die molekularen Mechanismen hinter den Daten aufzuklären, untersuchte Dr. Ornish, wie Verhaltensänderungen die Genexpression in den Prostatazellen beeinflussen. Er entnahm vor Beginn eines Programms zur Lebensstilveränderung eine DNA-Probe aus der Prostata der Testperson und drei Monate später eine weitere Probe. Die Ergebnisse der 2008 veröffentlichten Studie wurden den Erwartungen gerecht: Sie belegten, dass Ornishs Programm zur Lebensstilveränderung die Funktionsweise von mehr als 500 Genen in der Prostata beeinflusst hatte.5 Es stimulierte Gene, die eine vorbeugende Wirkung gegen Krebs haben, und hemmte andere, die Krebs fördern. Bei einem Teilnehmer der Studie, Jack McClure, war der Krebs sechs Jahre zuvor diagnostiziert worden. Nach drei Monaten in Ornishs Programm zeigte er keinerlei Symptome der Krankheit mehr. »Bei meiner letzten Biopsie haben sie keine Krebszellen mehr gefunden. Ich will noch nicht sagen, dass ich geheilt bin. Sie finden einfach keinen Krebs mehr.« Dean Ornish meint, diese Studie müsse all jenen Hoffnung vermitteln, die fürchten, dass sie aufgrund einer genetischen Vorbelastung Krebs bekommen werden. »So oft sagen Menschen, ich habe schlechte Gene, was kann ich tun? Wie es aussieht, können sie wesentlich mehr tun, als sie dachten.«
Krebsgene sind womöglich nicht defekte Teile unserer biologischen Maschinerie, die uns dazu verdammen, krank zu werden. Im Jahr 2009 erschütterten unabhängig voneinander zwei Forschergruppen, die eine in Quebec, die andere in Kalifornien, unser bisheriges Verständnis der genetischen Ursachen von Brust- und Prostatakrebs und insgesamt die Vorstellung, dass unsere Gene festlegen, wie hoch unser Risiko ist, an Krebs zu sterben. Bei der Lektüre dieser Studien fühlt man sich an die traditionelle Vorstellung von »Ahnen« erinnert, wie man sie aus asiatischen Kulturen oder dem alten Rom kennt. In diesen Kulturen glaubte man, die Geister der Ahnen würden die Orte bevölkern, an denen sie gewohnt hatten. Wenn man die Ahnen nicht beständig mit Gaben von Nahrungsmitteln besänftigte, konnten sie alles mögliche Unheil über den Haushalt bringen. Krebsgene könnten sich ein bisschen wie solche »hungrigen Geister« verhalten: Sie zeigen sich nur und richten nur dann Unheil an, wenn wir vergessen, uns angemessen um sie zu kümmern.
An der Universität von Montreal untersuchte eine Forschergruppe um Dr. Parviz Ghadirian Frauen, die Trägerinnen der Brustkrebsgene BRCA-1 und BRCA-2 waren, zwei Gene, die viele Frauen in Angst und Schrecken versetzen, weil beinahe 80 Prozent der Trägerinnen im Lauf ihres Lebens an Brustkrebs erkranken. Viele Frauen, die erfahren haben, dass sie Trägerinnen sind, lassen sich lieber beide Brüste amputieren, als mit der nahezu sicheren Perspektive zu leben, dass sie eines Tages erkranken werden. Doch Ghadirian und sein Team stellten fest, dass bei manchen Trägerinnen der beiden Gene das Erkrankungsrisiko erheblich geringer war. Und was war ihre Beobachtung? Je mehr Obst und Gemüse diese Frauen aßen, desto geringer war ihr Erkrankungsrisiko. Bei den Frauen, die pro Woche bis zu 27 verschiedene Sorten Obst und Gemüse verzehrten (allem Anschein nach ist es wichtig, dass es möglichst viele verschiedene Sorten sind), war das Risiko um nicht weniger als 73 Prozent vermindert.6An der Universität von San Francisco kam eine Forschergruppe um Professor John Witte zu ganz ähnlichen Ergebnissen bei Prostatakrebs.7 Bestimmte Gene triggern eine extreme Anfälligkeit für Entzündungsprozesse und regen langsam wachsende Mikrotumoren der Prostata an, sich zu aggressiven, metastasierenden Krebstumoren zu entwickeln.III Doch wenn die Männer, die Träger dieser Gene waren, mindestens zweimal pro Woche fetten Fisch mit viel Omega-3 konsumierten, blieben die Gene unter Kontrolle. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Tumoren aggressiv wurden, war fünfmal geringer als bei den Männern, die überhaupt keinen Fisch aßen.
Diese neuen Erkenntnisse sprechen für die Annahme, dass »Krebsgene« nicht so gefährlich sind, solange sie nicht durch unseren ungesunden Lebensstil aktiviert werden. Sie verhalten sich ein bisschen wie die jähzornigen Geister der Ahnen, die regelmäßige Opfergaben verlangen, damit sie ruhig bleiben. Tatsächlich sind es vielleicht einfach Gene, die nicht gut mit dem Übergang von der Ernährungsweise unserer Vorfahren, die perfekt an die Bedürfnisse unseres Organismus angepasst war, zu unserer modernen Ernährung mit vielen industriell hergestellten und verarbeiteten Produkten (siehe Kapitel 6) zurechtgekommen sind. Das würde beispielsweise erklären, warum vor dem Zweiten Weltkrieg geborene Frauen, die Trägerinnen des Brustkrebsgens BRCA sind, ein zwei- bis dreimal geringeres Risiko haben, an Brustkrebs zu erkranken, als ihre in der Fastfood-Ära geborenen Töchter und Enkelinnen.8 Vielleicht sind diese so sehr gefürchteten Gene letztlich gar keine »Krebsgene«, sondern eher »Fastfood-Unverträglichkeitsgene«. Entsprechendes könnte auch für andere Lebensstilfaktoren wie Bewegung und den Umgang mit Stress gelten.
Abbildung 2: Die Fähigkeit, die Entwicklung von Prostatakrebszellen zu hemmen, ist im Blut der Männer, die an Dr. Ornishs Programm teilnahmen, siebenmal höher als im Blut der Männer, die ihren Lebensstil nicht änderten.
Die Immunzellen im Blut gingen umso aktiver gegen die Krebszellen vor, je eifriger die Männer Dr. Ornishs Ratschläge befolgten und in ihrem Alltag anwandten. Damit war der Beweis für einen Zusammenhang zwischen einem veränderten Lebensstil und der gehemmten Entwicklung von Krebszellen eindeutig erbracht.
Abbildung 3: Je rigoroser das Programm umgesetzt wird, desto besser kann das Blut der Patienten das Wachstum der Prostatakrebszellen hemmen.
Kurzum, die Statistiken zur Überlebensrate bei Krebs unterscheiden nicht zwischen Patienten, die das Urteil der Ärzte passiv hinnehmen, und Patienten, die ihre eigene natürliche Abwehr mobilisieren. Die Patienten, die weiter rauchen, sich krebserregenden Substanzen aussetzen, sich typisch westlich ernähren (was, wie wir noch sehen werden, Krebs begünstigt), ihre Immunabwehr mit zu viel Stress und unbewältigten Gefühlen belasten oder ihren Körper im Stich lassen, indem sie sich zu wenig bewegen, werden ebenso vom »Median« erfasst wie die Patienten, die wesentlich länger leben. Deren erhöhte Lebensdauer ist aller Wahrscheinlichkeit nach darauf zurückzuführen, dass sie zusätzlich zur konventionellen Behandlung ihre natürliche Abwehr mobilisiert haben. Sie haben für sich den harmonischen Umgang mit vier grundlegenden Regeln gefunden: Entgiftung von krebserregenden Substanzen, eine Antikrebs-Diät, Bewegung und die Suche nach dem inneren Gleichgewicht.
Kein natürlicher Ansatz allein kann Krebs heilen. Aber Krebs bedeutet auch nicht, dass man sein Schicksal kampflos akzeptieren muss. Wie Stephen Jay Gould können wir die Statistik ganz nüchtern betrachten und uns die rechte Seite der Kurve mit ihrem langen Verlauf zum Ziel setzen. Und zu diesem Ziel führt kein besserer Weg, als zu lernen, wie wir die Ressourcen unseres Körpers so nutzen, dass wir ein erfülltes, langes Leben führen.
Nicht jeder geht diesen Weg aufgrund einer bewussten Entscheidung; manchmal zwingt uns eine Krankheit zum Umdenken. Im Chinesischen wird der Begriff »Krise« als Kombination der beiden Zeichen für »Gefahr« und »Chance« geschrieben. Krebs ist so bedrohlich, dass er uns blind für alles andere machen kann; wir begreifen nur mühsam die Chance. Meine Krankheit hat mein Leben in vielerlei Hinsicht zum Guten verändert, und das auf eine Art, die ich mir nicht vorstellen konnte, als ich dachte, mein Todesurteil sei gesprochen. Es begann kurz nach der Diagnose …
| I | Stephen Jay Gould schildert seine Reaktion auf die Krebsstatistik in einem ausgezeichneten Aufsatz mit dem Titel »The Median isn’t the Message« (»Der Median ist nicht die Botschaft«). Er ist im Internet auf der Website www.cancerguide.org zu finden (auf Englisch). Dank an Steve Dunn und seine Website www.cancerguide.org, die diese Information einer breiten ÷ffentlichkeit zugänglich machen. |
| II | Das ist allerdings keine wissenschaftliche Studie; die Zahlen stammen aus der Nachbeobachtung der Patienten, die an dem Programm teilgenommen haben. |
| III | Diese Gene kontrollieren die Aktivität des Enzyms, das für die Umwandlung der Omega-6-Fettsäuren aus der Nahrung in Entzündungsfaktoren verantwortlich ist. |