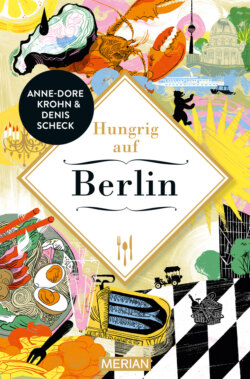Читать книгу Hungrig auf Berlin - Denis Scheck - Страница 10
BRÖTCHEN-FLATRATE IM ASCHINGER
ОглавлениеIm Berlin des Jahres 2022 boomt der Markt für Stadtführungen, die zu den In-Kneipen und Tanzlokalen von damals führen. Leider nicht im Programm enthalten: die acht Restaurants und an die 30 Bierquellen-Filialen von Aschinger am Köllnischen Markt, der Friedrichstraße, am Alexanderplatz oder am Rosenthalerplatz, am Hackeschen und am Werderschen Markt, in der Leipziger-, der Invaliden- oder der Tauentzienstraße. Nichts von dem einstigen Gastroimperium der Brüder Aschinger hat in der Berliner Gegenwart überlebt – bis auf die 1912 erbauten einstigen Großbäckereien in der Saarbrücker Straße, deren unschlagbar billige Produktionsweise den Erfolg von Aschinger begründete. Heute sind sie unter dem Namen Backfabrik ein Kreativquartier und Veranstaltungsort. In den Stehbierhallen und Restaurants von Aschinger konnte man in den 20ern die berühmte Erbsensuppe essen und hatte dazu noch eine Brötchen-Flatrate. Daran erinnert sich auch der Maler George Grosz, der im Januar 1933 in die USA emigrieren musste, in seiner 1946 veröffentlichten Autobiografie »Ein kleines Ja und ein großes Nein«. Die Gastrokultur im Berlin der 20er-Jahre beschrieb Grosz für seine amerikanische Leserschaft so: »Wir liebten die kleinen Eckkneipen, die man Stehbierhallen nannte. Da stand man neben dem Kohlenträger, dem Rollkutscher und dem Portier von nebenan und trank sein kleines Helles, aß seinen Rollmops und nahm hinterher noch einen ›Koks mit Pfiff‹. Das war Kartoffelschnaps mit einem Stückchen Zucker, das in Rum getaucht war. Wer phantasievoller gestimmt war, bestellte ein ›Persico mit Rosen‹ (Kornschnaps mit einem Schuß Himbeersirups) oder eine ›Grüne Minna‹ (Kartoffelschnaps mit einem Schuß grünem Pfefferminzlikörs). War man knapp an Geld, so konnte man jederzeit bei Aschinger seinen Hunger stillen: Man bestellte einen Teller Erbsensuppe, der kostete 30 Pfennig und war kein Teller, sondern eine kleine Terrine. Die Hauptsache aber war: Man konnte dazu soviel Brot und Brötchen haben, wie man wollte. War der Brotkorb auf dem Teller leer, so kam der Kellner von selbst und füllte nach; kleine Dampfbrötchen, noch warm und knusprig, ein Kümmelbrot, herrliche Salzstangen. Was in unseren Taschen verschwand, wurde nicht beanstandet, man durfte es nur nicht zu auffällig machen. Aschinger war eine wahre Wohltat für hungrige Künstler.«
Wie viele Literaturenthusiasten begeistern wir uns, je älter wir werden, immer mehr für Alfred Döblin, der seinen Stil von Buch zu Buch radikal wechselt. Sein Roman »Berlin Alexanderplatz« von 1929 ist nicht nur eine von James Joyces’ »Ulysses« und John Dos Passos’ »USA-Trilogie« inspirierte Geschichte über den Niedergang des Gelegenheitsarbeiters und Kleinkriminellen Franz Biberkopf im Kampf mit der Großstadt Berlin. Genau genommen liest sich Döblins Meisterwerk auch über weite Strecken wie ein Berliner Restaurant- und Kneipenführer. Franz Biberkopf frisst und säuft nach seiner Haftentlassung im Grunde ununterbrochen – denn nur so kann er sich seiner immer prekäreren Existenz versichern: »Meck und der Stumme staunten, wie Franz ganz auftaute, mit Wonne aß und trank, Eisbeine, dann Bohnen mit Einlage und eine Molle Engelhardt nach der anderen, und ihnen spendierte er [ ... ] Und sie meckerten, schmatzten, schluckten zu dritt. Immer wieder verkündete Franz: ›Man muß sich auffüllen. Ein Mensch, der Kraft hat, muß essen. Wenn du die Plautze nicht voll hast, kannste nischt machen.‹« Wer nach solchen Ernährungsgrundsätzen lebt, muss einfach früher oder später bei Aschinger landen. Franz Biberkopf entwickelt bei Aschinger eine regelrecht sozialdarwinistische Naturphilosophie, in der auch ein kräftiger Schluck aus der Pulle von Oswald Spenglers »Der Untergang des Abendlandes« eingeflossen ist: »Aschinger hat ein großes Café und Restaurant. Wer keinen Bauch hat, kann einen kriegen, wer einen hat, kann ihn beliebig vergrößern. Die Natur läßt sich nicht betrügen! Wer glaubt, aus entwertetem Weißmehl hergestellte Brote und Backwaren durch künstliche Zusätze verbessern zu können, der täuscht sich und die Verbraucher. Die Natur hat ihre Lebensgesetze und rächt jeden Mißbrauch. Der erschütterte Gesundheitszustand fast aller Kulturvölker der Gegenwart hat seine Ursache im Genuß entwerteter und künstlich verfeinerter Nahrung. Feine Wurstwaren auch außer dem Haus, Leberwurst und Blutwurst billig.«
Auch wenn wir heute ein anderes Verhältnis und Verständnis von »feinen Wurstwaren« haben, wie sie zum Beispiel die Fleischerei Kumpel und Keule in der Markthalle Neun (>) vorlebt, und weniger leichtfertig pauschale Aussagen über »Kulturvölker« treffen: Döblin stattet seinen Franz Biberkopf mit einem durchdringend scharfen Blick für die anderen Gäste im Aschinger aus: »Ein junger, dicker Herr mit einer Hornbrille sitzt auf einem Stuhl und verzehrt den Mittagstisch. Man sieht ihn an und stellt fest: Er hat einen dampfenden Teller mit Roulade, Soße und Kartoffel vor sich stehen und ist dabei, alles hintereinander zu verschlingen. Seine Augen wandern hin und her über den Teller, dabei nimmt ihm keiner was weg, sitzt keiner in der Nähe, er sitzt ganz allein an seinem Tisch, aber doch in Sorge, zerschneidet, drückt an seinem Futter und schiebt es sich in den Mund, rasch, eins, eins, eins, eins, und während er arbeitet, eins rin, eins raus, eins rin, eins raus, während er schneidet, quetscht und schlingt, schnüffelt, schmeckt und schluckt, betrachten seine Augen, beobachten seine Augen den immer kleineren Rest auf dem Teller, bewachen ihn rundherum wie zwei bissige Hunde und taxieren seinen Umfang. Noch eins rin, eins raus. Punkt, jetzt ist fertig, jetzt steht er auf, schlapp und dick, der Kerl hat alles glatt aufgefressen, jetzt kann er auch zahlen. Er faßt in die Brusttasche und schmatzt: ›Fräulein, was machts?‹ Dann geht der dicke Kerl raus, schnauft, macht sich hinten den Hosenbund locker, damit der Bauch gut Platz hat. Dem liegen gut drei Pfund im Magen, lauter Eßwaren.«